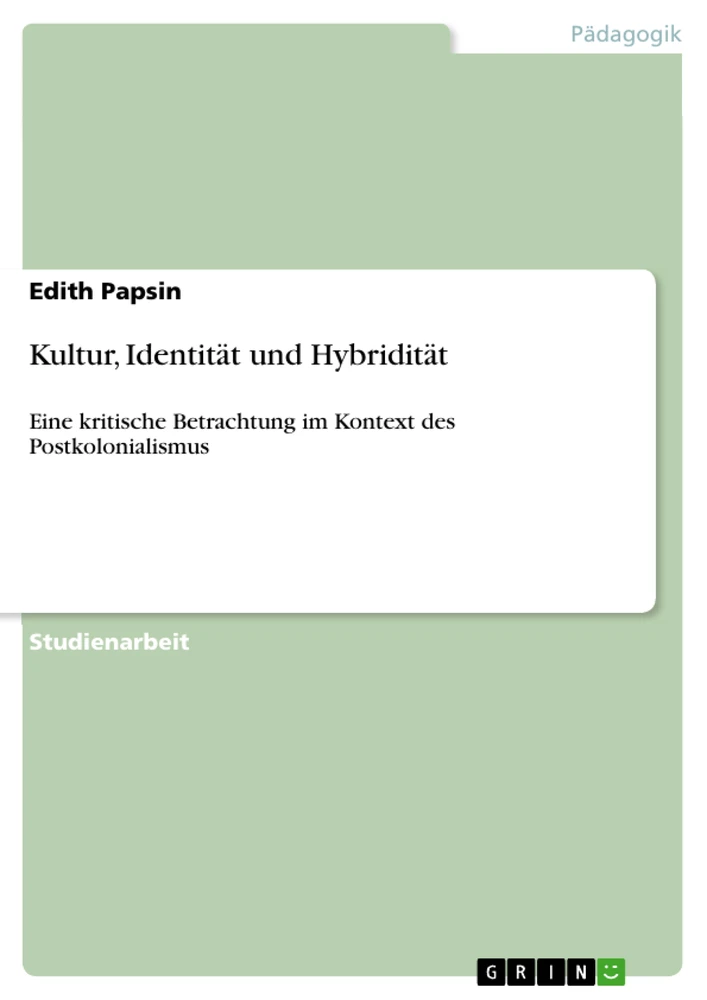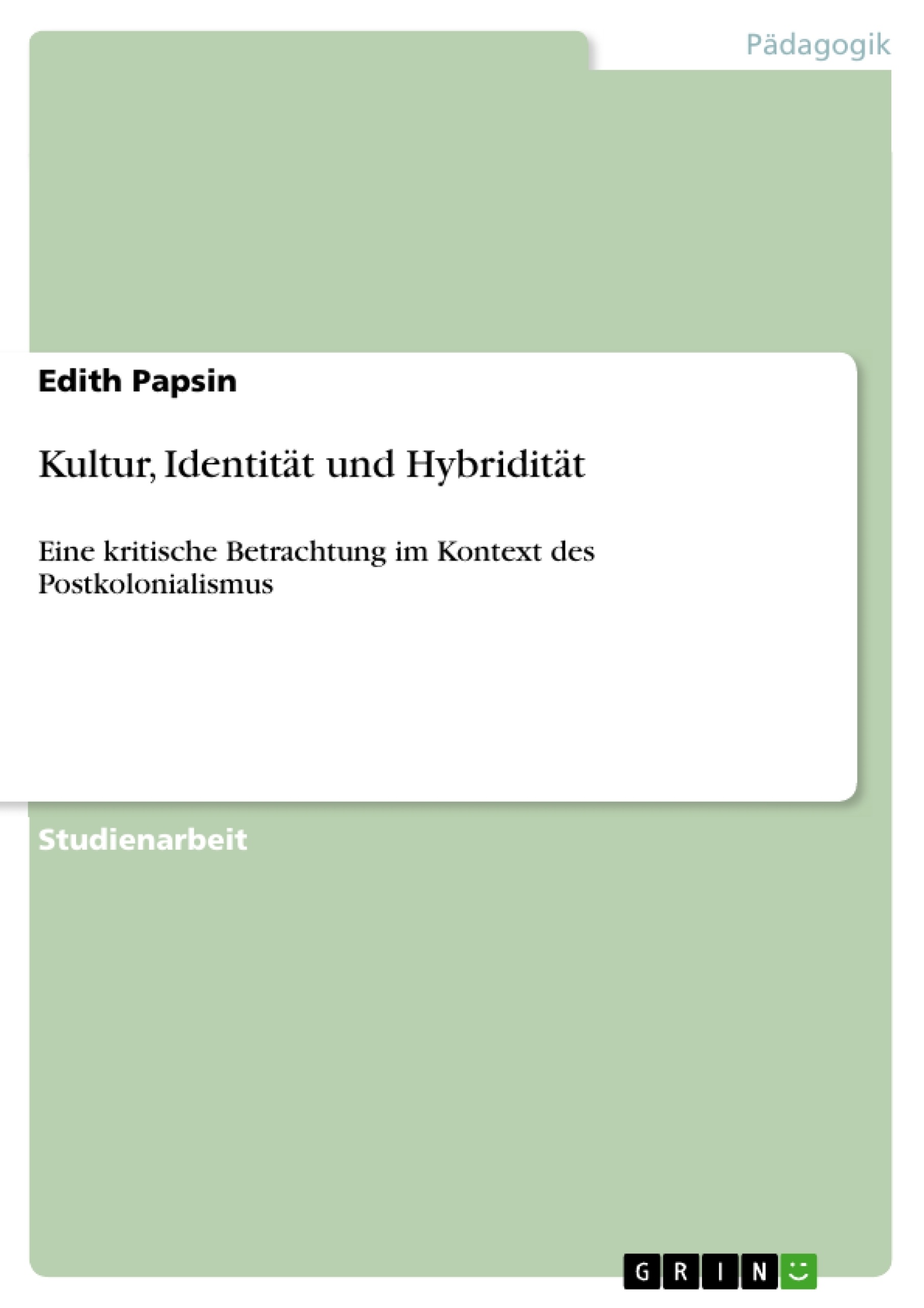Deutschland wird im Vergleich zu Großbritannien oder Frankreich historisch nicht zu den großen Kolonialmächten gezählt. Während postkoloniale Theorien in den USA bereits in den 1970er Jahren als akademische Disziplin integriert wurden, fanden diese im deutschen Wissenschaftsraum erst in den 1990er Jahren Beachtung.
Dies liegt unter anderem an dem vergleichsweise kurzen Zeitraum der deutschen Kolonialherrschaft und der damit untergeordneten Relevanz Deutschlands in diesem Forschungsfeld.
Doch auch wenn der deutsche Kolonialismus in Afrika in literaturgeschichtlichen Studien lediglich als „Randerscheinung“ betrachtet wurde und stets betont wurde, dass Deutschland sich aufgrund des relativ kurzen Zeitraumes, in dem deutsche Kolonien in Afrika bestanden, nicht mit dem Prozess der Kolonialisierung und Dekolonialisierung beschäftigen müsse, ist diesem Argument nicht zuzustimmen.
Denn allein der Zeitraum der Kolonialherrschaft ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidender Faktor für den Grad nachhaltiger gesellschaftlicher Prägungen und somit für die Auseinandersetzung mit dem kolonialen sowie postkolonialen Diskurs entscheidend. Demzufolge ist der deutsche Kolonialismus nicht rein als historische Episode zu bewerten, sondern integraler Bestandteil eines globalen Geschehens, welches bis heute verschiedene Denkweisen über Begriffe, wie Kultur, Ethnizität oder Identität zur Folge hat. Darüber hinaus sollte der Kolonialismus als transnationales Phänomen betrachtet werden, da der Kolonialismus auch in Ländern, die nie kolonialisiert wurden, enorme Spuren hinterlassen hat. Die postkoloniale Theorie findet aus diesem Grund in einem globalen Zusammenhang weltweit Anwendungsmöglichkeiten.
Bei der Betrachtung von Postkolonialismus und postkolonialer Theorien, sind diese Begriffe zunächst zeitlich und inhaltlich einzuordnen sowie in Bezug zu Begriffen, wie Kolonialismus und Imperialismus zu setzen. Weiterhin sollen die Auswirkungen kolonialer Machtverhältnisse auf Kultur sowie das Individuum beschrieben werden. Dabei wird im Besonderen auf den Begriff der Hybridität von Homi K. Bhabha sowie subjektbezogen auf den Aspekt von ethnischer Identität in der Migration eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Postkolonialismus und postkoloniale Theorien
- 3. Die Idee der Hybridität
- 3.1. Hybridität und Kultur nach Homi K. Bhabha
- 3.2. Kritische Betrachtung des Hypes um Hybridität
- 4. Hybridität und ethnische Identität in der Migration
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den deutschen Kolonialismus und seine anhaltenden Auswirkungen auf Kultur und Identität, insbesondere im Kontext der postkolonialen Theorie. Sie beleuchtet die Relevanz postkolonialer Diskurse für Deutschland, trotz des im Vergleich zu anderen europäischen Mächten kürzeren Kolonialzeitraums. Die Arbeit strebt an, dualistische Denkstrukturen aufzubrechen und alternative Perspektiven, wie die der Hybridität, zu präsentieren.
- Der deutsche Kolonialismus als integraler Bestandteil eines globalen Geschehens.
- Kritische Betrachtung von Kultur und ethnischer Identität aus postkolonialer Perspektive.
- Der Begriff der Hybridität und seine Relevanz für das Verständnis von Kultur und Identität.
- Die Auswirkungen kolonialer Machtverhältnisse auf Kultur und Individuum.
- Soziale und kulturelle Konflikte, die von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart reichen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Relevanz postkolonialer Theorien für Deutschland in den Kontext des vergleichsweise kurzen deutschen Kolonialismus. Sie argumentiert gegen die These, dass der kurze Zeitraum der deutschen Kolonialherrschaft die Auseinandersetzung mit postkolonialen Diskursen überflüssig mache. Stattdessen wird der deutsche Kolonialismus als integraler Bestandteil eines globalen Prozesses dargestellt, der nachhaltige gesellschaftliche Prägungen bis heute hinterlassen hat und die Denkweisen über Kultur, Ethnizität und Identität beeinflusst. Die Einleitung umreißt die Ziele der Arbeit, die darin bestehen, soziale und kulturelle Konflikte aufzuzeigen und dualistische Denkstrukturen durch Konzepte wie die Hybridität aufzubrechen.
2. Postkolonialismus und postkoloniale Theorien: Dieses Kapitel ordnet die Begriffe Postkolonialismus und postkoloniale Theorien zeitlich und inhaltlich ein und setzt sie in Beziehung zu Kolonialismus und Imperialismus. Es beschreibt verschiedene Formen der Kolonialisierung (Beherrschungs-, Stützpunkt- und Siedlungskolonien) und analysiert die mit ihnen verbundenen Herrschaftsverhältnisse, die durch physische, militärische, epistemologische und ideologische Gewalt durchgesetzt wurden. Der Kolonialdiskurs mit seinen begrifflichen Gegensätzen (innen/außen, Moderne/Tradition, West/Ost) wird als Mittel zur Legitimierung und Aufrechterhaltung kolonialer Machtverhältnisse dargestellt. Das Kapitel bezieht sich auf Edward Saids Orientalismus und dessen Konzept des diskursiven Machtsystems, welches die koloniale Unterwerfung erleichtert hat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Unbekannter Text (Titel fehlt im gegebenen HTML)
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich mit dem deutschen Kolonialismus und seinen anhaltenden Auswirkungen auf Kultur und Identität im Kontext postkolonialer Theorien. Er untersucht insbesondere die Relevanz postkolonialer Diskurse für Deutschland, trotz des relativ kurzen Zeitraums deutscher Kolonialherrschaft. Ein zentraler Begriff ist dabei die Hybridität.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: den deutschen Kolonialismus als Teil eines globalen Geschehens; kritische Betrachtung von Kultur und ethnischer Identität aus postkolonialer Perspektive; den Begriff der Hybridität und seine Bedeutung für das Verständnis von Kultur und Identität; die Auswirkungen kolonialer Machtverhältnisse auf Kultur und Individuum; und soziale und kulturelle Konflikte mit Wurzeln in der Kolonialzeit bis in die Gegenwart.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text umfasst fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Forschungsfrage und argumentiert für die Relevanz postkolonialer Theorien für Deutschland. Kapitel 2 (Postkolonialismus und postkoloniale Theorien) definiert die zentralen Begriffe und analysiert verschiedene Formen der Kolonialisierung und den damit verbundenen Kolonialdiskurs. Kapitel 3 (Die Idee der Hybridität) befasst sich mit dem Konzept der Hybridität, insbesondere im Kontext der Theorie von Homi K. Bhabha und dessen kritische Betrachtung. Kapitel 4 (Hybridität und ethnische Identität in der Migration) untersucht die Hybridität im Kontext von Migration. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen (dieser Inhalt ist nicht im gegebenen HTML enthalten).
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Der Text verwendet postkoloniale Theorien und bezieht sich explizit auf Edward Saids "Orientalismus" und dessen Konzept des diskursiven Machtsystems. Der Begriff der Hybridität nach Homi K. Bhabha spielt eine zentrale Rolle.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, dualistische Denkstrukturen aufzubrechen und alternative Perspektiven, wie die der Hybridität, zu präsentieren. Er möchte die anhaltenden Auswirkungen des deutschen Kolonialismus auf die heutige Gesellschaft aufzeigen und die Relevanz postkolonialer Diskurse für Deutschland hervorheben.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit postkolonialen Studien, deutschen Kolonialgeschichte und Fragen von Kultur und Identität auseinandersetzt.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Postkolonialismus, postkoloniale Theorien, Hybridität, Kolonialismus, Imperialismus, Kultur, Identität, ethnische Identität, Migration, Edward Said, Orientalismus, Homi K. Bhabha.
- Quote paper
- Edith Papsin (Author), 2013, Kultur, Identität und Hybridität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262609