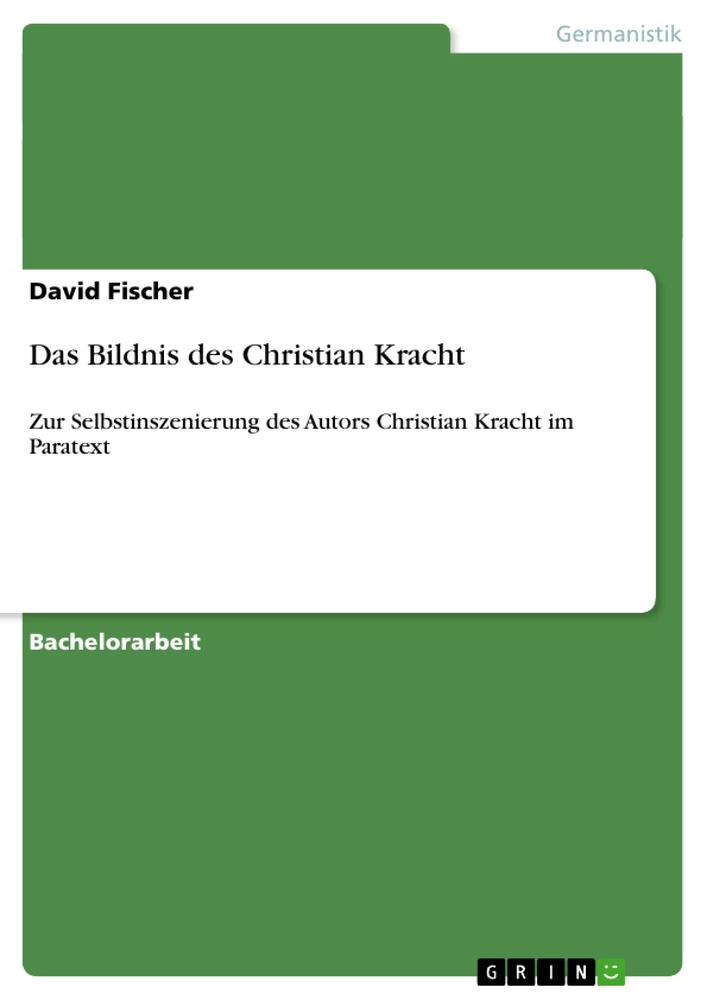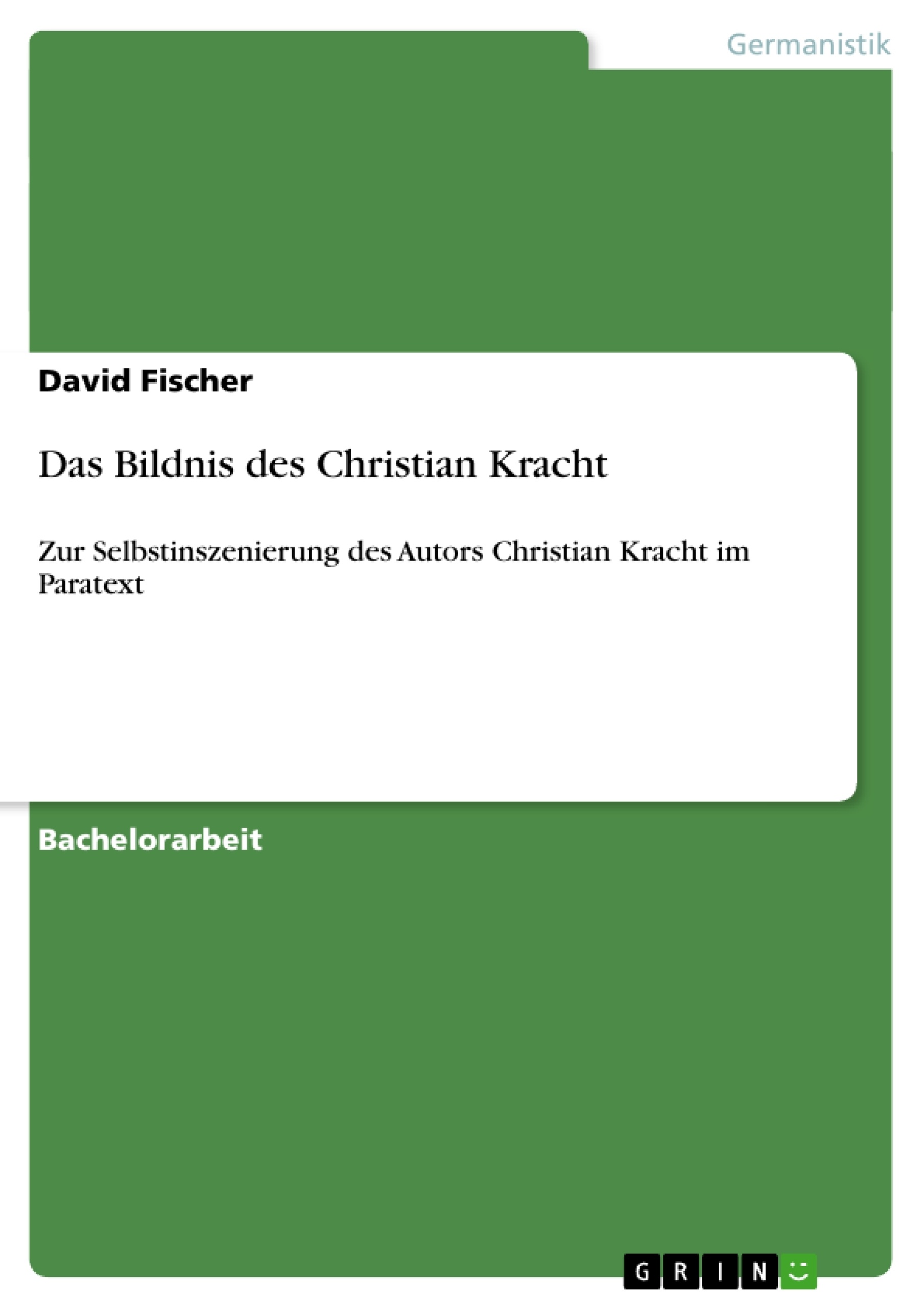Der Literaturwissenschaft fehle es schlichtweg an „Stil“, einem Schriftsteller wie ihm gerecht zu werden, urteilte einmal Mara Delius in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er fasziniert, begeistert und irritiert, heißt es wiederum an einer anderen Stelle, in der Einleitung eines Sammelbands zu Leben und Werk des Schweizers. Und in der Süddeutschen Zeitung konnte man lesen, seine „stete Rede vom Werteverfall und einer Identitätskrise des modernen Subjekts, sein Gebaren als ‚postmoderner
Dandy’ und ‚reaktionärer Schnösel’“ besitze Kalkül. Summa Summarum lassen sich die Aussagen auf eine übertragbare Formel bringen: Wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor seiner Zeit schafft es Christian Kracht, „die Medien zum Tanzen zu bringen“ (Süddeutsche Zeitung).
Für viele ist er ein Buch mit sieben Siegeln. Das Interesse an seiner Person steht dem Interesse an seinen Bestsellern in nichts nach. Fakt ist: Wo Interpretationen enden, wo die Sinnsuche zu Zugängen zu Leben und Werk beginnt kommt Krachts offeriertes Identitätsangebot ins Spiel. Ein Angebot von Informationen verpackt als Inszenierungsstrategien, die sich anschicken, jene Leerstellen im Autorprofil
füllen zu wollen, welche sich Lesern durch „einfache Deutungen verschließ[en]“. Das Bildnis des Christian Kracht ist das Resultat, das aus diesen Prozessen entsteht; ein mediales Selbstporträt, das sich aus der Strichführung diverser Selbstinszenierungen zu einer kohärenten Identität zusammenfügt.
Mal affektiert, mitunter versteckt, manchmal auch scheinbar beiläufig passiert sie, die Autorinszenierung des umstrittenen Schriftstellers aus Saanen. Ob im Verwirrspiel um sein wahres Ich, im Moment der ästhetischen Selbststilisierung oder als Grenzgänger zwischen Autor, Figur und Erzähler - Christian Kracht beherrscht die Mechanismen der Aufmerksamkeit, sein literarisches Provokationspotenzial reicht weit über die bloße Textebene hinaus. Man könnte auch sagen, Kracht folgt frei einem Aphorismus Salvador Dalís, der als Aufgabe von Kunst postuliert hatte, systematisch
Verwirrung zu stiften, das setzte Kreativität frei.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Methodik
- Einführung - Der mit den Medien tanzt
- Annahmen und Methodik
- Der Autor ist tot - Es lebe der Autor?
- Überlegungen zu Autor und Autorschaft
- Roland Barthes - Tod des Autors
- Boris Éjchenbaum - Das literarische Leben
- Michel Foucault - Was ist ein Autor?
- Dirk Niefanger - Label und Logo
- Inszenierung, Maskerade und Theatralität - Der Autor als Schauspieler
- Forschungsstand zur Autorinszenierung Christian Krachts
- Christian Kracht und der Dandyismus
- Analyse
- Das versteckte Triptychon - Autorinszenierung im Peritext des Gelben Bleistifts
- Vorüberlegungen zur Abgrenzungsstrategie in Krachts Reisetexten
- Der gelbe Bleistift - Umschlagseite eins
- Der gelbe Bleistift - Umschlagseite vier
- Verschwinden, verschweigen, verändern - Autorinszenierung im Epitext Internet
- Vorüberlegungen zum Begriff Epitext
- Bedeutung des Intemets für die „moderne" Autorinszenierung
- Das Schweigen des Dandys - Krachts stille Inszenierung in Facebook
- Krachts Ästhetik des Verschwindens in Text, Bildern und im Netz
- Heimlich inszeniert - Krachts Interventionen in Wikipedia
- Das versteckte Triptychon - Autorinszenierung im Peritext des Gelben Bleistifts
- Fazit und Ausblick
- Anhang
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Selbstinszenierung des Autors Christian Kracht im Paratext, insbesondere im Peritext des Erzählbands Der gelbe Bleistift sowie im Epitext Internet. Die Untersuchung analysiert die verschiedenen Strategien, die Kracht einsetzt, um sein Image als Dandy, Nonkonformist und provokativer Autor zu konstruieren. Dabei werden die Wechselwirkungen zwischen Werk, Leben und Inszenierung in den Blick genommen.
- Das Konzept des Dandys als ästhetisches und soziales Phänomen
- Die Rolle des Paratexts in der Konstruktion von Autorschaft
- Die Bedeutung des Internets als Plattform für Autorinszenierungen
- Die Ambivalenz von Authentizität und Inszenierung in Krachts Selbstdarstellungen
- Die Verwendung von Symbolen, Referenzen und Zeichen in Krachts Werk und Inszenierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Autorinszenierung ein und erläutert die methodischen Grundlagen der Arbeit. Der Autorbegriff wird im historischen Kontext betrachtet und in Bezug auf die Theorien von Roland Barthes, Boris Éjchenbaum und Michel Foucault analysiert. Der Begriff des Dandys wird als relevantes Konzept für die Interpretation von Krachts Werk vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der Analyse des Gelben Bleistifts als Beispiel für Krachts Autorinszenierung im Peritext. Der Buchumschlag wird als ästhetisches Konzept betrachtet, das über die Funktion einer bloßen Rahmung hinausgeht. Die Rezensionen auf der Umschlagseite vier werden als strukturelles Element interpretiert, das auf eine Triptychon-Form verweist und damit die Komplexität von Krachts Inszenierung verdeutlicht.
Kapitel 3.2 untersucht Krachts Autorinszenierung im Epitext Internet. Der Begriff Epitext wird erläutert und die Bedeutung des Internets für die „moderne" Autorinszenierung hervorgehoben. Krachts Facebook-Auftritt wird als Beispiel für eine stille Inszenierung analysiert, die auf das Prinzip des Verschwindens setzt. Die Analyse zeigt, wie Kracht in den verschiedenen Medien seine Ästhetik des Verschwindens durchsetzt.
Der Anhang enthält ein Protokoll der geänderten Wikipedia-Einträge Christian Krachts, das als Beweis für die heimliche Inszenierung des Autors in der Onlineenzyklopädie dient.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Christian Kracht, Autorinszenierung, Paratext, Peritext, Epitext, Dandyismus, Popliteratur, Intertextualität, Authentizität, Inszenierung, Verschwinden, Internet, Facebook, Wikipedia.
- Quote paper
- David Fischer (Author), 2012, Das Bildnis des Christian Kracht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262569