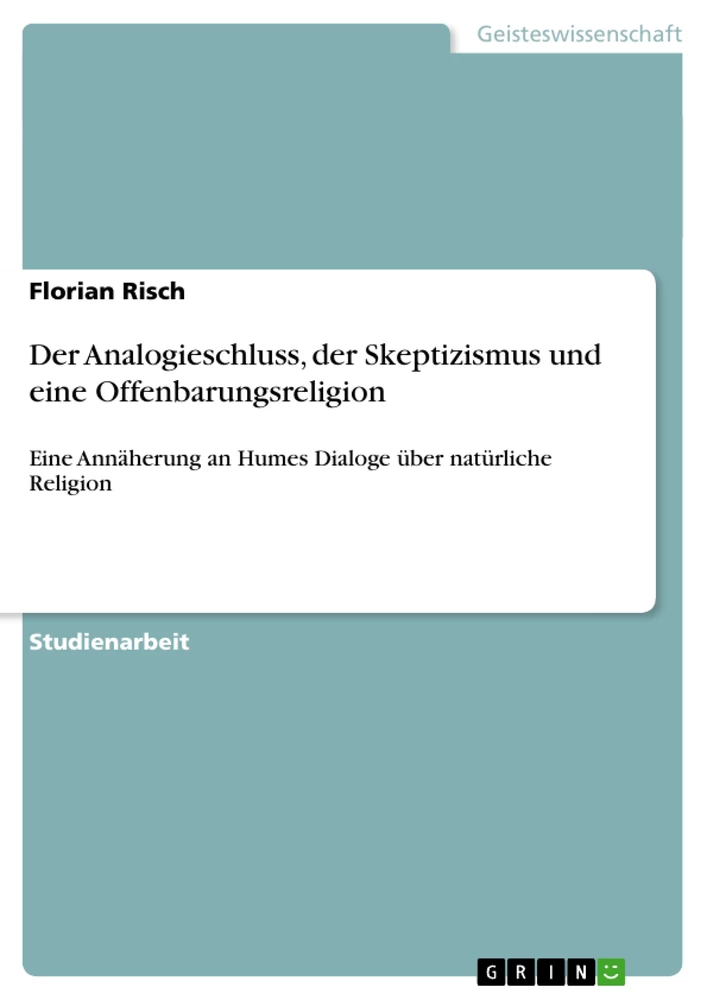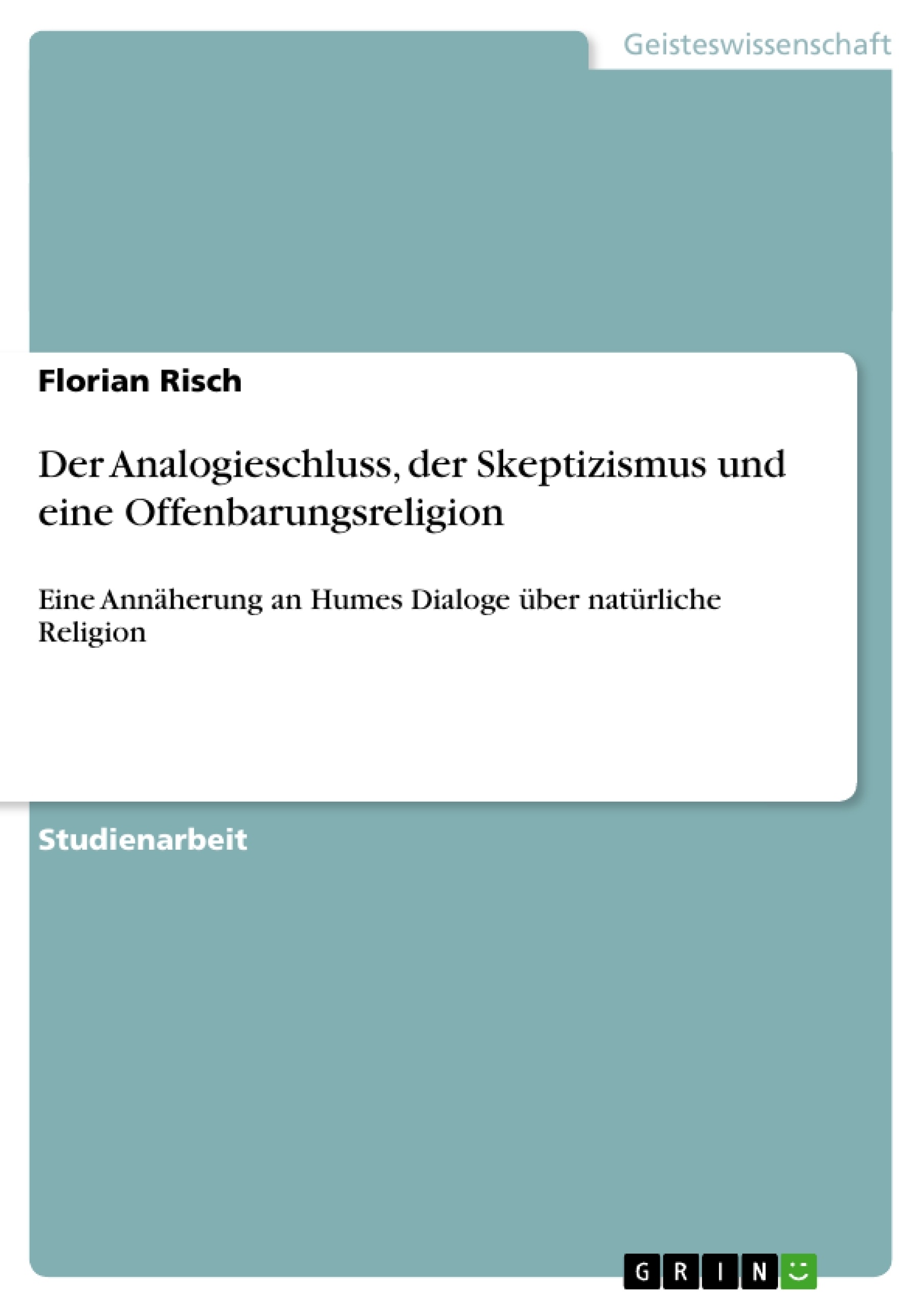David Hume stellt in diesem Werk – Dialoge über natürlich Religion - drei Standpunkte bezüglich der Beschaffenheit Gottes gegenüber: Einen christlichen Offenbarungsgläubigen, einen Theisten und ein Skeptiker, die genauen Argumente und Argumentationsweisen sollen ausgeführt werden.
Diese Arbeit soll die Schlussfolgerungen der drei Diskutierenden gegenüberstellen, sie aber nicht einfach bewerten und beurteilen, sondern vor allem Überblick bieten in welche theoretische Verhältnisse sich die Argumente einbetten. Dazu gehört die Darlegung ihrer Thesen genauso wie eine Einordnung ihrer gottesgerichteten Annahmen überhaupt.
Trotzdem soll schlussendlich eine Beurteilung erfolgen, ob einem Standpunkt eine höhere Gewichtung zugestanden werden kann als man es einem anderen tun darf.
Prinzipiell wird also unterschieden werden müssen, ob eine Beweisbarkeit besteht oder ob es einer Beweisbarkeit an sich überhaupt bedarf. Dieser These würde ein Christ zum Beispiel wohl am ehesten folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Cleanthes Analogieschluss
- 2. Philos argumentativer Überbau und der Glaube Demeas
- 3. Philo und der Skeptizismus
- 4. Folgerungen und Konsequenzen aus einem Skeptizismus?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Dialoge über natürliche Religion von David Hume, indem sie die Argumentationslinien der drei Protagonisten – Cleanthes, Demea und Philo – gegenüberstellt und in ihren philosophischen Kontext einordnet. Das Ziel ist es, die jeweiligen Standpunkte zu verstehen und letztendlich zu bewerten, welcher Position eine höhere Gewichtung zukommen sollte. Die Arbeit vermeidet eine einfache Beurteilung und konzentriert sich stattdessen auf die theoretischen Grundlagen der Argumente.
- Analyse des Analogieschlusses von Cleanthes
- Gegenüberstellung der Positionen von Cleanthes, Demea und Philo
- Untersuchung des philosophischen Hintergrunds der Argumente (Empirismus, Apriorismus, Skeptizismus)
- Bewertung der Beweisbarkeit göttlicher Existenz
- Diskussion der Konsequenzen des philosophischen Skeptizismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Grundzüge des Werkes "Dialoge über natürliche Religion" von David Hume und die drei dargestellten Positionen bezüglich Gottes: den christlichen Offenbarungsgläubigen (Demea), den Theisten (Cleanthes) und den Skeptiker (Philo). Die Arbeit zielt darauf ab, die Argumente der drei Diskutierenden darzulegen und in ihren theoretischen Kontext einzuordnen, bevor eine abschließende Bewertung vorgenommen wird, welcher Standpunkt letztendlich mehr Gewicht zukommen sollte. Die zentrale Frage ist, ob eine Beweisbarkeit Gottes besteht und ob eine solche überhaupt erforderlich ist.
1. Cleanthes Analogieschluss: Dieses Kapitel beschreibt das empiristische Argument von Cleanthes, das auf Beobachtungen der Welt und ihrer Komplexität basiert. Cleanthes argumentiert anthropomorph, indem er die Eigenschaften der Welt auf ein göttliches Wesen überträgt, das die Welt intentional konstruiert hat. Sein Analogieschluss beruht auf der Beobachtung der Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur, die er auf die Fähigkeiten eines Schöpfers zurückführt, analog zu menschlichen Fähigkeiten im kreativen Schaffen. Dieser Schluss steht im Gegensatz zu Demeas apriorischem Gottesverständnis, das auf Offenbarung basiert und einen solchen empirischen Schluss ablehnt.
2. Philos argumentativer Überbau und der Glaube Demeas: Dieses Kapitel analysiert die Argumentationsstrategie Philos und deren Wirkung auf Demeas apriorischen, christlich geprägten Glauben. Philo verwendet eine wohlwollende Interpretationsmethode, um die Argumente seiner Gegner zu stärken und sie anschließend zu widerlegen. Humes scheinbar ausgewogene Darstellung der Standpunkte bis kurz vor dem Ende verdeutlicht Philos Geschick in der Argumentation. Demeas Apriorismus erweist sich im Verlauf der Dialoge als anfällig gegenüber Philos skeptischer Kritik. Philo widerlegt nicht Demeas Glaube an sich, sondern die Möglichkeit, diesen zu beweisen.
3. Philo und der Skeptizismus: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Philos skeptische Argumentation. Philo argumentiert, dass die empirischen Beobachtungen Cleanthes' keine hinreichenden Beweise für die Existenz Gottes liefern. Er verweist auf die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens und die Unmöglichkeit, aus begrenzten Beobachtungen unendliche Schlüsse über die Natur Gottes zu ziehen. Philos Skeptizismus wird im Kontext von Humes Induktionsskepsis erläutert, die die Unmöglichkeit betont, aus endlichen Beobachtungen allgemeingültige Schlüsse zu ziehen. Philos Argument widerlegt nicht nur Cleanthes' Analogieschluss, sondern auch Demeas apriorischen Gottesbegriff.
4. Folgerungen und Konsequenzen aus einem Skeptizismus?: Dieses Kapitel diskutiert die Konsequenzen von Philos Skeptizismus. Der Skeptizismus wird als Ausweg aus dogmatischen und zirkulären Argumentationen dargestellt. Die Frage, ob der Skeptizismus selbst dogmatisch sei (dogmatischer Atheismus), wird verneint. Stattdessen wird argumentiert, dass Philos Position eher agnostisch ist: Er verneint die Beantwortbarkeit der Frage nach Gottes Existenz aufgrund der beschränkten kognitiven Fähigkeiten des Menschen.
Schlüsselwörter
David Hume, Dialoge über natürliche Religion, Cleanthes, Demea, Philo, Empirismus, Apriorismus, Skeptizismus, Analogieschluss, Gottesbeweis, Theismus, Christentum, Agnostizismus, Münchhausen-Trilemma, Induktionsskepsis.
Häufig gestellte Fragen zu Humes "Dialoge über natürliche Religion"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert David Humes "Dialoge über natürliche Religion". Sie vergleicht die Argumentationslinien der drei Protagonisten – Cleanthes, Demea und Philo – und ordnet sie in ihren philosophischen Kontext ein. Ziel ist die Bewertung der jeweiligen Standpunkte und die Frage, welcher Position mehr Gewicht zukommen sollte. Der Fokus liegt auf den theoretischen Grundlagen der Argumente.
Welche Positionen vertreten Cleanthes, Demea und Philo?
Cleanthes vertritt einen empiristischen Theismus, der auf Analogieschlüssen aus der Ordnung der Natur basiert. Demea vertritt einen apriorischen, christlich geprägten Glauben, der auf Offenbarung beruht. Philo hingegen ist der Skeptiker, der die Beweisbarkeit sowohl von Cleanthes' empiristischer als auch von Demeas apriorischer Position bestreitet.
Was ist Cleanthes' Analogieschluss?
Cleanthes argumentiert, dass die Komplexität und Ordnung der Welt auf einen intelligenten Schöpfer hindeuten, analog zu menschlichen kreativen Leistungen. Er überträgt anthropomorph Eigenschaften der Welt auf ein göttliches Wesen.
Wie argumentiert Philo?
Philo verwendet eine wohlwollende Interpretationsmethode, um die Argumente seiner Gegner zu stärken und anschließend deren Schwächen aufzuzeigen. Er betont die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens und die Unmöglichkeit, aus begrenzten Beobachtungen unendliche Schlüsse über die Natur Gottes zu ziehen. Sein Skeptizismus basiert auf Humes Induktionsskepsis.
Was ist der Unterschied zwischen Demeas und Philos Positionen?
Demea vertritt einen apriorischen Glauben, der auf Offenbarung basiert, während Philo den Skeptizismus vertritt und die Beweisbarkeit jeglicher Position bezweifelt. Philo widerlegt nicht Demeas Glauben an sich, sondern die Möglichkeit, diesen zu beweisen.
Welche Konsequenzen zieht Philo aus seinem Skeptizismus?
Philo sieht den Skeptizismus als Ausweg aus dogmatischen und zirkulären Argumentationen. Er lehnt einen dogmatischen Atheismus ab und vertritt eher eine agnostische Position: Die Frage nach Gottes Existenz ist aufgrund der begrenzten kognitiven Fähigkeiten des Menschen unbeantwortbar.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: David Hume, Dialoge über natürliche Religion, Cleanthes, Demea, Philo, Empirismus, Apriorismus, Skeptizismus, Analogieschluss, Gottesbeweis, Theismus, Christentum, Agnostizismus, Münchhausen-Trilemma, Induktionsskepsis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Cleanthes' Analogieschluss, ein Kapitel zur Argumentation Philos und Demeas Glauben, ein Kapitel zu Philos Skeptizismus und abschließend ein Kapitel zu den Konsequenzen des Skeptizismus.
Welche zentrale Frage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Frage ist, ob eine Beweisbarkeit Gottes besteht und ob eine solche überhaupt erforderlich ist.
Welche Methode verwendet die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Argumente der drei Diskutierenden und ordnet sie in ihren theoretischen Kontext ein, bevor eine abschließende Bewertung vorgenommen wird. Sie vermeidet eine einfache Beurteilung und konzentriert sich auf die theoretischen Grundlagen der Argumente.
- Quote paper
- Florian Risch (Author), 2012, Der Analogieschluss, der Skeptizismus und eine Offenbarungsreligion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262556