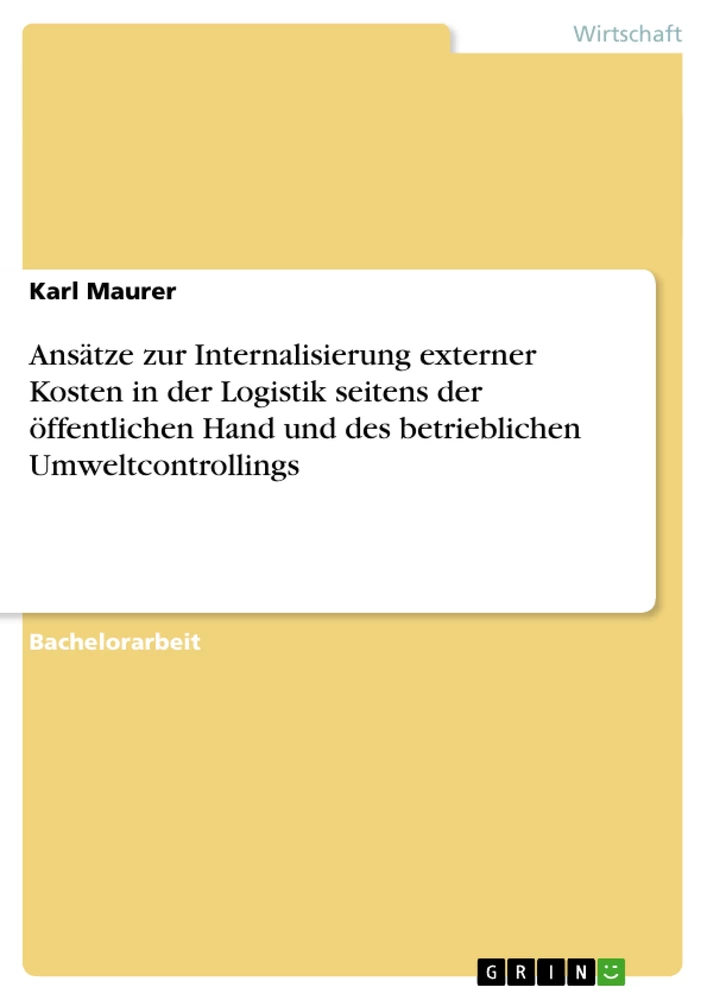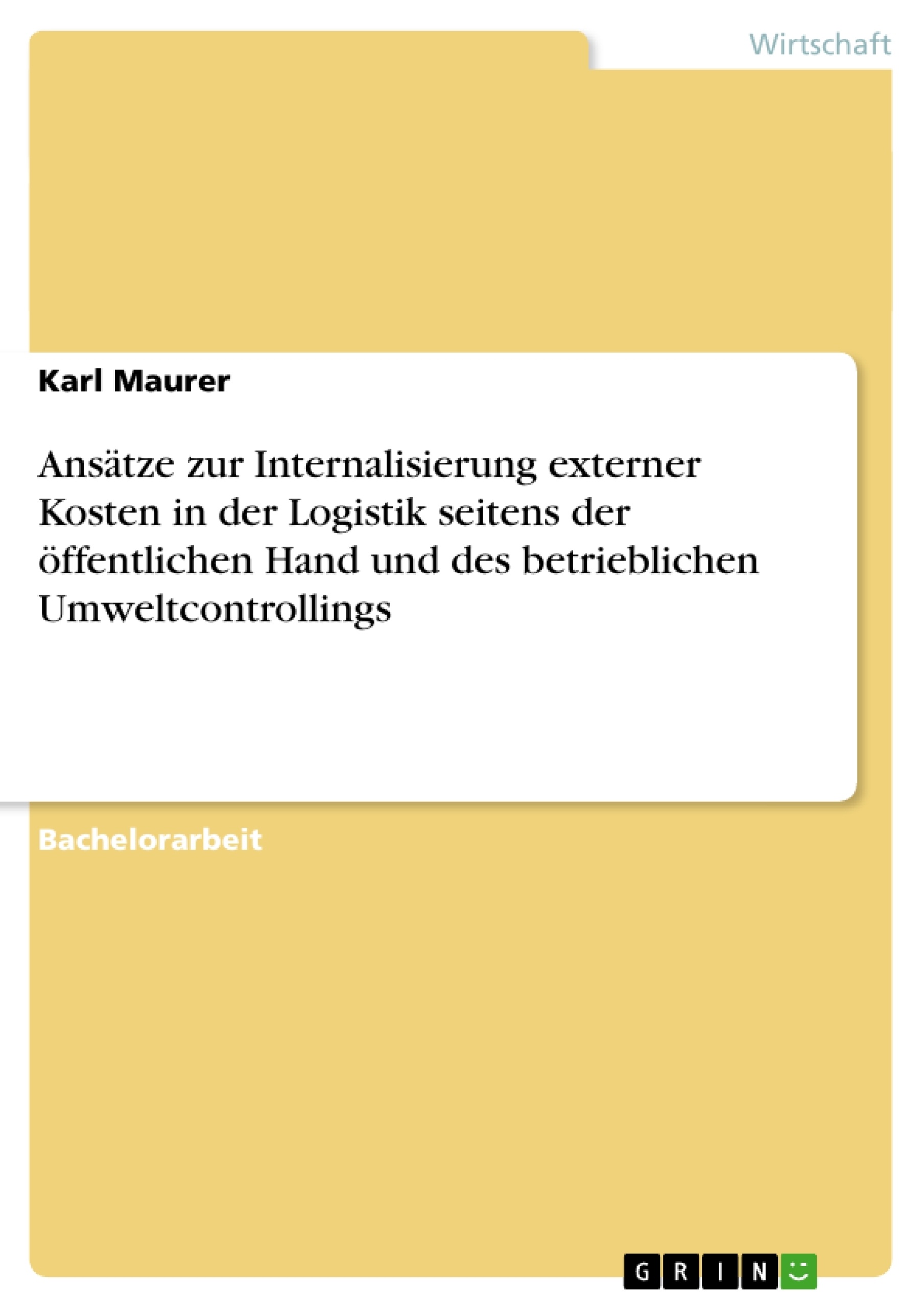Bei historischer Betrachtung des Themas Umwelt kann es als gegeben erachtet werden, dass diese seitens der Gesellschaft als öffentliches Gut galt und daher bei deren Nutzung keine Rücksicht auf die Nachhaltigkeit genommen wurde. Durch das Charakteristikum eines öffentlichen Gutes, dass die Konsumenten nicht von der Nutzung aus-geschlossen werden können, muss jeder seinen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt bei-steuern. Durch die Entwicklung der Wissensdisziplin „Umweltressourcenmanagement“ und immer ungewöhnlicheren Wetterkapriolen wird der Umwelt immer mehr Beachtung geschenkt. Die Menschheit ist mittlerweile hellhörig geworden, wenn es um ihre Zukunft und vielmehr um die Zukunft der nächsten Generationen geht. Aufgrund dieser wachsenden Feinfühligkeit liegt es an der öffentlichen Hand und an der Wirtschaft auf diesen Impuls einzugehen und nachhaltige Ideen für einen ökologischeren Umgang mit unserer Umwelt zu finden.
Durch die Globalisierung erscheint die Erde immer kleiner und Güter können von beinahe jedem Ort der Welt innerhalb kürzester Zeit geliefert werden. Hinter dieser Errungenschaft stecken komplexe logistische Abläufe, die zwangsweise zu einer Zunahme der bereits bestehenden externen Effekte geführt haben. Doch sind bereits aussagekräftige Ideen bzw. Umsetzungen gefunden worden, um diese Effekte verursachungsgerecht zu erfassen, oder vielmehr noch zu deren Vermeidung beizutragen?
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1. Hintergrund
1.2. Ziel der Arbeit und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen
1.3. Aufbau der Arbeit
1.4. Methodologie
2.. Einführung in die Thematik der externen Effekte
2.1. Der Begriff der externen Effekte
2.1.1. Kategorisierung externer Effekte
2.1.2. Gesamtauswirkungen negativer externer Effekte
2.2. Volkswirtschaftliche Ansätze zur Internalisierung externer Effekte
2.2.1. Die Besteuerung nach Pigou
2.2.2. Die Eigentumsrechte nach Coase
2.2.3. Sonstige Ansätze
2.3. Von externen Effekten zu externen Kosten
2.3.1. Problem der Quantifizierung externer Kosten
2.3.2. Problem der Monetarisierung externer Kosten
3. Nachhaltigkeit in der Logistik
3.1. Begriffsdefinitionen
3.1.1. Nachhaltigkeit und ihre Dimensionen
3.1.2. Logistik und ihre Dimensionen
3.1.3. Nachhaltige Logistik
3.2. Gründe für die Internalisierung externer Kosten in der Logistik
3.3. Beteiligte Stakeholder und deren Interessenskonflikte
3.4. Zielkonflikte bei der Internalisierung externer Kosten im Logistiksektor
3.4.1. Wettbewerbsfähigkeit
3.4.2. Technische Umsetzungsprobleme
3.4.3. Unvollständige Information
3.4.4. Organisationelle Probleme
4.. Ansätze zur Internalisierung externer Kosten seitens der öffentlichen Hand
4.1. Instanzenzug und Instrumente der öffentlichen Hand
4.2. Ansätze bei der Infrastrukturschaffung
4.3. Ansätze bei der Infrastrukturnutzung
4.3.1. INFRAS Studie: Externe Kosten des Verkehrs
4.3.2. Umsetzung der Kosteninternalisierung
4.3.3. EU-Wegekostenrichtlinie
4.3.4. Emission Trading System
4.4. Ansätze im Logistikbereich
4.5. EMAS Umweltmanagementsystem
4.6. Zukünftige Entwicklungen
5. Ausgewählte Methoden zur Erfassung externer Kosten der Logistik seitens des Umweltcontrollings
5.1. Total Quality Management
5.2. Life Cycle Costing und Total Cost of Ownership
5.3. Ökobilanzen
5.4. Zukünftige Entwicklungen
6.. Conclusio
7.. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Kosten externer Effekte'
Abbildung 2: Optimaler Schadensvermeidungsumfang
Abbildung 3: ProzentuellerAnteil externer Kosten nach Verkehrsträgern (EU17)
Abbildung 4: Möglichkeiten zur Internalisierung externer Kosten im Straßenverkehr.
Abbildung 5: Ablauf einer Ökobilanzierung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht über die externen Kosten des Straßenverkehrs und die wichtigsten getroffenen Annahmen
1. Einleitung
1.1. Hintergrund
Bei historischer Betrachtung des Themas Umwelt kann es als gegeben erachtet werden, dass diese seitens der Gesellschaft als öffentliches Gut galt und daher bei deren Nutzung keine Rücksicht auf die Nachhaltigkeit genommen wurde.1 Durch das Charakteristikum eines öffentlichen Gutes, dass die Konsumenten nicht von der Nutzung ausgeschlossen werden können, muss jeder seinen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt beisteuern.2 Durch die Entwicklung der Wissensdisziplin „Umweltressourcenmanagement“ und immer ungewöhnlicheren Wetterkapriolen wird der Umwelt immer mehr Beachtung geschenkt. Die Menschheit ist mittlerweile hellhörig geworden, wenn es um ihre Zukunft und vielmehr um die Zukunft der nächsten Generationen geht. Aufgrund dieser wachsenden Feinfühligkeit liegt es an der öffentlichen Hand und an der Wirtschaft auf diesen Impuls einzugehen und nachhaltige Ideen für einen ökologischeren Umgang mit unserer Umwelt zu finden.
Durch die Globalisierung erscheint die Erde immer kleiner und Güter können von beinahe jedem Ort der Welt innerhalb kürzester Zeit geliefert werden. Hinter dieser Errungenschaft stecken komplexe logistische Abläufe, die zwangsweise zu einer Zunahme der bereits bestehenden externen Effekte geführt haben.3 Doch sind bereits aussagekräftige Ideen bzw. Umsetzungen gefunden worden, um diese Effekte verursachungsgerecht zu erfassen, oder vielmehr noch zu deren Vermeidung beizutragen?
1.2. Ziel der Arbeit und die daraus abgeleiteten Forschungsfragen
Durch Analyse bereits bestehender Modelle zur Internalisierung externer Kosten seitens der öffentlichen Hand und des betrieblichen Umweltcontrollings, soll eine umfassende Wissensgrundlage zu den bestehenden Ansätzen der Internalisierung externer Kosten im Logistikbereich geschaffen werden. Der rote Faden derArbeitwird durch die folgenden Forschungsfragen vorgegeben:
- Wie kann der Begriff der externen Effekte möglichst übersichtlich dargelegt werden und wo liegen Probleme bei der Internalisierung externer Effekte?
- Welche Ansätze verfolgt die öffentliche Hand um externe Effekte im Bereich der Logistik zu internalisieren und welche Probleme bestehen dabei?
- Wurde seitens des betrieblichen Umweltcontrollings dem Begriff der externen Effekte mit geeigneten Erfassungsmethoden nachgekommen?
1.3. Aufbau der Arbeit
Um eine gute Übersicht zu gewährleisten, werden im ersten Teil der Arbeit die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „externe Effekte“ abgegrenzt und deren volkswirtschaftliche Bedeutung erörtert. Zusätzlich erfolgt eine grundlegende Ausführung über die Möglichkeiten zur Internalisierung der externen Effekte und den damit verbundenen Komplikationen. In weiterer Folge wird näher auf die Verbindung zwischen externen Effekten und der Logistik eingegangen. Es folgt eine Stakeholder-Analyse, mit dem Ziel, alle beteiligten Interessensgruppen in die Diskussion mit einzubeziehen. Auf dieser aufbauend, werden wesentliche Zielkonflikte erörtert. Den nächsten Teil der Arbeit bildet die Analyse des Stakeholders öffentliche Hand. Durch seine umfangreichen Einflussmöglichkeiten stellt er ein interessantes Forschungsfeld dar. Es werden die einzelnen Entscheidungsebenen der öffentlichen Hand ausgeführt und Handlungswerkzeuge analysiert. Da ein alleiniges Bestreben seitens der öffentlichen Hand nicht ausreichend ist um die Ziele einer nachhaltigen Logistik zu erfüllen, wird im letzten Gliederungspunkt auf die Unternehmensebene, genauer gesagt, auf das betriebliche Umweltcontrolling eingegangen. Es werden aktuelle in Diskussion befindliche Methoden wie Total Quality Management und Ökobilanzen auf ihre Fähigkeit externe Kosten zu erfassen bzw. zu internalisieren überprüft. Um den Bezug zur Praxis zu wahren, wird in allen Kapiteln der Arbeit versucht, die Theorie mit praktischen Beispielen zu belegen. Nach Durcharbeiten dieser Arbeit sollte eine ausreichende Wissensbasis für eine weiterführende Diskussion des Themas der externen Kosten in der Logistik gegeben sein.
1.4. Methodologie
Die weitere Vorgehensweise um die eingangs angeführten Forschungsfragen zu beantworten beruht auf der Analyse von Sekundärdaten. Die Sekundärdaten werden aus Büchern, Journals und Internetressourcen gewonnen. Dies ermöglicht eine qualitative Beantwortung der Forschungsfragen. Es soll dabei keine Operationalisierung der verschiedenen erörterten Ansätze stattfinden. Durch die komplexen Zusammenhänge der verschiedenen Ansätze wäre eine Solche nicht objektiv durchführbar. Vielmehr ist es das Ziel des Forschungsdesigns, eine qualitative Aussage über den derzeitigen Stand der vorhandenen Ansätze zur Internalisierung externer Kosten in der Logistik zu geben und einen Ausblick zu gewähren.
2. Einführung in die Thematik der externen Effekte
2.1. Der Begriff der externen Effekte
Das Individuum ist tagtäglich mit externen Effekten konfrontiert. Es existieren grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Ausprägung. Zum Einen gibt es positive externe Effekte. Als Beispiel kann die Betrachtung der Blumen aus dem Nachbargarten genannt werden. Die Blumen haben keine Kosten für das Individuum verursacht, wirken jedoch nutzenstiftend (positive Gefühle bei der Betrachtung). Die zweite Möglichkeit sind negative externe Effekte. Das Wort „negativ“ impliziert in diesem Kontext eine Verschlechterung des Nutzens eines anderen Individuums. Negative externe Effekte existieren in den verschiedensten Ausprägungen, beginnend von Zigarettenrauch in Lokalen bis hin zu Abgasen bei Lastkraftwägen.4 5
Ein Charakteristikum externer Effekte ist, dass sie bei Nutzung von Ressourcen auftreten und nicht automatisch durch den Preismechanismus erfasst werden.6 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird alleinig auf die negative Ausprägung externer Effekte Bezug genommen. Werden sie identifiziert, quantifiziert und monetarisiert, liegen externe Kosten vor.7
2.1.1. Kategorisierung externer Effekte
Externe Effekte treten in verschiedenen Ausprägungen auf. Im Folgenden werden die Möglichkeiten kurz anschaulich kategorisiert.
- Technische externe Effekte: Der von Marktteilnehmer A erzeugte externe Effekt (z.B.: Lärmbelästigung) bedingt bei einem anderen Teilnehmer B eine technische Auswirkung. Individuum B muss durch die Externalität Lärmschutzfenster nachrüsten. Der externe Effekt hat daher einen direkten technischen Einfluss auf ein anderes Individuum. (Notwendigkeit zum Einbau von Lärmschutzfens- tern).8 9 Das wesentliche Problem technischer externer Effekte liegt am falschen Preismechanismus. Der Verursacher der Externalität zahlt einen zu geringen Beitrag für die Verursachung des Lärmes.10,11
- Psychologische externe Effekte: Diese Ausprägung externer Effekte ist eng verwandt mit den zuvor erörterten technischen externen Effekten. Wird bei technischen externen Effekten auf den direkten Einfluss (Wechsel der Fenster) abgezielt, ist bei psychologischen Effekten die Psyche des Menschen an sich der Ansatzpunkt. Selbst nach Auswechseln der Fenster ist es möglich, dass der Mensch bei Verlassen seines Hauses Angst um seine Gesundheit hat. Diese Angst wird als psychologischer externer Effekt bezeichnet.12
- Pekuniäre externe Effekte: Der wesentliche Unterschied zu den zuvor genannten Punkten ist das Funktionieren des Marktmechanismus. Das Wort „extern“ bedeutet in diesem Zusammenhang die Unbeeinflussbarkeit des Preismechanismus durch einen Dritten. Als Beispiel kann das Steigen der Rohstoffpreise bei Zunahme der Nachfrage genannt werden. Auch das Ausscheiden eines nicht zu effizienten Kosten produzierenden Unternehmens kann als pekuniärer Effekt kategorisiert werden.13 Es wird bei pekuniären Effekten, im Gegensatz zu den technischen Effekten- ein weitgehend funktionierender Preismechanismus unterstellt.14 15 In weiterer Folge werden die pekuniären externen Effekte vernachlässigt, da sie kein direktes Versagen des Marktes darstellen.16
Bei dem Auftreten technischer Effekte liegt entweder Markt- oder Staatsversagen vor. Auch das Zusammenspiel beider Versagen ist möglich. Die Unterscheidung zwischen Markt- und Staatsversagen ist aber zumeist nicht eindeutig durchführbar und mit Problernen behaftet. Um externe Effekte zu internalisieren, wird sowohl ein enges Zusammenspiel als auch der Einsatz beider Institutionen gefordert.17
Um die Internalisierung rechtfertigen zu können, müssen allerdings die Gesamtauswirkungen der negativen externen Effekte bekannt sein. Im folgenden Gliederungspunkt wird gezeigt, aus welchem Grund „nicht-internalisierte“ negative externe Effekte für die Gesamtwohlfahrt von Nachteil sind.18
2.1.2. Gesamtauswirkungen negativer externer Effekte
Durch die zuvor genannten technischen externen Effekte kann es zur exzessiven Nutzung eines Gutes kommen (z.B.: Luft). Dies hat allerdings negative Auswirkungen auf andere Marktteilnehmer. Diese exzessive Nutzung wirkt insgesamt wohlfahrtsmindernd. Um dies zu verhindern, müssen die externen Effekte in die Kostenbetrachtungen des Emittenten mit einbezogen werden.19 Zur übersichtlicheren Darstellung wird in Abbildung 1 die Sichtweise des Geschädigten näher abgebildet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Kosten externer Effekte20,21,22
Die Gerade DD stellt die Nachfrage der Konsumentinnen nach einem Gut x dar. Bei sinkendem Preis p steigt die Nachfrage. Die Gerade PKG stellt die privaten Grenzkosten dar. Dies sind die Grenzkosten des einzelnen Produzenten. Bei der Produktion fallen allerdings auch externe Kosten EK an. Die gesamten Grenzkosten der Produktion spiegeln die Sozialen Grenzkosten Gerade SGK wieder (PKG+EK). Bei „nichtinternalisierung“ der externen Kosten wird der Produzent sein Gut zum Niveau xo-po, was Punkt A entspricht, anbieten. Dies ist allerdings gesamtwirtschaftlich nicht optimal. Würden die externen Kosten internalisiert, würde das Güterangebot des Produzenten auf ein Niveau von xi-pi, was Punkt B entspricht, sinken.23,24
Welche Auswirkungen hätte diese Internalisierung auf die Gesamtwohlfahrt? Die Produktionskosten würden in Umfang von xoCBx1 steigen. Demgegenüber steht ein Nutzenentgang im Ausmaß von xoABx1. Saldiert man nun die gestiegenen Produktionskosten mit dem Nutzenentgang, erhält man die schraffierte Fläche im Umfang von ABC. Diese Fläche stellt den erzielten gesamten Wohlfahrtsgewinn bei der Internalisierung der externen Kosten dar.25,26 Es ist daher äußerst wichtig die gesamten Kosten in Form der sozialen Grenzkosten zu ermitteln. Um die dafür notwendigen externen Kosten zu erhalten, müssen allerdings die in Kapitel 2.3 erörterten Grundprobleme beachtet werden.
In allgemeiner Form kann daher folgende Formel für die gesamten Kosten (SGK) formuliert werden:27,28
Soziale Grenzkosten= Private Grenzkosten + Externe Kosten SGK= PGK + EK
Zur Internalisierung negativer externer Effekte liegen verschiedene Instrumente vor. Nachfolgend werden verschiedenen Internalisierungsmöglichkeiten näher analysiert.
2.2. Volkswirtschaftliche Ansätze zur Internalisierung externer Effekte
Die Internalisierung negativer externer Effekte ist zumeist mit einigen Hindernissen verbunden. Das größte Problem ist das Fehlen von klaren Besitzrechten. Saubere Luft kennt keinen Besitzer und auch keine Landesgrenzen. Die Benutzung ist daher jedem Individuum freigestellt, deshalb kann es zu einer Überbeanspruchung des öffentlichen Gutes „Luft“ kommen. Um diesem Effekt entgegenzuwirken müssen entweder klare Eigentumsrechte geschaffen werden, was bei vielen Gütern mit Problemen behaftet ist, oder das Bewusstsein der am Marktprozess teilnehmenden Individuen im Hinblick auf Nachhaltigkeit sensibilisiert werden.29
Werden klare Eigentumsrechte geschaffen, können die negativen externen Effekte durch die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelten Instrumente zur Erfassung der externen Kosten internalisiert werden. Findet diese Internalisierung statt, spiegelt der neu entstandene Preis der Benutzung des Gutes die tatsächlichen Kosten wider.30
Dies ist auch im Bezug auf die Nachfragefunktion von enormer Wichtigkeit. Unter Annahme einer marktüblichen Nachfrageelastizität sinkt bei steigenden Preisen die Attraktivität der Leistung bzw. des Produktes.31
Wie bereits eingangs erwähnt, wurde seitens der Volkswirtschaft sehr früh nach geeigneten Modellen zur Internalisierung externer Effekte gesucht. Nachfolgend werden die relevantesten volkswirtschaftlichen Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen analysiert. Alle angesprochenen Modelle haben gemeinsam, dass sie wesentliche Inputs zur weiterführenden Diskussion der nachhaltigen Logistik liefern.
2.2.1. Die Besteuerung nach Pigou
Die ursprüngliche Konzeption von Pigou war für die Internalisierung externer Effekte bei Verkehrsstaus gedacht. Wie sich jedoch im späteren Zeitverlauf herausstellte, kann das Modell auch für weitere Themenbereiche (z.B.: Tabaksteuer) angewendet werden. Kern der Theorie ist es, dem Verursacher der externen Effekte diese anzulasten und somit seinen Konsum bzw. die Nutzung des Gutes zu minimieren. Durch die Anlastung der externen Effekte steigen die gesamten Grenzkosten des Produktes, was eine Verschiebung der Kurve zu einem niedrigeren Nachfrageniveau zur Folge hat. Um die Effekte allerdings internalisieren zu können, müssen zuerst die externen Kosten erhoben werden (siehe Kapitel 2.3). Die Einhebung der Kosten obliegt der öffentlichen Hand, die folglich die Allokation der generierten Einnahmen frei wählen kann. Es ist daherwichtig hervorzuheben, dass keine Kompensation der Geschädigten beabsichtigt ist, sondern vielmehr eine Vermeidung des Konsums.32,33
Abbildung 2 veranschaulicht die von Pigou angedachte Wirkungsweise. Wird von dem optimalen Niveau A abgewichen und (wie in der Abbildung 2 ausgeführt) ein hoher Grad der Schadensbeseitigung (K,,) mit Niveau B angestrebt (z.B.: via Einhebung höherer Steuern auf Treibstoff), würden die Grenzkosten der Schadensbeseitigung im Umfang von BD auftreten. Dies würde zu einem Rückgang des Verkehrs im Niveau von CD führen. Die Grenzschadenswirkung (S,,) würde somit auf den Punkt C absinken.34
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Optimaler Schadensvermeidungsumfang35 36
Die wesentlichen Kritikpunkte der Theorie betreffen die zu hohe Aggregation und somit die praktische Umsetzungsfähigkeit. Pigou verwendet für sein Modell einen homogenen Verkehrsteilnehmer, der in der Realität nicht existiert. Betrachtet man nur die Interessen von Güterverkehr und Individualverkehr wird die Inhomogenität sichtbar. Weitere wesentliche Kritikpunkte sind die mangelnde Einbezugnahme der entstehenden Kosten für die Erfassung und Umsetzung der Kontrollsysteme und das Informationsdefizit über die Lage der Angebots- und Nachfragefunktion.37 Die Pigou'sche Steuerlösung ist vor allem als ein didaktisches Informationsinstrument und weniger als eine konkrete Handlungsanweisung anzusehen.38
2.2.2. Die Eigentumsrechte nach Coase
Der Ansatz von Pigou wurde zwar als Theorie anerkannt, doch zu praktischen Umsetzungen seitens der Politik ist es nur vergleichsweise selten, unter den oben ausgeführten Bedingungen, gekommen. Dessen war sich auch Coase bewusst und entwickelte ein neues Modell, in dem die verursachergerechte Zuordnung zu Gunsten des Handels zwischen den Akteuren aufgegeben wurde. Es sollte durch Schaffung von Eigentumsrechten ein Marktteilnehmer identifiziert werden, der die externen Kosten zu dem geringsten Preis vermeiden kann. Angenommen, durch Einführung einer Pigou Steuer wird der Schädiger seinen Konsum einschränken und hat dadurch einen Nutzenverlust von 3. Betrachtet man den Geschädigten, so kann es sein, dass die Einstellung lediglich einen Nutzengewinn von 2 für ihn bedeutet. Gesamtwirtschaftlich gesehen würde das einen Nutzenverlust bewirken. Laut der Theorie von Coase würde der Schädiger dem Geschädigten Zahlungen im Umfang von 2 zusagen und daher könnte er weiterhin auf einem für ihn wesentlich besseren Niveau wirtschaften. Der gewonnene Nutzen im Umfang von 1 stellt die bessere Allokation der Externalitäten dar und hebt somit das gesamte Nutzenniveau. Der wesentliche Vorteil ist der direkte Handel zwischen Geschädigtem und Schädiger, er führt folglich zu einem Gleichgewicht.39 40
Jedoch hat auch das Theorem von Coase Nachteile. Es muss eine eindeutige Schaffung von Eigentumsrechten gegeben sein. Dies führt zu einem Miteinbezug der öffentlichen Hand. Die dabei entstehenden Transaktionskosten, die bei der Schaffung und späteren Überwachung der Eigentumsrechte und dem Gewährleisten eines funktionierenden Marktes entstehen, sind zumeist nicht vernachlässigbar.41
2.2.3. Sonstige Ansätze
Der am weitesten verbreitete Ansatz zur Minimierung der externen Effekte, sind schlichte Auflagenlösungen. Der große Vorteil liegt in der leichten und schnellen Umsetzung. Als Beispiel eignet sich die Einführung der Sicherheitsgurtpflicht, die mit sehr simplen Mitteln umgesetzt werden konnte. Allerdings muss bei Einführung auch die Kontrolle der neuen Richtlinien in ausreichendem Maß gewährleistet sein, wie am Beispiel der Gurtpflicht durch die Polizei. Der größte Nachteil liegt in den verschiedenen Vermeidungskosten der Marktteilnehmer. Durch Einführung einer neuen Judikatur kann eine ungleiche Verteilung der Ressourcen der am Markt agierenden Unternehmen eintreten. Werden beispielsweise veraltete Lastkraftwägen verboten, trifft dies vermutlich einen regional tätigen Frächter schwerer als einen global agierenden Konzern.42 ·43
2.3. Von externen Effekten zu externen Kosten
Nachdem zu Beginn bereits der Begriff der externen Effekte näher definiert wurde, wird nun auf die Zuordnung eines Mengen- bzw. Kostengerüstes abgezielt. Ist den externen Effekten ein solches Gerüst zuordenbar, kann von externen Kosten gesprochen werden.44
Bei Internalisierungsversuchen muss trotz aller guten Absichten die Rationalität bewahrt bleiben. Es gilt den optimalen Schadensvermeidungsumfang zu definieren. Dieser Schadensvermeidungsumfang ergibt sich aus den Grenzkosten der Schadensbeseitigung (z.B.: Schadstoffreduktion) und der Grenzschadenswirkung (z.B.: Unbewohnbarkeit einzelner Regionen).45
Um dieses theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen, müssen die einzelnen Variablen mess- und bewertbar sein. Hierbei treten allerdings die nachfolgend erörterten Probleme auf.
2.3.1. Problem der Quantifizierung externer Kosten
Ein Hauptproblem der Quantifizierung externer Kosten ist die Analyse der Wirkungszusammenhänge. Das Zusammenspiel aus einzelnen Emittenten und verschiedenen Schadstoffen muss bestmöglich analysiert werden. Ein weiteres Problem stellt die Wirkung von Schadstoffen über die einzelnen Landesgrenzen hinaus dar. Es erfordert ein Zusammenspiel von öffentlicher Hand, Wirtschaft und Wissenschaft, um die Quantifizierung der externen Kosten voranzutreiben.46
Um eine Übersicht über die Problematik zu erhalten, wird nur ein Teilbereich der Logistik zur Erklärung herangezogen: Die externen Umweltkosten bei Transporten. Die wesentlich auftretenden Probleme bei Erfassung eines Mengengerüstes sind:
- Schätzung der gesamten zurückgelegten Transportkilometer
- Einschätzung der benötigten Treibstoffmengen
- Ständige Veränderung der Emissionsfaktoren: Änderungen der Technologie und des Modalsplits
- Faktoren, die sich einer Mengenerfassung entziehen: Beispielsweise ist die Wirkung von Verkehrsbauwerken nicht messbar
- Welche Menge an Emissionen ist schädlich47
Die Komplexität dieses Zusammenspiels verschiedenster Faktoren in der Transportwirtschaft ist enorm.48 Können die anhand der Transportwirtschaft beispielhaft gezeigten Probleme überwunden werden und ein für die Umwelt verträgliches Mengen- bzw. Grenzwertgerüst identifiziert werden, ist es notwendig, eine Bewertung der Mengengerüste vorzunehmen und somit die Kosten zu internalisieren. Die dabei entstehenden Komplikationen werden im nächsten Gliederungspunkt erörtert.
2.3.2. Problem der Monetarisierung externer Kosten
Bei der Bewertung in monetären Größen ist vor allem die Frage der Kostenanlastung zu diskutieren. Nach Quantifizierung der Mengenkomponente erfolgt die Multiplikation mit der Wertkomponente.49 Durch die bereits im vorigen Gliederungspunkt angesprochene Komplexität der Mengenbewertung kommt es auch bei der Monetarisierung zu Problemen. Es existieren mehrere Ansätze zur monetären Bewertung:
- Ansetzen von Marktpreisen: Die Bewertung erfolgt anhand der Berechnung der bisher entstandenen externen Kosten und der zukünftig noch entstehenden Kosten.50 Es werden zwei wesentliche Nachteile identifiziert. Einerseits wurde bisher nur ein Teil der Emittenten mit den Kosten belastet, andererseits ist die Bewertung sehr komplex und es gibt keine Garantie, ob die richtigen Kosten eruiert wurden.51
- Befragung der Zahlungs- und Entschädigungsbereitschaft: Bei Abfrage der Zahlungsbereitschaft wird das geschädigte Subjekt nach seiner Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes, verbessertes Umweltniveau befragt. Beim Ansatz der Entschädigungsbereitschaft wird die direkte Entschädigungsforderung des Geschädigten gegenüber dem Schädiger abgefragt.52 Die persönliche Komponente der Befragung bildet bei beiden Ansätzen den wesentlichen Nachteil. Es kann zu enormen Verfälschungen durch strategisches Verhalten und Informationsdefiziten kommen.53
- Schadkostenansatz: Dieser Ansatz geht von einer eindeutigen Zurechenbarkeit der entstehenden Schäden auf einen Emittenten aus. Da allerdings in den meisten Fällen eine komplexere kausale Beziehung vorliegt, stößt dieses Verfahren sehr bald an seine Grenzen.54,55 Als Beispiel kann das immer größer werdende Ozonloch, das viele Einflussfaktoren aufweist, genannt werden.
- Vermeidungskostenansatz: Als Grundlage werden die Kosten der Vermeidung der Externalität herangezogen, wie etwa der Einbau von Lärmschutzfenstern.56 Im Wesentlichen beruht dieses Prinzip auf der Vorgabe von Umweltstandards.57
Wie bereits in Kapitel 2.2.1. gezeigt, ist es bei der Vorgabe von Standards allerdings wichtig den optimalen Schadensvermeidungsumfang zu kennen, um den optimalen Grenzwert zu definieren.
Obwohl eine exakte monetäre Bewertung der externen Kosten zum jetzigen Zeitpunkt nur unter Unsicherheit getroffen werden kann, ist es von enormer Wichtigkeit diese umzusetzen. Der Faktor Umwelt wird erst mit der voranschreitenden Monetarisierung von den Wirtschaftsobjekten in ausreichender Form berücksichtigt.58
In den bisherigen Kapiteln wurde eine Wissensgrundlage über die externen Effekte geschaffen. Mit der abschließenden Monetarisierung wurden den Effekten Kosten zugewiesen. Dies ist für die weiterführende Analyse der externen Kosten der Logistik notwendig. In den folgenden Kapiteln soll mit dem nun definierten Kostenbegriff näher auf ökonomische Nachhaltigkeit in der Logistik eingegangen werden.
3. Nachhaltigkeit in der Logistik
Durch die rasant wachsende Globalisierung und somit komplexer werdenden Logistiksysteme, tritt in den letzten Jahren immer mehr die Notwendigkeit nachhaltige logistische Abläufe zu implementieren in den Vordergrund. Nachhaltige Logistik umfasst alle Bereiche eines Unternehmens, beginnend bei Produktdesign über den Zukauf der Artikel, die anschließend unter nachhaltigen Bedingungen verarbeitet werden sollen, bis hin zur Distribution zu den Endkonsumenten. Nach abgelaufener Nutzungsdauer zeigt sich sehr oft, ob in den zuvor angeführten Bereichen Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle einnahm. Denn nun muss das Produkt auf möglichst effiziente Weise wiederverwertet werden, um den in weiterer Folge definierten Nachhaltigkeitsaspekt zu erfüllen.59
3.1. Begriffsdefinitionen
Um über eine gemeinsame Wissensbasis zu verfügen, wird in den folgenden drei Gliederungspunkten zuerst der Begriff der Nachhaltigkeit näher definiert. Darauf folgt eine Erörterung des Begriffes Logistik. Beide Begriffe haben gemeinsam, dass sie aus mehreren sich nicht gegenseitig ausschließenden Dimensionen bestehen. Durch das Aufzeigen der verschiedenen Dimensionen soll die Komplexität des Zusammenspiels mehrerer Teilbereiche aufgezeigt werden. Abschließend wird die Wissensbasis kombiniert und der Begriff der nachhaltigen Logistik definiert.
3.1.1. Nachhaltigkeit und ihre Dimensionen
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird in dieser Arbeit zuerst weitläufig mithilfe der Brundtland Studie definiert. Die Kernaussage hierbei lautet: Wird nachhaltig gewirt- schaftet, führt der Einsatz der gegebenen Ressourcen zu keiner Beeinträchtigung zukünftiger Generationen. Die gegebenen Ressourcen umfassen nicht nur natürliche Vorräte wie z.B. Erdöl, sondern auch den derzeitigen Entwicklungsstand einer Gesellschaft. Die Studie wurde 1987 verfasst und spricht alle Teilnehmer, die am wirtschaftlichen Austausch teilnehmen, an. Durch die umfangreiche Definition, die in der Studie getroffen wurde, wird die enorme Breite des Begriffes Nachhaltigkeit sehr gut hervorgehoben.60,61
Von der Grundaussage der Brundtland Studie kann der Begriff der Nachhaltigkeit weiter differenziert werden. Es können drei Bereiche nachhaltigen Wirtschaftens definiert werden:62,63,64
- Ökologische Nachhaltigkeit: Der Begriff verweist auf die Erhaltung unserer gegebenen Umwelt und somit unserer Lebensgrundlage.65 Weiters deckt der Begriff auch den Bereich der ökologischen Effektivität ab. Dieser verweist auf ei- nen umweltverträglichen und effizienten Einsatz der gegebenen natürlichen Ressourcen.66
- Ökonomische Nachhaltigkeit: Der Umgang mit dem vorhandenen Kapital stellt den Kern der ökonomischen Nachhaltigkeit dar. Das vorhandene Kapital darf nur in eingeschränktem Umfang eingesetzt werden. Zukünftiger realer Konsum darf durch den aktuellen Kapitaleinsatz nicht eingeschränkt werden.67,68
- Soziale Nachhaltigkeit: Unter dem Begriff wird die Wahrung der Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Menschen verstanden. Desweiteren wird die Wahrung der Gesundheit und der Zugang zu Wissen als soziale Nachhaltigkeit definiert. Die Selbstachtung des Menschen sollte von eben diesen nie in Frage gestellt werden.69,70
Ausgehend von diesen Definitionen ist eine breite Basis für die weiterführende Diskussion von Nachhaltigkeit gelegt.
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang der oft verwendete Begriff der grünen Logistik. Wird von grüner Logistik gesprochen, werden nicht alle drei angeführten Teilbereiche der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Es erfolgt zumeist eine Konzentration auf die ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit. Da diese Betrachtungsweise für die weitere Diskussion zu kurz greift, wird der Begriff der „grünen Logistik“ in den weiteren Betrachtungen vernachlässigt.71
3.1.2. Logistik und ihre Dimensionen
Die Ursprünge der Logistik liegen im Militärbereich. Logistik wurde dort als Grundbegriff aller Tätigkeiten, die der Versorgung der Streitkräfte dienten, verwendet.
[...]
1 Vgl. Prammer (2009), S. 1 f.
2 Vgl. Wiese (2005), S.437f.
3 Vgl. Bretzke/Barkawi (2010), S. 9 ff.
4 Vgl. Varian (2007), S. 743
5 Vgl. Weinreich (2003), S. 158
6 Vgl. Günther (2008), S. 228 f.
7 Vgl. Weinreich (2003), S. 154
8 Vgl. Weinreich (2003), S. 158
9 Vgl. Schulz (2004), S. 65 ff.
10 Vgl. Einbock (2007), S: 33
11 Vgl. Donges/Freytag (2004), S. 160
12 Vgl. Weinreich (2003), S. 158 f.
13 Vgl. Donges/Freytag (2004), S. 160
14 Vgl. Weinreich (2003), S. 159
15 Vgl. Schulz (2004), S. 65 ff.
16 Vgl. Weinreich (2003), S. 159
17 Vgl. Weinreich (2003), S. 159
18 Vgl. Cezanne (2005), S. 220 ff.
19 Vgl. Cezanne (2005), S. 220 ff.
20 Cezanne (2005), S. 230
21 Vgl. Aberle (2009), S. 577
22 Vgl. Weinreich (2003), S. 162
23 Vgl. Cezanne (2005), S. 221 f.
24 Vgl. Lueg (2010), S.77 f.
25 Vgl. Cezanne (2005), S. 221 f.
26 Vgl. Lueg (2010), S.77 f.
27 Vgl. Cezanne (2005), S. 221 f.
28 Vgl. Lueg (2010), S.77 f.
29 Vgl. Stiglitz/Walsh (2010), S. 292
30 Vgl. Stiglitz/Walsh (2010), S. 293
31 Vgl. Gawel (2009), S. 55
32 Vgl. Puls (2009), S. 36 f.
33 Vgl. Wigger(2006), S. 62 ff.
34 Vgl. Aberle (2009), S. 578
35 Aberle (2009), S. 578
36 Vgl. Kummer (2006),S.241
37 Vgl. Puls (2009), S. 39 ff.
38 Aberle (2009), S. 580
39 Vgl. Puls (2009), S. 42 ff.
40 Vgl. Coase (I960), S. 1 ff., von Autor übersetzt
41 Vgl. Puls (2009), S. 44 f.
42 Vgl. Puls (2009), S. 45ff.
43 Vgl. Kummer (2006), S. 237 f.
44 Vgl. Weinreich (2003), S. 154
45 Vgl. Aberle (2009), S. 578
46 Vgl. Aberle (2009), S. 612 ff.
47 Vgl. Aberle (2009), S. 613 f.
48 Vgl. Kummer (2006), S. 234
49 Vgl. Prammer (2009), S. 148
50 Vgl. Prammer (2009), S. 148
51 Vgl. Aberle (2009), S. 617
52 Vgl. Aberle (2009), S. 615 f.
53 Vgl. Prammer (2009), S. 143
54 Vgl. Aberle (2009), S. 614
55 Vgl. Weinreich (2003), S. 165 ff.
56 Vgl. Aberle (2009), S. 614 f.
57 Vgl. Weinreich (2003), S. 170
58 Vgl. Prammer (2009), S. 150
59 Vgl. Winkler/Kaluza/Schemitsch (2006), S. 23 ff., von Autor übersetzt
60 Vgl. World Commission on Environment and Development (1987), http://www.un- documents.net , von Autor übersetzt
61 Vgl. Burschel/Losen/Wiendl (2004), S. 15
62 Vgl. Wildmann (2007), S. 113 f.
63 Vgl. Burschel/Losen/Wiendl (2004), S. 20 ff.
64 Vgl. Langer (2011), S. 22 ff.
65 Vgl. Burschel/Losen/Wiendl (2004), S. 23
66 Vgl. Langer (2011), S. 23 f.
67 Vgl. Burschel/Losen/Wiendl (2004), S. 23
68 Vgl. Hauff/Kleine (2009), S. 18 ff.
69 Vgl. Langer (2011), S. 25 ff.
70 Vgl. Hauff/Kleine (2009), S. 20 f.
71 Vgl. Bretzke/Barkawi (2010), S. 245
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Internalisierung externer Kosten?
Es ist der Versuch, negative Auswirkungen (wie Umweltverschmutzung), die nicht im Marktpreis enthalten sind, dem Verursacher zuzurechnen.
Welche volkswirtschaftlichen Ansätze werden zur Internalisierung genannt?
Die Arbeit diskutiert unter anderem die Besteuerung nach Pigou und die Zuweisung von Eigentumsrechten nach Coase.
Welche Rolle spielt die Logistik bei externen Effekten?
Komplexe logistische Abläufe durch die Globalisierung führen zu einer Zunahme externer Effekte wie Abgasen und Lärm, die oft nicht verursachungsgerecht erfasst werden.
Was sind die Aufgaben der öffentlichen Hand in diesem Bereich?
Die öffentliche Hand nutzt Instrumente wie die EU-Wegekostenrichtlinie oder das Emission Trading System, um ökologische Anreize zu setzen.
Wie kann das betriebliche Umweltcontrolling zur Lösung beitragen?
Methoden wie Ökobilanzen, Life Cycle Costing und Total Quality Management helfen Unternehmen, ihre externen Kosten zu erfassen und zu reduzieren.
- Citar trabajo
- M.A. Karl Maurer (Autor), 2011, Ansätze zur Internalisierung externer Kosten in der Logistik seitens der öffentlichen Hand und des betrieblichen Umweltcontrollings, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262484