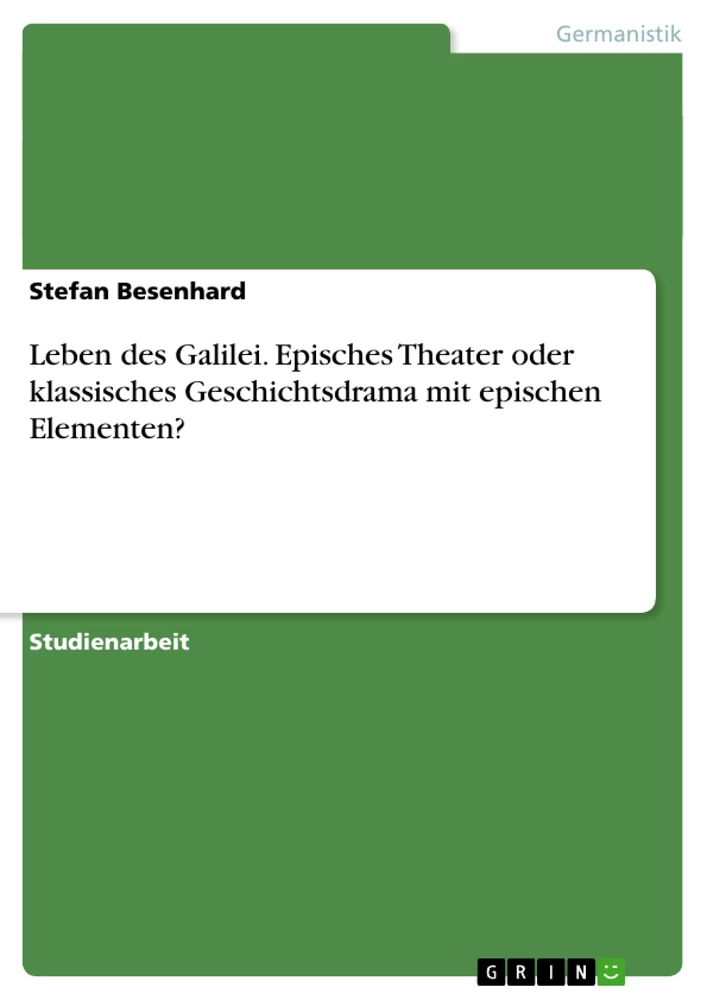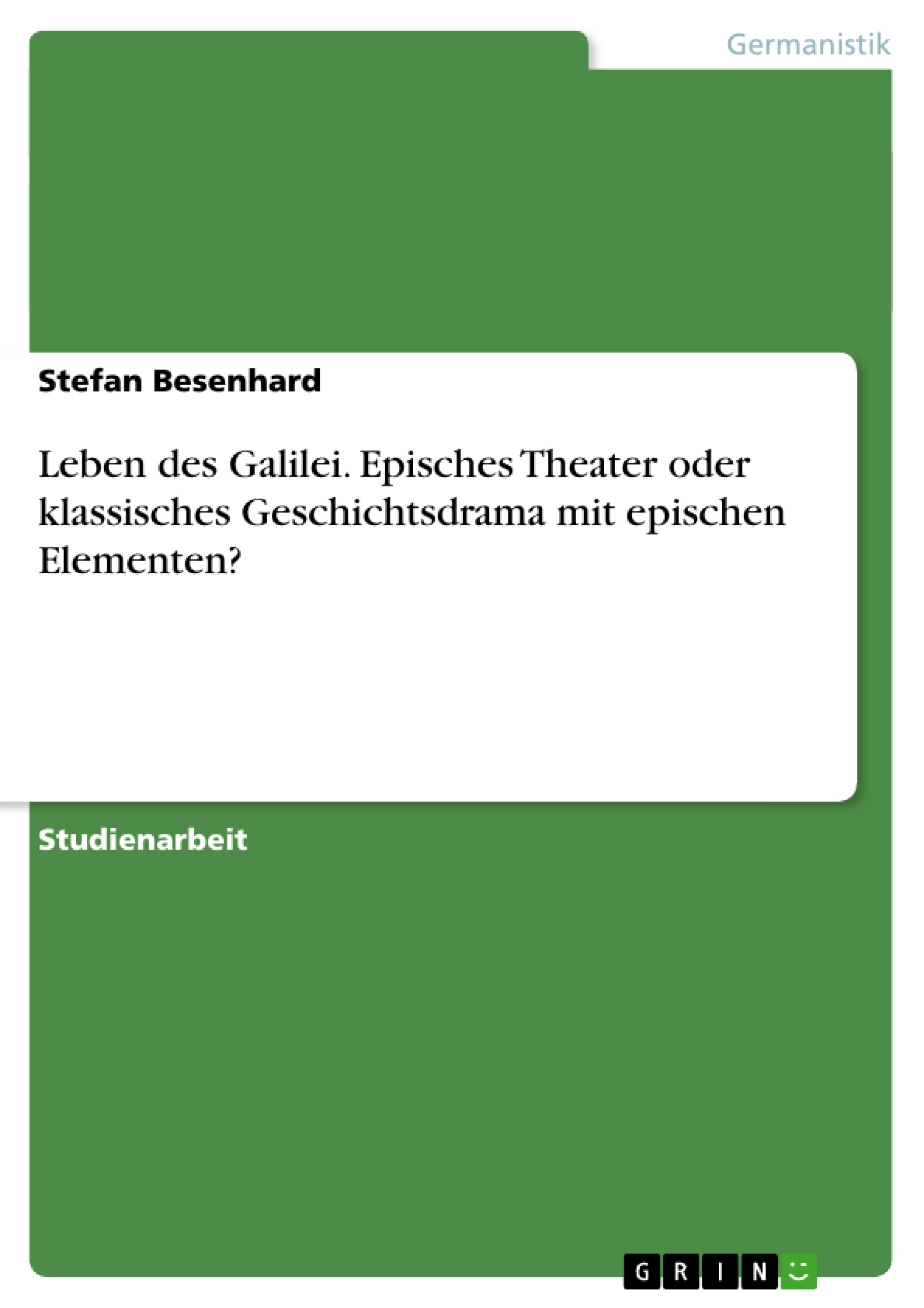Wer sich mit dem epischen Theater beschäftigt wird auch unweigerlich auf den Namen Bertolt Brechts treffen. Während in der Literatur oft ein absoluter Gegensatz zwischen klassischem und epischem Theater propagiert wird, fallen dem Rezipienten beim Lesen diverser epischer Stücke überraschend viele Elemente eines klassischen Dramas ins Auge. Wurde die epische Dramentheorie also in diesen Fällen nicht konsequent genug umgesetzt? Sind die klassischen Elemente in den Dramen auf das Unvermögen der Autoren zurückzuführen? Geht man davon aus, dass auch Brecht in seinen epischen Dramen klassische Merkmale mit eingebunden hat, so kann dieser provokative Vorwurf negiert werden, da man bei Brecht nicht von einem persönlichen Unvermögen beim Umsetzen seiner eigenen Dramentheorie ausgehen kann. Zwangsläufig stellt sich die Frage, warum man sich in manchen Punkten am klassischen Ideal orientiert hat. Um dies zu erreichen muss man die konsolidierte Vorstellung der absoluten Antonymie der epischen und klassischen Dramentheorie aufbrechen. Auch Bertolt Brecht selbst wollte seine Dramentheorie nur als „Akzentverschiebung“ im Theater verstanden wissen.
In diesem Zusammenhang wird sich die folgende Arbeit exemplarisch Brechts Leben des Galilei widmen. Zuallererst soll ein Einblick in die Dramentheorien der scheinbar oppositionellen Dramengattungen gewährt werden. Gemäß der Maxime vom Simplen zum Komplexen, vom Einfachen zum Speziellen soll daraufhin das Drama Leben des Galilei auf die ihm innewohnenden epischen, sowie klassischen Komponenten untersucht werden. Die Frage der Zuordnung in eine der beiden Richtungen soll dabei geklärt und der Grund für die Vermischung der Dramentheorien herausgearbeitet werden.
Gliederung:
1. Bertolt Brecht und das epische Theater
2. Einführung in das klassische und epische Theater
3. Epische Elemente und Ansätze in Leben des Galilei
3.1. Die Rolle des Bürgertums
3.2. Der Verfremdungseffekt als zentrales Element der epischen Dramatik
3.3. Neuartige Figurenkonzeption
4. Klassische Elemente in Leben des Galilei
5. Resümee
6. Literaturverzeichnis
1. Bertolt Brecht und das epische Theater
Wer sich mit dem epischen Theater beschäftigt wird auch unweigerlich auf den Namen Bertolt Brechts treffen. Während in der Literatur oft ein absoluter Gegensatz zwischen klassischem und epischem Theater propagiert wird, fallen dem Rezipienten beim Lesen diverser epischer Stücke überraschend viele Elemente eines klassischen Dramas ins Auge. Wurde die epische Dramentheorie also in diesen Fällen nicht konsequent genug umgesetzt? Sind die klassischen Elemente in den Dramen auf das Unvermögen der Autoren zurückzuführen? Geht man davon aus, dass auch Brecht in seinen epischen Dramen klassische Merkmale mit eingebunden hat, so kann dieser provokative Vorwurf negiert werden, da man bei Brecht nicht von einem persönlichen Unvermögen beim Umsetzen seiner eigenen Dramentheorie ausgehen kann. Zwangsläufig stellt sich die Frage, warum man sich in manchen Punkten am klassischen Ideal orientiert hat. Um dies zu erreichen muss man die konsolidierte Vorstellung der absoluten Antonymie der epischen und klassischen Dramentheorie aufbrechen. Auch Bertolt Brecht selbst wollte seine Dramentheorie nur als „Akzentverschiebung“[1] im Theater verstanden wissen.
In diesem Zusammenhang wird sich die folgende Arbeit exemplarisch Brechts Leben des Galilei widmen. Zuallererst soll ein Einblick in die Dramentheorien der scheinbar oppositionellen Dramengattungen gewährt werden. Gemäß der Maxime vom Simplen zum Komplexen, vom Einfachen zum Speziellen soll daraufhin das Drama Leben des Galilei auf die ihm innewohnenden epischen, sowie klassischen Komponenten untersucht werden. Die Frage der Zuordnung in eine der beiden Richtungen soll dabei geklärt und der Grund für die Vermischung der Dramentheorien herausgearbeitet werden. Im Folgenden wird sich ausschließlich auf die Fassung letzter Hand von 1955 bezogen.
2. Einführung in das klassische und das epische Theater
Als Grundlage zum Vergleich beider Dramentheorien soll uns das von Brecht selbst erstellte antithetische Schema dienen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 [2] [3]
Während im klassischen Theater „die großen Einzelnen“[4], also große Individuen als Figuren im Mittelpunkt des Geschehens standen, wollte Brecht mit dem epischen Theater humanere, menschlichere Protagonisten schaffen. Der Mensch ist in seinen Charakterzügen dadurch weniger eindimensional und von positiven, wie auch negativen Merkmalen geprägt und steht in diesem Zusammenhang dem klassischen Idealtypen einer Figur gegenüber. Daraus ergibt sich auch das Postulat, dass eben dieser „veränderliche und verändernde Mensch“[5] „Gegenstand der Untersuchung“[6] sein soll. Der Mensch soll als lebendiges Wesen mit ihm ganz eigenen Stärken und Schwächen und einem ihm eigenen Entwicklungsprozess verstanden werden. Nicht mehr Statik, sondern Dynamik beherrscht den handelnden Charakter und er zeichnet sich dadurch aus, in unterschiedlichen Konfliktsituationen widersprüchlich zu agieren. Der Charakter verlässt damit die starre Form der Klassik und ist eine fließende, sich verändernde Komponente über die Länge des Theaterstücks hinweg, bedingt durch äußere Vorgänge und Situationen, die zwangsläufig Entscheidungen erfordern.[7]
[...]
[1] Hecht, Werner: Brechts Weg zum epischen Theater. In: Episches Theater. Hrsg. von Rheinhold Grimm. Zweite Auflage. Stuttgart 1984. S.69.
[2] Müller, Joachim: Dramatisches, episches und dialektisches Theater. In: Episches Theater. Hrsg. von Rheinhold Grimm. Zweite Auflage. Stuttgart 1984. S.160/161.
[3] Bezogen wird sich hier auf Brechts erstes Schema. Auf die später veränderte und modifizierte Fassung wird im Folgenden noch kurz eingegangen.
[4] Koller, Gerold: Der mitspielende Zuschauer. Theorie und Praxis im Schaffen Brechts. Zürich/München 1979. S. 7.
[5] Müller, Joachim: Theater. S.160/161.
[6] Müller, Joachim: Theater. S. 160/161.
[7] Vgl. Koller, Gerold: Zuschauer. S. 11.
- Quote paper
- Stefan Besenhard (Author), 2009, Leben des Galilei. Episches Theater oder klassisches Geschichtsdrama mit epischen Elementen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262460