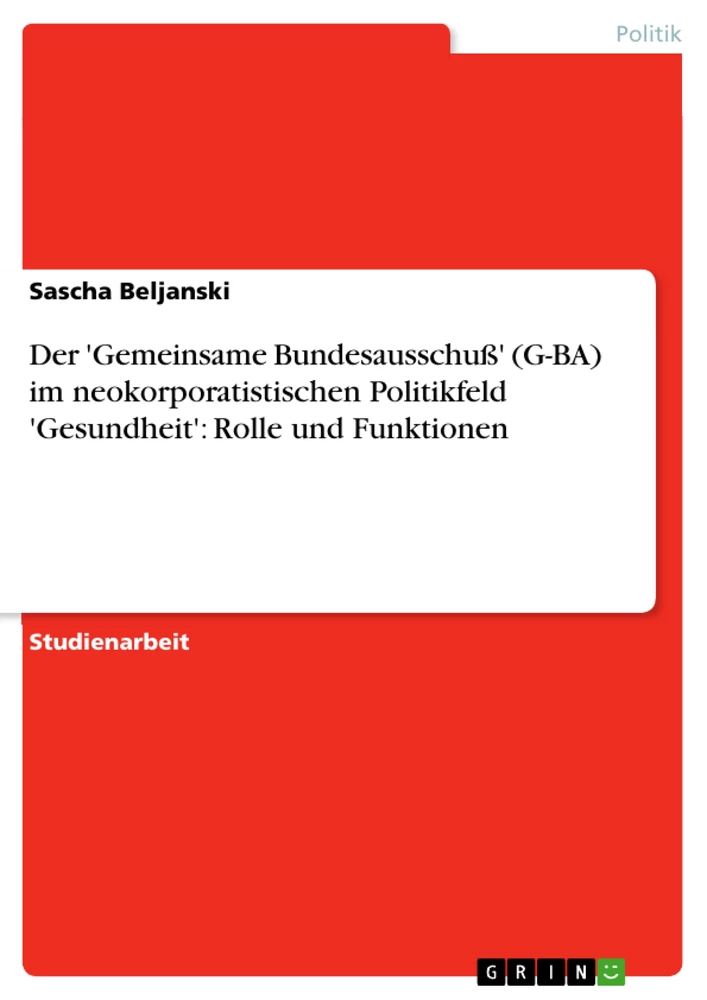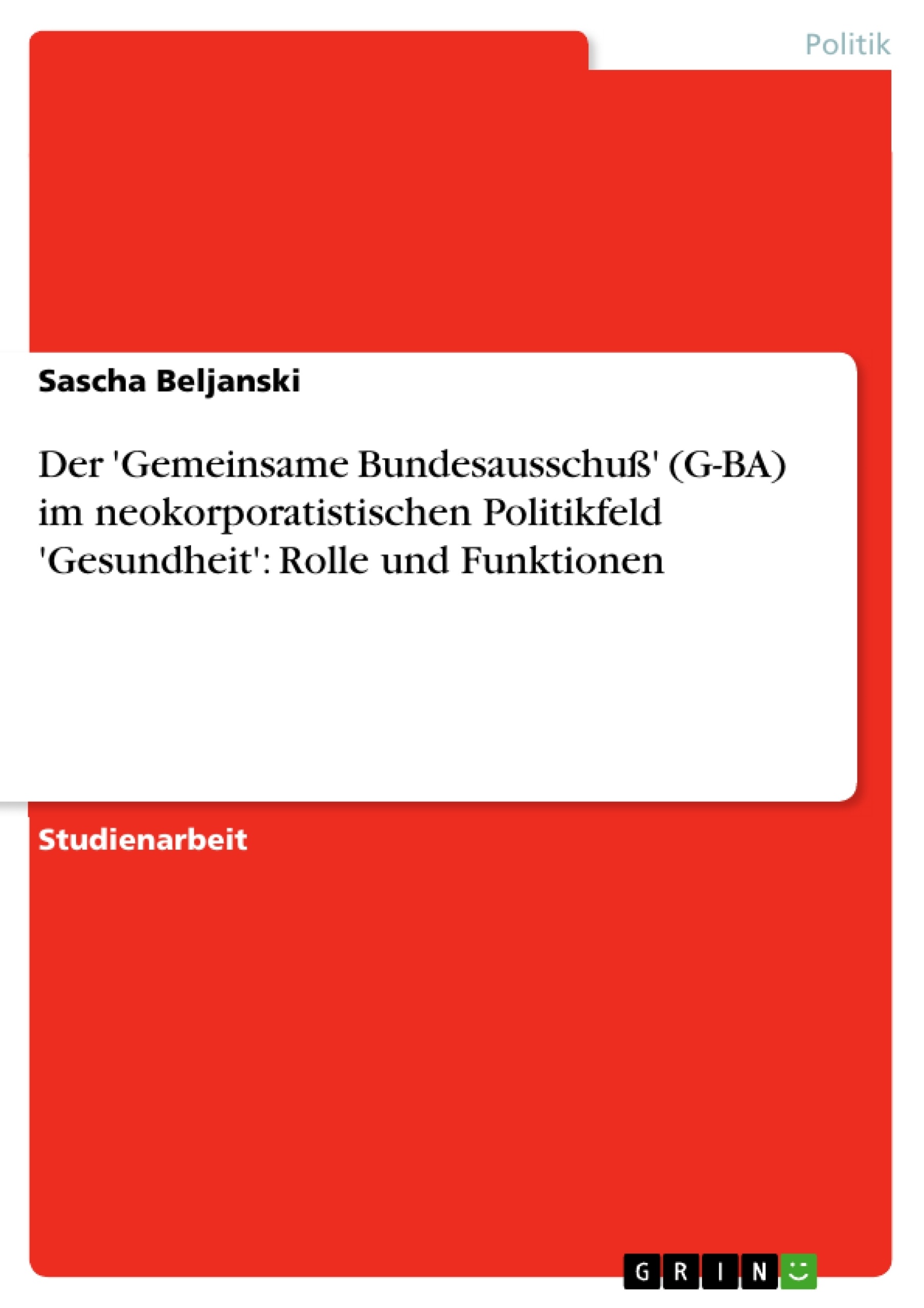Da das Gut Gesundheit von existentieller Bedeutung ist, hat die Gesundheitspolitik für nahezu jeden Bundesbürger einen hohen Stellenwert. Das Gesundheitswesen ist größtenteils ein solida-risches Versorgungssystem öffentlich-rechtlicher Provenienz (vgl. Huster 2012: 12f), welches paritätisch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beitragsfinanziert wird. Einkommens-starke gesellschaftliche Gruppierungen können unter bestimmten Voraussetzungen in die Priva-te Krankenversicherung (PKV) wechseln, jedoch sind nahezu neunzig Prozent der Bevölkerung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) pflichtversichert. Trotz des Finanzierungs-mischsystems, spiegelt die Gesundheitspolitik im besonderen Maße die soziale Frage und damit verbundene soziale Gerechtigkeit wider, zumal die Qualität der Gesundheitsleistungen nicht vom sozialen Status einer Person abhängig sein soll.
Das Politikfeld Gesundheit gilt als das klassische korporatistische Betätigungsfeld organisier-ter Interessen der Leistungserbringer: niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Pharmaindustrie. Dabei werden die Interessen der Ärzteschaft in doppelten Organisationsstrukturen, wie freien Verbände (z. B. Hartmannbund, Marburger Bund) und Körperschaften öffentlichen Rechts (KBV, die KVen), auf Grundlage der Selbstverwaltung vertreten. Die Krankenkassen und ihre Verbände, als Sachwalter der Beitragszahler, sitzen auf der gegenüberliegenden Seite des Ver-handlungstisches. Als bekanntestes Beispiel für korporatistische Arrangements im Gesund-heitssektor gilt die ‚Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen’ (KAiG); der damalige ‚Runde Tisch’ diente der Konsensbildung bei der Gesundheitsreform 2000 (Döhler 2002: 25). In der Folge wurde auf Grundlage des Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004 der ‚Gemeinsame Bundesausschuß’ (G-BA) als institutionelles Gremium zur Normsetzung durch Richtlinien konstituiert. In folgender wissenschaftlichen Ausarbeitung soll die Frage beantwortet werden, welche Rol-le der Gemeinsame Bundesausschuß (G-BA) bei der Interessendurchsetzung der korporatisti-schen Akteure im Politikfeld ‚Gesundheit’ spielt?
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1 Neokorporatismus und organisierte Interessen
1.1.Philippe C. Schmitters konstitutiver Ansatz im Neokorporatismus
1.2 Lehmbruchs prozessualer Ansatz im Neokorporatismus
1.3 Vorgehensweise
2 Genese des Korporatismus’ in der Gesundheitspolitik in Deutschland
2.1Normative Vorgaben im Neokorporatismus
2.2 Steuerungsperspektive und Modi der Interessendurchsetzung
2.3 Input- und Output-Legitimation
3 Neokorporatistische Akteure und Interessen im Politikfeld Gesundheit
3.1 Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) als staatlicher Akteur
3.2 Zusammensetzung des Gemeinsamen Bundesauschuß’ (G-BA)
3.3 Verbände der Leistungsanbieter auf Bundes- und Länderebene
3.3.1 Die KBV und die Landes-KVen der niedergelassenen Ärzte als Monopolverbände
nach Schmitter
3.3.2 Krankenhausträger und organisierte Interessen der Ärzteschaft
3.3.3 Die organisierten Interessen des Arzneimittelsektors.
3.4 Die Kassen und der GKV-Spitzenverband als Gegenmacht zu den Leistungsanbietern
3.5. Vertretung der Patienten und das fehlende Repräsentationsmonopol
4 Der Gemeinsame Bundesausschuß und die Steuerungsproblematik
4.1Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2004 als Koordinationsgesetz
4.2. Der G-BA als „Schatten der Hierarchie’?
4.3. ‚Bargaining’ ohne Blockademöglichkeit durch ‚einfache Mehrheit’?
4.4 Vom Tausch zum Wettbewerbskorporatismus
Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Quote paper
- B.A. Sascha Beljanski (Author), 2013, Der 'Gemeinsame Bundesausschuß' (G-BA) im neokorporatistischen Politikfeld 'Gesundheit': Rolle und Funktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262386