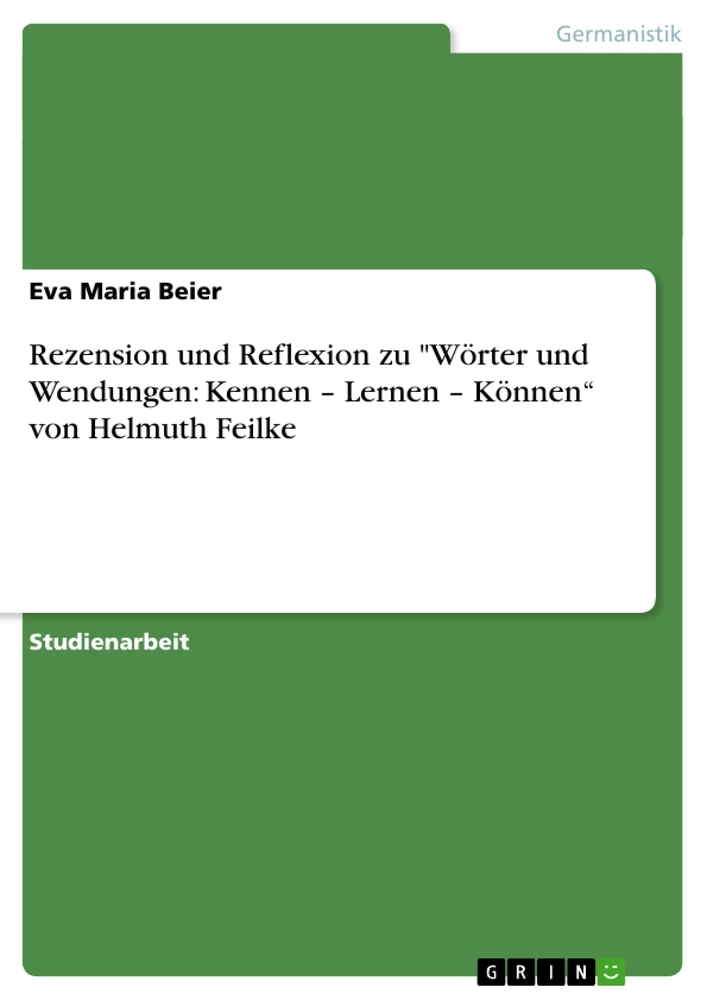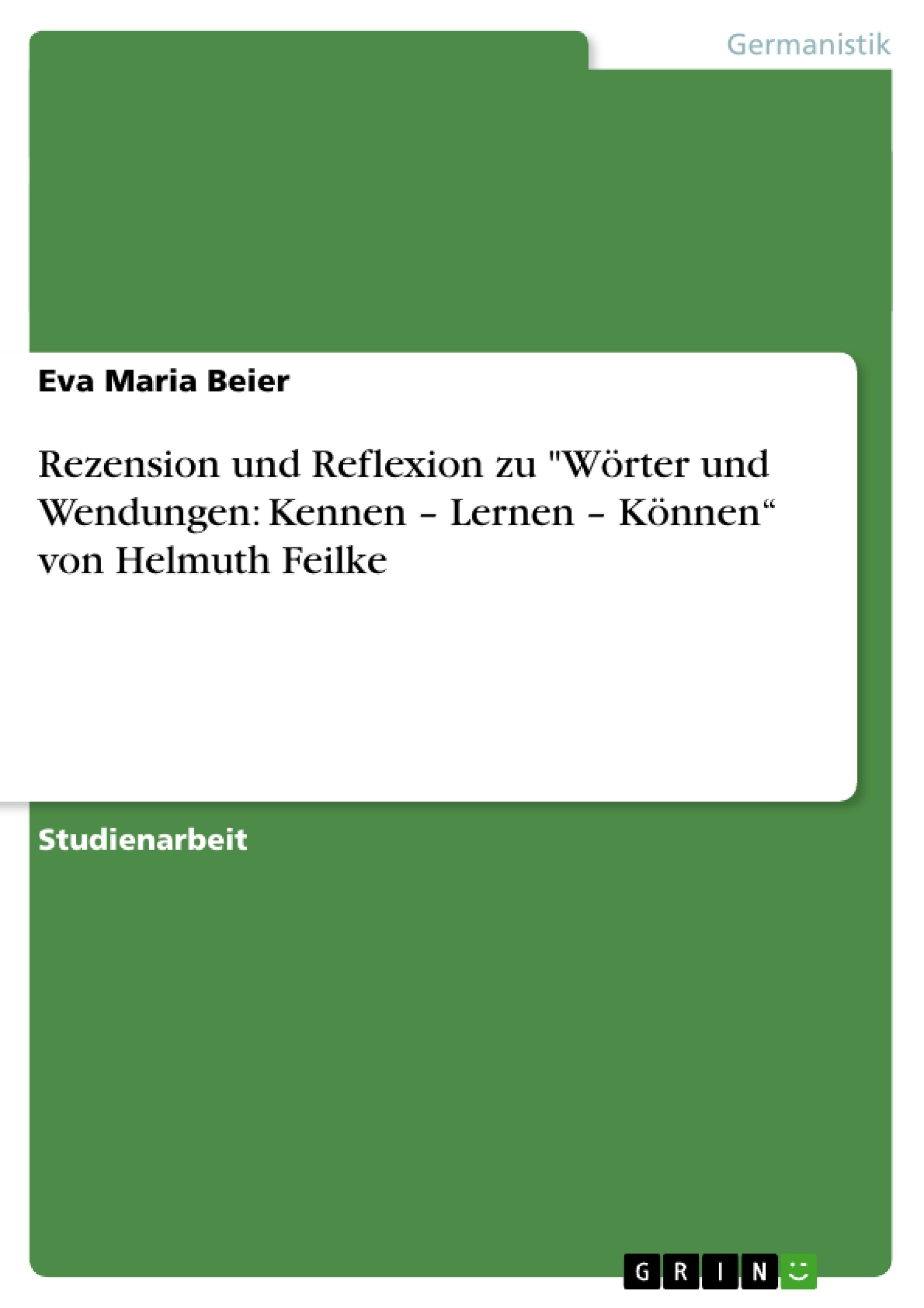„Gibt es ein Rezept für eine richtige Rezension?“ Diese Frage stellte eine Kommilitonin am Anfang des Schreibprozesses der Rezension. Doch scheint diese zunächst nicht überflüssig?
Einleitung, Hauptteil, Schluss und, wie der Name schon sagt, ein Teil der Rezension – so könnte eine voreilige Antwort auf die Frage sein. Doch steckt hinter der Frage nicht viel mehr? Schon bei kleineren Problemen wie zum Beispiel der Frage, welchen Modus man verwendet, scheiden sich die Meinungen. Weiterhin besteht die Frage, inwieweit der Autor der Rezension seine Meinung zum Originaltext äußern darf. Ist es erlaubt, mitten im Text zu rezensieren oder ist es besser, dies abschließend am Ende des Textes zu vollziehen? Schon diese Aspekte zeigen, dass die Frage keinesfalls so einfach zu vernachlässigen ist.
Je differenzierter und vielseitiger die Fragen und Probleme zu diesem Thema sind, desto enttäuschender ist auch die ernüchternde Antwort, dass es tatsächlich kein Patentrezept für eine Rezension gibt. Vielmehr gibt es Texte, die stilistisch mehr oder weniger gelungen sind. Natürlich gibt es Regeln, wie zum Beispiel die der grammatischen und semantischen Korrektheit oder die der Abgeschlossenheit. Andere Punkte hingegen sind oftmals, so laienhaft es sich anhören mag, Geschmacksache und fordern den Autor heraus, eine optimale Lösung zu finden.
Diese Antwort im Gedächtnis behaltend begann der Schreibprozess der Rezension zu dem Text „Wörter und Wendungen: Kennen – Lernen – Können“ von Helmuth Feilke. In mehreren Etappen wurden die Texte von Kommilitoninnen und Kommilitonen überarbeitet und besprochen. Schon bei diesen Diskussionen stellte sich heraus, dass es nicht die eine Rezension gab, sondern es vielmehr galt, seine eigene zu optimieren.
In dieser Seminararbeit werde ich meinen eigenen Schreibprozess reflektieren und kommentieren. Dabei stütze ich mich besonders auf die Veränderung meines Schreibprodukts durch das Feedback meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen und die Besprechung zur Rezension im Seminar. Des Weiteren präsentiere ich Aspekte, die mir bei der Arbeit am Text besonders interessant oder schwierig erschienen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Reflexion und Kommentar zum eigenen Schreibprozess
2.1 Rezension 1 => Rezension
2.2 Rezension 2 => Rezension
2.3 Rezension 3 => Rezension
3. Fazit
4. Rezension
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Gibt es ein Rezept für eine richtige Rezension?“
Diese Frage stellte eine Kommilitonin am Anfang des Schreibprozesses der Rezension. Doch scheint diese zunächst nicht überflüssig?
Einleitung, Hauptteil, Schluss und, wie der Name schon sagt, ein Teil der Rezension – so könnte eine voreilige Antwort auf die Frage sein. Doch steckt hinter der Frage nicht viel mehr? Schon bei kleineren Problemen wie zum Beispiel der Frage, welchen Modus man verwendet, scheiden sich die Meinungen. Weiterhin besteht die Frage, inwieweit der Autor der Rezension seine Meinung zum Originaltext äußern darf. Ist es erlaubt, mitten im Text zu rezensieren oder ist es besser, dies abschließend am Ende des Textes zu vollziehen? Schon diese Aspekte zeigen, dass die Frage keinesfalls so einfach zu vernachlässigen ist.
Je differenzierter und vielseitiger die Fragen und Probleme zu diesem Thema sind, desto enttäuschender ist auch die ernüchternde Antwort, dass es tatsächlich kein Patentrezept für eine Rezension gibt. Vielmehr gibt es Texte, die stilistisch mehr oder weniger gelungen sind. Natürlich gibt es Regeln, wie zum Beispiel die der grammatischen und semantischen Korrektheit oder die der Abgeschlossenheit. Andere Punkte hingegen sind oftmals, so laienhaft es sich anhören mag, Geschmacksache und fordern den Autor heraus, eine optimale Lösung zu finden.
Diese Antwort im Gedächtnis behaltend begann der Schreibprozess der Rezension zu dem Text „Wörter und Wendungen: Kennen – Lernen – Können“ von Helmuth Feilke. In mehreren Etappen wurden die Texte von Kommilitoninnen und Kommilitonen überarbeitet und besprochen. Schon bei diesen Diskussionen stellte sich heraus, dass es nicht die eine Rezension gab, sondern es vielmehr galt, seine eigene zu optimieren.
In dieser Seminararbeit werde ich meinen eigenen Schreibprozess reflektieren und kommentieren. Dabei stütze ich mich besonders auf die Veränderung meines Schreibprodukts durch das Feedback meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen und die Besprechung zur Rezension im Seminar. Des Weiteren präsentiere ich Aspekte, die mir bei der Arbeit am Text besonders interessant oder schwierig erschienen.
2. Reflexion und Kommentar zum eigenen Schreibprozess
2.1. Rezension 1 => Rezension 2
Der Schreibprozess der Rezension begann mit dem Verfassen einer Zusammenfassung des Textes „Wörter und Wendungen: Kennen – Lernen – Können“ von Helmuth Feilke.
Mit einer Einleitung versuchte ich, einen groben Überblick über den Text zu geben. Dann ging ich kapitelweise vor und arbeitete mich auf diese Weise durch den Text. Dabei habe ich beachtet, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und mich auf den Kern zu konzentrieren. Schon dabei entstanden Schwierigkeiten und die Frage kam auf, in welchem Modus diese Zusammenfassung zu schreiben sei. Ich orientierte mich bei meiner ersten Fassung am Konjunktiv.
Bei der ersten Besprechung im Seminar beschäftigte ich mich mit einem Kommilitonen kritisch mit dem Text. In meiner Überarbeitung konzentrierte ich mich vor allem darauf, Sätze zu kürzen, zu vereinfachen und umzustrukturieren. Dies bedeutete, dass ich aus einem langen, verschachtelten Satz zwei kürzere bildete. Damit wurden die Aussagen klarer und verständlicher. Außerdem versuchte ich beim zweiten Überarbeiten, komplexe Aspekte auf eine einfachere Ebene herunter zu brechen, was die Wichtigkeit einzelner Aussagen besonders hervorhob. Hinzu kam, dass ich meine Wortwahl überarbeitete und für den jeweiligen Kontext passendere Formulierungen fand. Zuletzt fielen mir bei genauerem Lesen ein paar wenige Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler auf.
2.2. Rezension 2 => Rezension 3
In einer zweiten Fremdbewertung erhielt ich ein schriftliches Feedback einer Kommilitonin. Besonders hilfreich war dabei, dass sie ebenso präzise wie kritisch meinen Text beurteilte. Die Kritikpunkte betrafen sowohl Stil als auch Form und Inhalt.
Zuerst optimierte ich meine Einleitung, indem ich den Autor gleich an erster Stelle erwähnte. Ich war noch nicht ganz davon überzeugt, wollte es aber erst einmal so stehen lassen. Außerdem versuchte ich in meinen Ausführungen exakter zu werden und schon in der Einleitung auf den Punkt zu kommen. So beschrieb ich nicht nur die Problematik und Bedeutung Feilkes Text, sondern gab schon eine Übersicht über seine Intentionen. Dadurch wird dem Leser schon in der Einleitung ersichtlich, worum es sich bei dem Text handelt und welches Ziel der Autor damit verfolgt. Weiterhin berichtigte ich einen Fehler in der Einleitung, der den Erscheinungszeitpunkt des Artikels betraf. Grund dafür war, dass der Artikel noch nicht erschienen war, ich ihn aber als bereits erschienen darstellte. Korrekterweise wies mich meine Kommilitonin darauf hin.
Was die Veränderung der Form meiner Zusammenfassung betrifft, achtete ich darauf, wann es wirklich sinnvoll war, Absätze einzubauen und wann es besser war, Absätze zu streichen. Dabei ging ich so vor, dass ich für jedes Kapitel einen kurzen Überblick gab, einen Absatz einfügte und dann die wichtigsten Punkte in einem Absatz zusammenfasste. In meiner zweiten Rezension hatte ich viel mehr Absätze, was beim Leser der Rezension wohl zu Unsicherheiten im Verständnis und Desorientierung im Textzusammenhang geführt hätte. Nun war eine klare Struktur ersichtlich.
Besonders hilfreich war es auch, dass ich meinen Text noch einmal inhaltlich Schritt für Schritt analysierte. Inhaltlich ist mir nämlich ein Fehler unterlaufen, der sich auf den Aspekt des Isolierens und Semantisierens bezog. Nach wiederholtem Lesen des Originaltextes, berichtigte ich meinen Fehler.
Auch in dieser Überarbeitungsphase fand ich bessere Formulierungen und Ausdrucksweisen, die das Lesen vereinfachten und das Verständnis verbesserten.
Anderen Kritikpunkten meiner Kommilitonin ging ich zwar nach, setzte aber nicht alle um, da mir vieles nicht ersichtlich war. So ging ich zum Beispiel nicht näher auf die Beschreibung des „mentalen Lexikons“ ein, was meiner Meinung auch verständlich genug beschrieben war. Außerdem bemerkte sie, dass ich das Wort „häufig“ vermehrt genutzt hätte. Dabei konnte ich ihr nicht zustimmen, da es im gesamten Text nur zweimal vorkam. Worüber sich meine Kommilitonin und ich auch nicht ganz sicher waren, waren die Literaturangaben in der Zusammenfassung. Genügt eine Seitenzahl oder wird eine Fußnote mit den vollständigen bibliographischen Angaben hinter das Zitat gesetzt? Ich wählte dabei die erste Variante und setzte nur die Seitenzahlen hinter die jeweiligen Zitate, da ja für den Leser offenkundig ist, dass die zitierte Stelle aus dem Originaltext stammt. Später informierte ich mich bei Frau Prof. Dr. Lehnen, die uns die korrekte Zitierweise, nämlich die amerikanische, angab. Somit änderte ich auch diesen Fehler.
[...]
- Quote paper
- Eva Maria Beier (Author), 2009, Rezension und Reflexion zu "Wörter und Wendungen: Kennen – Lernen – Können“ von Helmuth Feilke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262384