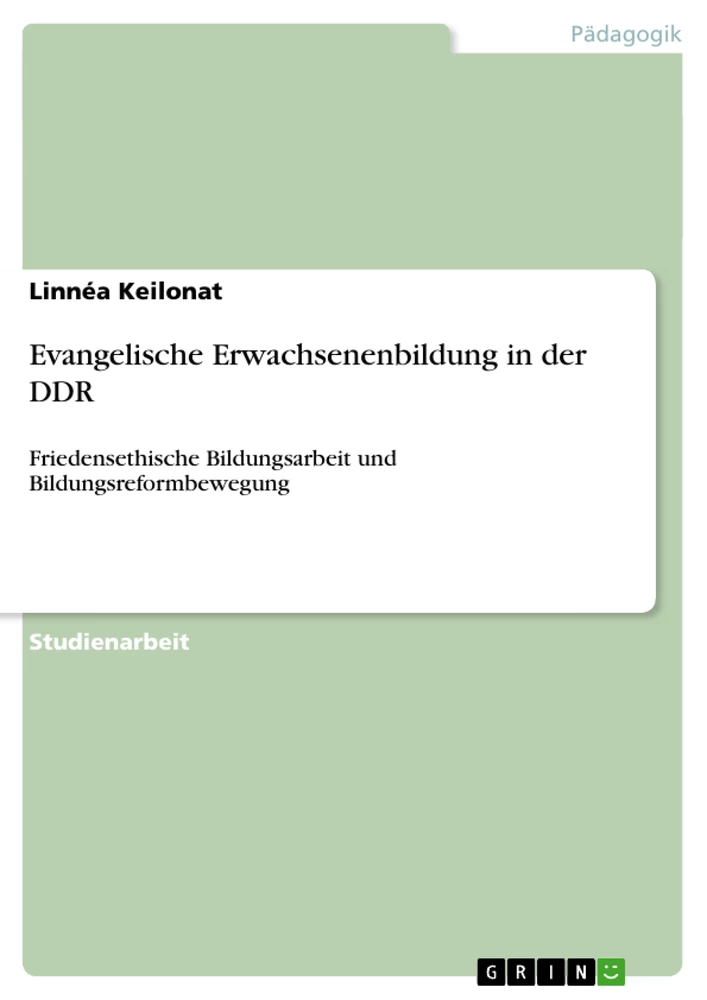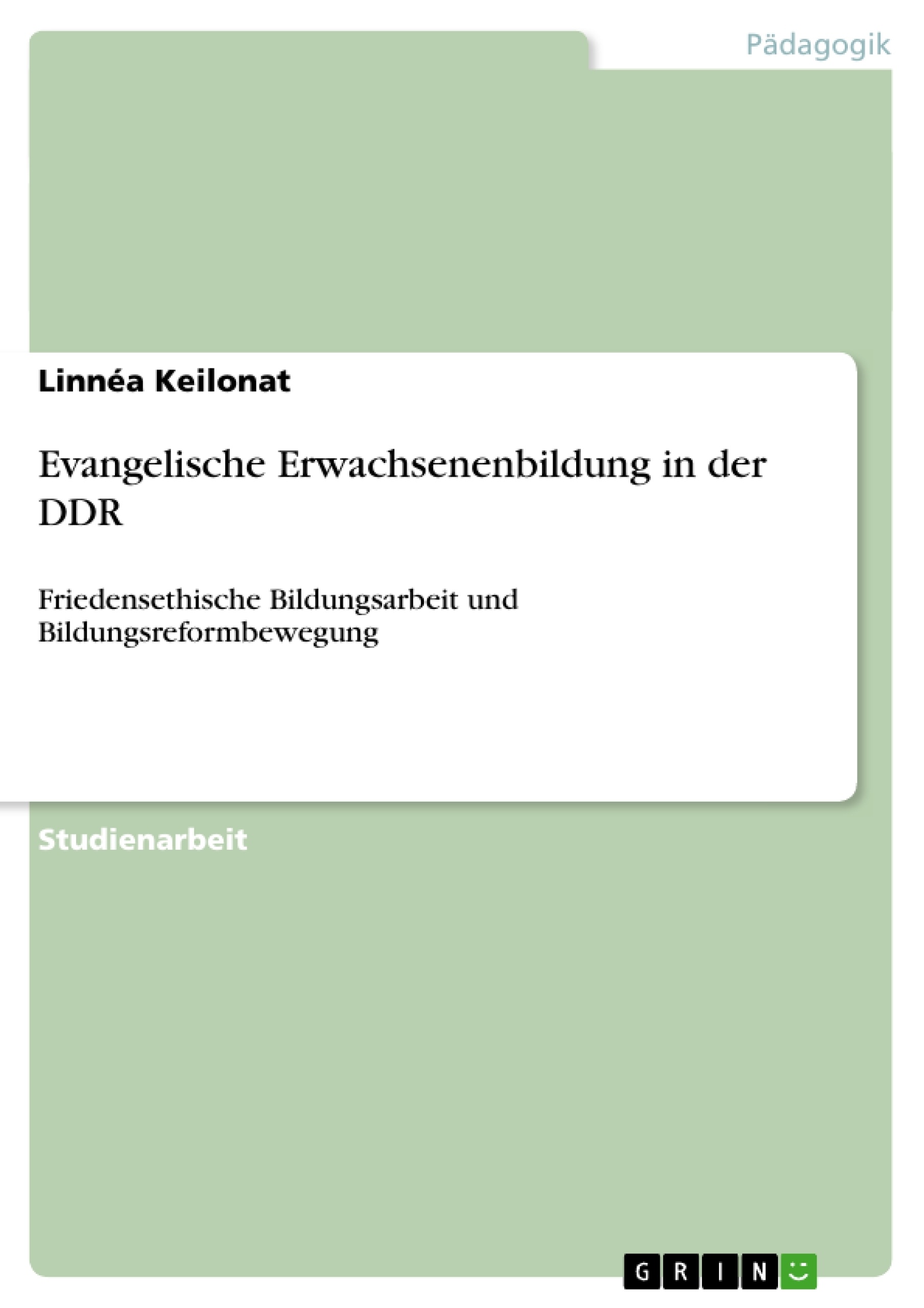Die Friedensbewegung in der DDR ist keine, von einer einzigen Organisation losgetretene oder geleitete Bewegung gewesen, sondern ein Geflecht aus verschiedensten Gruppen, die durch die gleiche Motivation angetrieben waren. Der Begriff „Friedensbewegung“ ist an sich schon von Außen zugeschrieben.
Nichts desto trotz spielte die evangelische Kirche in ihr eine entscheidenden Rolle. Angetrieben in den 70er Jahren durch die Einführung eines verpflichtenden Wehrdienstes, organisierten Angehörige der evangelischen Kirchen Seminare, Gruppen und Friedensdekaden, die eine breite Öffentlichkeit erreichte. Durch die zum gewissen Teil geschützten Räumlichkeiten der Kirche, ihre Organisationsstruktur, Vernetztheit und Erwachsenenbildungsmöglichkeiten, bot sie Möglichkeiten einer politischen Friedensarbeit für Anti-Kriegsbewegung, angesichts der drohenden Gefahr einer internationalen atomaren Wettrüstung.
„Es war die Staatsführung der DDR selbst, die 1978 in einem Grundsatzgespräch mit der Leitung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR durch die Gewährung größerer Spielräume für die Kirchen eine wichtige Voraussetzung für diese Entwicklung geschaffen hatte.“ (http://www.friedenskooperative.de/ff/ff01/4-61.htm. 29.03.2011). Dem repressiven DDR Staat und seinen Versuchen der Intriganz zum trotz, schaffte es die Friedensbewegung innerhalb der gebotenen Grenzen, bildungspolitisch aktiv zu bleiben und damit auch einen nicht unerheblichen Teil zum Umsturz des DDR-Regimes beizutragen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. XII Friedensethische Bildungsarbeit
2.1. Protestantische Friedensbildung
2.1.1. Friedensdekade
2.1.2. Friedensgruppen und Freidensseminare
2.1.3. Friedensgebete
2.1.4.Konspirativer Aspekt
2.2. Politische Bildungs- und Begegnungsarbeit der Aktion Sühnezeichen
2.2.1. Arbeitsweise
2.2.2.Theologisch andragogischer Ansatz
2.3. Staatsideologische Friedenserziehung der Christlichen Friedenskonferenz
3. IX Bildungsreformbewegung
3.1. Volksbildung als Tabuszene
3.1.1. Ein staatsideologischer Impuls zur Selbstorganisation
3.2. Kirchliche Bildungkritik
3.3. Kritische gruppen
3.3.1. Ökumenische Arbeitsgruppe in Erfurt
3.4. Bildungsreform als Wendemotiv
4. Fazit
5. Bibliographie
1. Einleitung
Die Friedensbewegung in der DDR ist keine, von einer einzigen Organisation losgetretene oder geleitete Bewegung gewesen, sondern ein Geflecht aus verschiedensten Gruppen, die durch die gleiche Motivation angetrieben waren. Der Begriff „Friedensbewegung“ ist ans ich schon von Außen zugeschrieben. (http://www.friedenspaedagogik.de/themen/vormilitaerische_erziehung_in_der_ddr/fri edensarbeit (29.03.2011)). Nichts desto trotz spielte die evangelische Kirche in ihr eine entscheidenden Rolle. Angetrieben in den 70er Jahren durch die Einführung eines verpflichtenden Wehrdienstes, organisierten Angehörige der evangelischen Kirchen Seminare, Gruppen und Friedensdekaden, die eine breite Öffentlichkeit erreichte. Durch die zum gewissen Teil geschützten Räumlichkeiten der Kirche, ihre Organisationsstruktur, Vernetztheit und Erwachsenenbildungsmöglichkeiten, bot sie Möglichkeiten einer politischen Friedensarbeit für Anti-Kriegsbewegung, angesichts der drohenden Gefahr einer internationalen atomaren Wettrüstung.
„Es war die Staatsführung der DDR selbst, die 1978 in einem Grundsatzgespräch mit der Leitung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR durch die Gewährung größerer Spielräume für die Kirchen eine wichtige Voraussetzung für diese Entwicklung geschaffen hatte.“ (http://www.friedenskooperative.de/ff/ff01/4-61.htm. 29.03.2011). Dem repressiven DDR Staat und seinen Versuchen der Intriganz zum trotz, schaffte es die Friedensbewegung innerhalb der gebotenen Grenzen, bildungspolitisch aktiv zu bleiben und damit auch einen nicht unerheblichen Teil zum Umsturz des DDR-Regimes beizutragen.
2. XII Friedensethische Bildungsarbeit
2.1. Protestantische Friedensbildung
Ab Mitte der 70er Jahre stellten Jugend- und Erwachsenenbildner in den protestantischen Kirchen „dem staatlichen, primär politisch ausgerichteten Erziehungskonzept alternative Friedenspädagogische Ansätze entgegen“, die zunächst nur der innerkirchlichen Jugend- und Friedensarbeit dienen sollten, aber letztendlich als Alternative zur offiziellen staatlichen Friedenspolitik und -erziehung, insbesondere zur Wehrerziehung, angelegt waren“. (Rothe 1999, S. 291). Die protestantische Kirche hatte, wie auch die katholische Kirche, keinen politisch wichtigen Einfluss in der DDR. Da Religion an sich eine untergeordnete Rolle spielte und höchstens Privatsache war, ist es schon beachtlich, wie groß ihr Einfluss inder Friedensbildung der DDR war. In Zeiten des kalten Krieges war sie es aber, die Verbindungen zur friedenspädagogischen Diskussion in der BRD hielt und sich um ständige Entwicklung des gesamtkirchlichen Studien- und Aktionsprogrammes zu einem „Rahmenkonzept Erziehung und Frieden“ einsetzte. Diese Entwicklung entzündete sich maßgeblich an der Einführung des obligatorischen Wehrunterrichts und der sogenannten freiwilligen Militärlagern in den neunten Klassen der allgemeinbildenden Schulen 1978. Besonderer Überlegenheitsfaktor der evangelischen Friedenserziehung und -elternbildung gegenüber der nach Vernichtungspotenzialen und Feindbildmechanismen laufenden Propaganda der staatlichen Erziehungseinrichtungen, war die Einbeziehung der individuellen Konfliktebenen der Beteiligten. Um der Militarisierung und seinen Folgen entgegenzuwirken, setzte sich eine Arbeitsgruppe aus Landeswarten (Jungmännervereinen), Landesjugendpfarrern, Konsistorien des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR und den evangelischen Freikirchen zusammen. Es wurde ein Leitfaden zur Seelsorgerischen Beratung in Fragen des Wehrdienstes und zur Frage der Führung eines Krieges mit atomaren Waffen entworfen.
2.1.1. Friedensdekade
Anfang der 80er Jahre wurden angesichts der atomaren Aufrüstung in Ost und West, Konferenzen der Studenten- und Jugendkonferenz in Budapest und eine Vollversammlung des ökumenischen Jugendrates in Europa (EYCE) in Oslo veranstaltet, an denen auch Mitglieder der evangelischen Kirche aus der DDR partizipierten. Die dort entwickelten Impulse Friedenswochen zu veranstalten, wurden aufgegriffen und bald wurden im gesamten Raum der DDR gemeinsame Friedenstage für die Jugendarbeit angeboten.. Da sie regen Zulauf auch von nicht Kirchenmitgliedern bekamen, initiierte und plante die evangelische Jugendarbeit bald jährliche Friedensdekaden. (vgl. Rothe 1999 S. 292). Die erste Friedensdekade fand 1980 unter dem Thema „Frieden schaffen ohne Waffen“ statt und trug das Symbol „ Schwerter zu Pflugscharen, dem Denkmal des sowjetischen Bildhauers Wutschetitsch die er in Anlehnung der Bibelsprüche Jesaja 2 und Micha 4 creiert hatte. Aufgestellt wurde dieses vor dem UNO Hauptgebäude in New York. Weitere Mottos waren 1981 „Gerechtigkeit Abrüstung Frieden“ und „Angst Vertrauen Frieden“ 1982. Als Antwort auf dieses Symbol wurden massive Maßnahmen dagegen im Schulischen Volkbildungsbereich ergriffen. Schüler mussten, das Symbol enthaltene Kleber und Aufnäher entfernen. Die Konferenz der Kirchenleitungen bestätigte indessen das Symbol als Kennzeichen für die kirchlichen Veranstaltungen in der Friedensdekade:
„Die Konferenz nimmt das Vorhaben der Landesjugendpfarrer zur Gestaltung des Bußtages 1980 zustimmend zur Kenntnis. Sie sieht darin den Ausdruck erklärten christlichen Friedensengagements und weist andere Interpretationen zurück“. (Tagung evang. Zentralarchiv in Berlin, EZA 101/3507, in: Rothe 1999 S. 293).
Damit fand der Gedanke einer christlich geprägten Gewaltlosigkeit, in einer friedlichen protestantischen Jugendbewegung Ausdruck. Die meisten Synoden und Gremien unterstützen die friedenspolitische Aktionsarbeit und Bildungsarbeit mit Orientierungstexten. Dadurch wurden Erfahrungen einer gesellschaftlichen Militarisierung über evangelische Sozialethik und internationale Friedensforschung reflektiert und auf der Höhe der theologischer, Friedensethischer und politischer Erkenntnisse verarbeitet. (Rothe 1999, S. 294). Die Kommission kirchlicher Jugendarbeit (KKJ) hatte eine Materialmappe mit inhaltlichen Impulsen ab der zweiten Friedensdekade in einem Arbeitskreis vorbereitet. Im Unterschied zu öffentlichen Medien veröffentlichten die innerkirchlichen Publikationen beispielsweise Fragestellungen und Ergebnisse ökumenischer Tagungen, der internationalen Friedensbewegung und der Friedensforschung. Auf diese Weise gelangten innerkirchliche Friedensbemühungen auch an die nicht-christliche Öffentlichkeit und erreichten durch ihre intellektuelle, wenngleich theologisch begründete Aufarbeitung, allgemeines Interesse. 1985 war die Friedensdekade bereits in der Hauptstadt der DDR kulturell und gesellschaftspolitisch etabliert, mit vielen Friedensgottesdiensten, Vorträgen, Seminaren und anderen Bildungsveranstaltungen, Kunst- und Kulturabenden sowie Friedensgebeten und Andachten. Insgesamt fanden zusätzlich tausende von Veranstaltungen politischer Bildung im Kontext des Themas „Erziehung und Frieden“ statt, die ebenfalls eine breite Teilnehmerschaft erreichten. (Rothe 1999, S.294) Der kirchlich verfasste Protestantismus war in der DDR sozialer Träger einer DDR-spezifischen Friedensbewegung, die sich schwerpunktmäßig als Bildungsarbeit und in kulturellen Formen manifestierte. Ähnlich wie Museen und Bibliotheken Besonders durch die Artikulation ihrer Oppositionshaltung gegenüber der zunehmenden Militarisierung der staatlichen und gesellschaftlichen Erziehungsverhältnisse in der DDR, hatte der Protestantismus an gesellschaftlichem Einfluss zurückgewonnen. Dies war möglich, da die Kirche die nötige Infrastruktur wie Räume, Zeiten, Bibliotheken, Gelegenheiten, Vervielfältigungstechnik, Moderatoren und Argumentationshilfen zur Verfügung stellte. Aufgrund ihrer Offenheit und intellektuellen Zugewandtheit, sowie eines individualistischen, nicht durch Ökonomische Faktoren bestimmtes Menschenbild, bot die Protestantische Kirche, Rahmenverhältnisse für eine „demokratische“ Friedensbewegung. (Rothe 1999, S. 295)
2.1.2.Friedensgruppen und Friedensseminare
Aus diesem Kontext heraus entstanden aktive Friedensgruppen. Aufgrund eines sie verbindenden gesellschaftlichen Problemdrucks, aufgrund der kurzfristigen Bewilligung von gewissen Handlungsspielräumen sowie Kontakten zu westlichen Bewegungen und Ideen als auch der strukturellen Anbindung an die Kirche war dies möglich geworden. Sie wandten sich mit zahlreichen Initiativen und Forderungen an die kirchliche- und allgemeine Öffentlichkeit, wie beispielsweise die Initiative für einen sozialen Friedensdienst 1981, die Initiative für persönliche Friedensverträge 1983 oder die Meinungsumfrage zum Kriegsspielzeug (die eigentlich verboten war). (Rothe 1999, S.296) Rückführend auf den II Weltkrieg, indem Religiosität bzw. Zugehörige einer Religion/Volksgruppe verfolgt wurde, wagte sich die Regierung nicht, zu harte Sanktionen über die Kirche zu verhängen. Das wiederum führte zur Erweiterung der Friedenspolitischen Bildung der Kirche und ihrer gesellschaftspolitischen Wirkung. Eine fortbestehende, über viele Jahre dauernde, Bildungstradition von Friedensseminaren entwickelte sich aus persönlichen Initiativen ehemaliger Bausoldaten - der Angehörigen der Baueinheiten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR und Ortspfarrern. 1987 wagte das Friedensseminar einen offenen Brief an den DDR Staatsvorsitzenden Erich Honecker zu schreiben, in dem der „Mangel an Offenheit des Denkens“ in der DDR -Gesellschaft beklagt wurde und der zudem eine ständige öffentliche Volksausprache mit uneingeschränkter Wahrheitsfindung forderte. (Ev. Landesiugendkonvent der Kirchenprovinz Sachsen, Brief an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, Magdeburg 1988, Abschrift Privatarchiv, Rothe 1999, S.122). Die Kirchliche Friedensbewegung erfolgte somit über die Form Politischer (Oppositions-) Bildung.
[...]
- Quote paper
- Linnéa Keilonat (Author), 2011, Evangelische Erwachsenenbildung in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262234