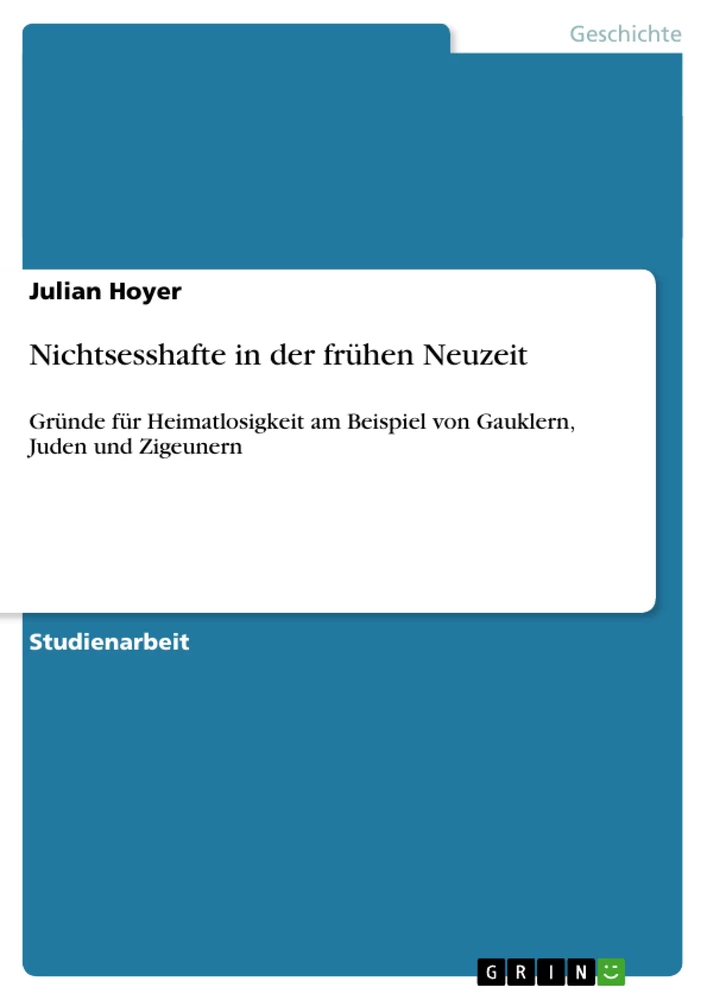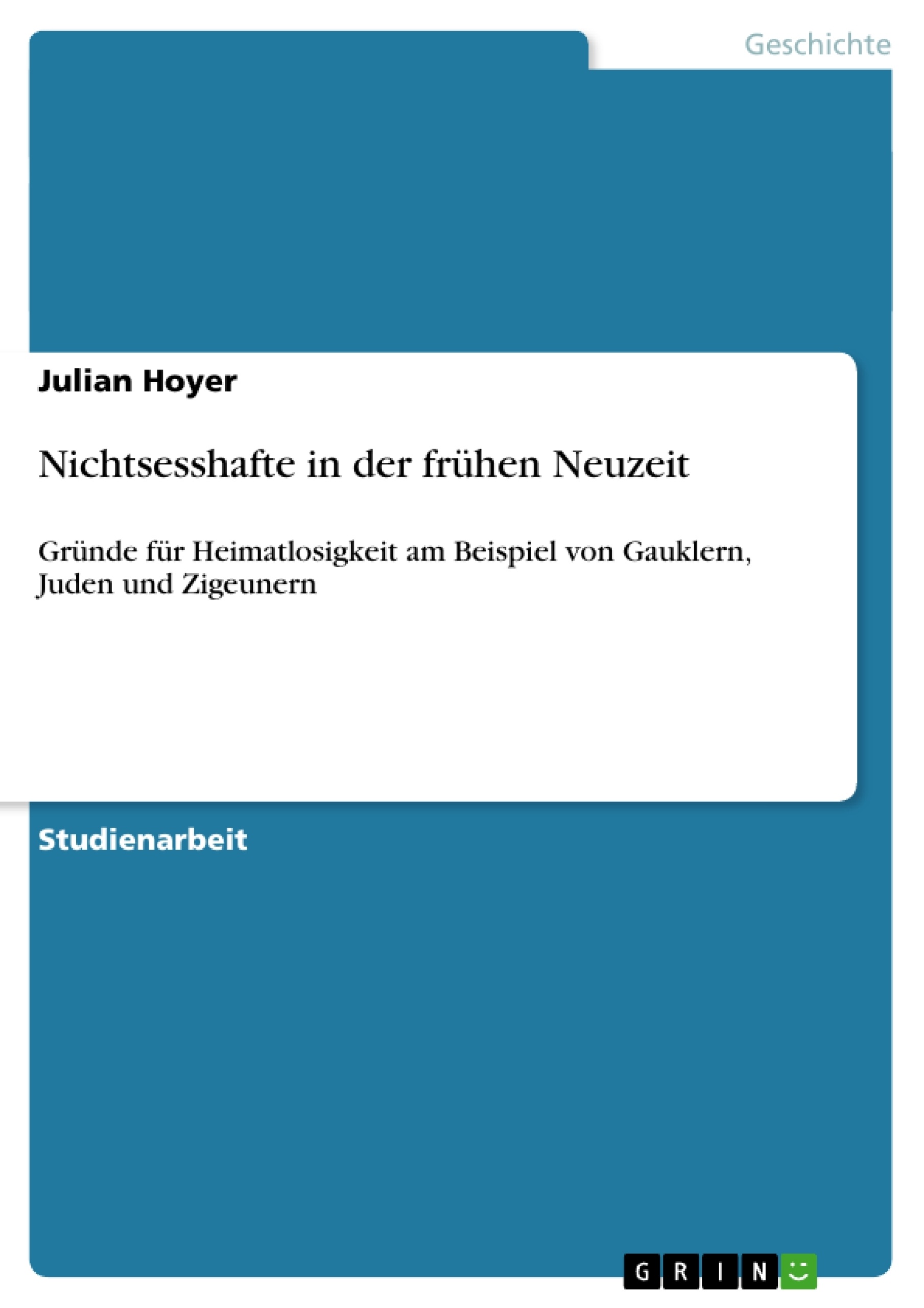Diese Arbeit betrachtet die Grüne für Nichtsesshaftigkeit in der frühen Neuzeit an Hand von verschiedenen Fallbeispielen von Gauklern, Juden und Zigeunern. Sie bahndelt zudem eine einleitende Differnzierung des Begriffs 'Randgruppe'. Nachdem allgemeine Gründe für Nichtsesshaftigkeit und soziale Einteilungen erläutert werden, wird auf die drei zentralen Randgruppen der frühen Neuzeit eingegangen. Ein anschließendes Fazit fasst die wichtigsten Punkte noch einmal auf und bringt sie in Zusammenhänge.
1. Einleitung und Intension
„Pfaffen, ritter unt gebure sint all gesippe von nature unt syln gar brüderlich leben.“[1]
Dieser von Hugo von Trimberg um 1300 geschriebene Satz zeugt von einer bestimmten Gesellschaftsordnung (beten, kämpfen, arbeiten), in der alle Gruppen, die hier nicht zugeordnet werden könnten, ausgegrenzt wurden. Schon immer wurden Menschen durch Verachtung, Ausgrenzung, Entrechtung oder Verfolgung und Vernichtung an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Besonders in der hierarchisch gegliederten Ständegesellschaft des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit ist das Phänomen der ‚Marginalisierung‘ (Ausgrenzung), ‚Diskriminierung‘ (Unterdrückung) und ‚Stigmatisierung‘ (Kenntlichmachung) durch das Volk zu beobachten. Während in der historischen Forschung der Adel und das Bürgertum dieser Zeit sehr gut erfasst sind, klafft eine große ‚Informationslücke‘ im Themengebiet der Randgruppenforschung. Nachdem in Frankreich und Großbritannien schon seit den achtziger Jahren ‚Außenseiter‘ und ‚Randgruppen‘ erforscht werden, wurden diese in Deutschland erst im letzten Jahrzehnt immer interessanter. Sie wandelten sich von einer ‚Randerscheinung der Forschung‘ zu einem neuen, besonderen Forschungsgebiet.
Mit dieser Arbeit im Rahmen des Seminars „Hexen, Juden, Henker. Außenseiter und Randgruppen der frühneuzeitlichen Gesellschaft“ wird im Allgemeinen die Situation des fahrenden Volkes in der frühen Neuzeit veranschaulicht und im Besonderen die Gründe für ein ‚Randgruppendasein‘, insbesondere von ‚Nichtsesshaften‘ dargestellt. Beginnend mit einer Differenzierung der Begrifflichkeiten und anderen ‚Randgruppen‘, werden die allgemeine soziale Situation im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, sowie allgemeine Gründe für Nichtsesshaftigkeit dargestellt. In den darauffolgenden Kapiteln werden die Fallbeispiele Gaukler, Nichtsesshafte Juden und Zigeuner behandelt. Hier werden unterschiedliche, auf die verschiedenen Beispiele zutreffende Blickpunkte eröffnet und ermöglicht. Abschließend wird diese Arbeit eine Zusammenfassung der oben genannten Punkte und ein Fazit enthalten.
2. Begriffserklärung und Differenzierung
Betrachtet man das Thema ‚Randgruppen und Außenseiter‘ in der historischen Forschung, ist eine klare Differenzierung der Begriffe unabdingbar. Da, wie oben genannt, Randgruppenforschung in Deutschland erst seit ‚kurzer Zeit‘ betrieben wird, sind Begrifflichkeiten wie ‚Randgruppe‘ oder ‚Unterschicht‘ eher moderner Terminologie zuzuordnen, mit der man versucht, die damalige gesellschaftliche Situation zu erklären und beschreiben. Versucht man ein passendes Vokabular aus der frühen Neuzeit zu finden, treten die ersten Probleme auf: während Begriffe wie „armer Mann“ oder „gemeiner Mann“ im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit zu allgemein waren, wurde „Povel“ beziehungsweise „Pöbel“ eher in moralisch abwertendem Zusammenhang gebraucht. Laut von Hippel kann zu damaliger Zeit auch nicht die Rede von ‚Unterschichten‘ sein, da die Gesellschaft zu der Zeit stark lokal, sozial, rechtlich und mental segmentiert war. Ein weiteres Problem bei der Differenzierung und Begriffserklärung in diesem Gebiet tritt bei der Trennung bestimmter Begriffe auf. Von Hippel sieht hier die Benennung von ‚Armut‘, ‚Unterschichten‘ und ‚Randgruppen‘ als schwierig an, da diese in engem Zusammenhang liegen. Er sieht die Übergänge der drei Größen als fließend und vermischt, da Unterschichten und Randgruppen meist von Armut betroffen waren, während Randgruppen die niedersten Stufen der Unterschichten bildeten. Allgemein können die Unterschichten in mehrere Stufen aufgespalten werden. Neben kleinen Handwerkern in Stadt und Land können auch Handwerksgesellen, die sogenannte ‚nachrückende Generation des ehrbaren Handwerks‘ im breiten Übergangsfeld von der Mittelschicht zur Unterschicht angesiedelt werden. Zu den Unterschichten zählt man das ‚gewöhnliche Gesinde‘, welches sich aus Hilfsarbeitern oder Tagelöhnern, gemeinem Militär beziehungsweise Landsknechten und Söldnern zusammensetzt. Auch Witwen, Waisen, alleinstehende Frauen, Invaliden, körperlich und geistig Behinderte bildeten diese Gesellschaft, die von Hippel die „sozial einigermaßen integrierte ‚würdige‘ Armut“ nennt[2]. Allerdings sind die Gruppen der ‚Unterschicht‘ zahlenmäßig sehr groß und auch relativ schwer statistisch differenzierbar, da oft keine klaren Grenzen zwischen den einzelnen Minoritäten gezogen werden können. Auch bei den Begriffen ‚Außenseiter‘ und ‚Randgruppen‘ überschneiden sich die Meinungen. So definiert von Hippel
„Randgruppen als Minderheiten, die infolge abweichenden Verhaltens von der Mehrheit nicht als gleichwertig anerkannt und gezielt ausgegrenzt werden“[3].
Wolfgang Hartung hingegen sieht ‚Außenseiter‘ als Menschen, die gewollt und/oder ungewollt von den sozialen Normen abwichen[4], was allerdings eine eher ältere Ansicht ist. Man sieht, dass auch zwischen den beiden Definitionen zweier Begriffe durchaus Parallelen gezogen werden können. Allerdings entstehen bei der Trennung innerhalb der Randgruppen wiederum größere Unterschiede. Während laut von Hippel Randgruppen und Unterschichten keinesfalls homogene soziale Einheiten waren, sondern eine bunte Vielfalt des Randgruppendaseins hervorbrachten, teilt Hergemöller ‚Randgruppen‘ in vier Hauptgruppen:
- Die ‚Unehrlichen‘: Scharfrichter, Schinder, Totengräber, Schäfer und auch Spielleute.
- Körperlich Andersartige, die durch äußere, körperliche und/oder geistige Auffälligkeiten ausgeschlossen wurden.
- Ethisch-religiöse Gruppen, wie Nicht-Christen und „Heiden“, wobei hier Juden und auch Zigeuner als beste Beispiele gelten.
- Die Dämonisierten, die nach dem mittelalterlichen Weltbild des „ Mysterium Salutis“, dem Kampf zwischen himmlischen und satanischen Mächten, in direktem Kontakt mit dem Teufel standen. Hierzu gehören vor Allem Hexen, Ketzer und Sodomiter.[5]
Diese Einteilung sieht Hergemöller allerdings selbst als gewagt an, da im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit eine unüberschaubare Menge an Menschen in dieser Schicht existierte, die ohne eine klare Linie, wie Hergemöller sie zieht kaum zu erforschen wäre[6]. Er sieht in seinem Buch „Randgruppen der Spätmittelalterlichen Gesellschaft“ neben der Trennung von mobilen und immobilen Randgruppen auch eine Unterscheidung zwischen ‚Randgruppen‘ und ‚Minderheiten‘ als notwendig, da zwar alle ‚Randgruppen‘ ‚Minderheiten‘ waren, allerdings nicht alle ‚Minderheiten‘ ‚Randgruppen‘. Hierbei bezieht er die Definition von Dietrich Kurze mit ein, dass der Begriff ‚Minderheit‘ einerseits einen statistischen Wert, andererseits allerdings eine Kleingruppe, die besonderen Schutz genießen muss, beschreibt. Zudem sind ‚Minderheiten‘ diejenigen Gruppen, die von einer Mehrheit oder deren Repräsentanten ausgegrenzt oder abgedrängt werden. Nur Letzteres sind ‚Minderheiten‘ im hier behandelten Sinn[7]. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass ‚Minderheiten‘ nicht immer ‚Minderberechtigte‘ sind, wie dies am Beispiel von Frauen oder älteren Menschen im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit zu sehen ist. Zusammenfassend definiert Hergemöller ‚Randgruppen‘ als
„Personen, die im Rahmen der herrschenden bewussten und kollektiv-unterbewussten Normen und Werten der Gesellschaft aufgrund bestimmter Eigenschaften oder Äußerlichkeiten oder aufgrund traditionsgebundener Assoziationen unter gruppenspezifischen Aspekten betrachtet und ganz oder teilweise ihrer Rechte und ihrer Ehre entkleidet werden“[8].
[...]
[1] In: Meier, Frank: „Gaukler, Dirnen, Rattenfänger“, Ostfildern 2005., S. 9.
[2] vgl. Hippel, Wolfgang von: „Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit“,
München 1995 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, Band 34), Einteilung der Unterschichten, S.6f.
[3] Ebd., S.32.
[4] vgl .Hartung, Wolfgang: „Gesellschaftliche Randgruppen im Spätmittelalter. Phänomen und Begriff“ , in:
Kirchgässner/Räuter, „Städtische Randgruppen und Minderheiten“, S.49-114.
[5] Vgl. Hergemöller, Bernd-Ulrich: „Randgruppen der Spätmittelalterlichen Gesellschaft- Einheit
und Vielfalt“, in: Hergemöller, Bernd-Ulrich (Hrsg): „Randgruppen der spätmittelalterlichen
Gesellschaft: ein Hand- und Studienbuch“, Warendorf 1990, S.1-51, S.2 ff.
[6] Vgl Ebd., S. 6.
[7] Vgl Ebd., S. 10 (Dietrich Kurze: „Häresie und Minderheit im Mittelalter“, in: HZ 229, 1979, S.529-573)
[8] Vgl. Hergemöller, Bernd-Ulrich: „Randgruppen der Spätmittelalterlichen Gesellschaft- Einheit und Vielfalt“, in: Hergemöller, Bernd-Ulrich (Hrsg): „Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft: ein Hand- und Studienbuch“, Warendorf 1990, S.1-51, S. 13.
- Quote paper
- Julian Hoyer (Author), 2011, Nichtsesshafte in der frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262141