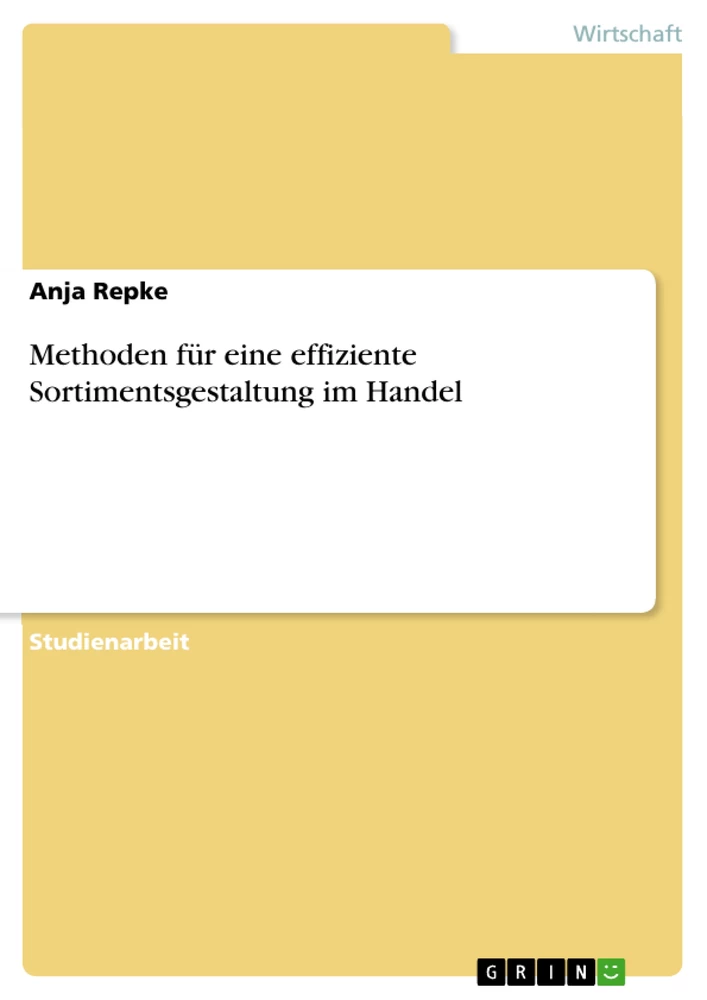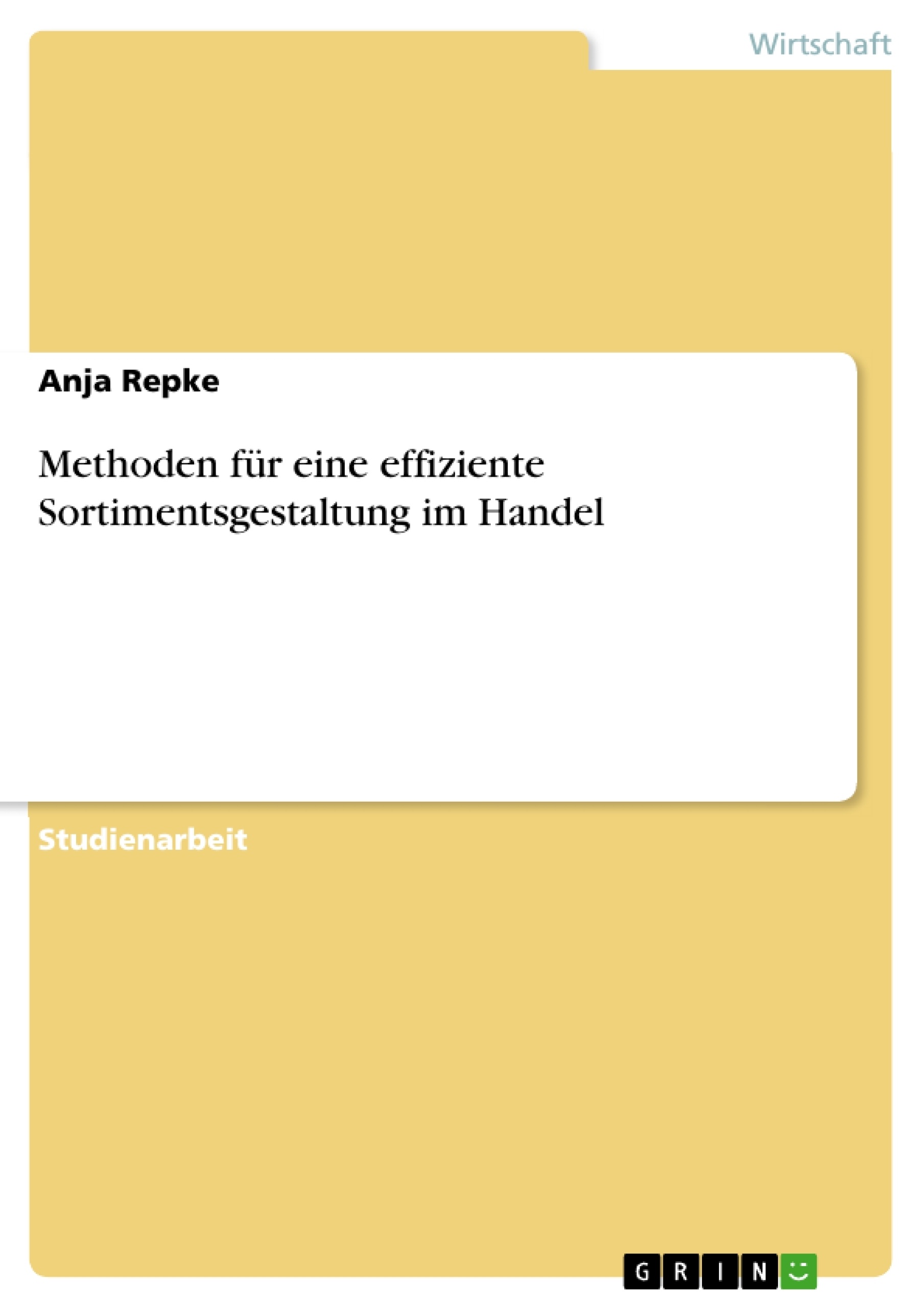In fast allen westlichen Ländern der Welt unterliegt der Einzelhandel einem starken Strukturwandel: Die Anzahl der Geschäfte sinkt bei leicht steigenden Umsätzen und wachsenden Gesamtverkaufsflächen erheblich. Die Bedeutung des nichtorganisierten Einzelhandels wird weiter abnehmen. So vereinten beispielsweise im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) im Jahr 1988 die 10 größten Unternehmen 61 % des Gesamtumsatzes auf sich. 1990 waren es bereits knapp 70 %. Als Folge des Konzentrationsprozesses bietet sich heute ein Oligopolsituation mit hoher Wettbewerbsintensität und großem Druck auf die Margen. Da der Spielraum für die Senkung der Einstandspreise oft nahezu erschöpft ist, müssen Rentabilitätsverbesserungen durch Kostensenkungen erreicht werden. Zudem muss der Handel versuchen, Sortiment und Angebot zu optimieren, um neue Kunden zu gewinnen und Kauffrequenz und -volumen der bestehenden Kunden zu erhöhen. Des weiteren sieht sich der Einzelhandel einem stetigen Wachstum der Sortimente bzw. der Zahl der angebotenen Artikel konfrontiert: Fortlaufend werden dem Handel durch die Industrie neue Artikel angeboten. Da Verkaufsflächen in der Regel begrenzt sind, steht der Handel somit vor der Aufgabe, ständig Auswahlentscheidungen für seine Sortimente treffen zu müssen, diese fortwährend zu überprüfen und anzupassen.
In der vorliegenden Arbeit sollen Methoden für eine effiziente Sortimentsgestaltung vorgestellt werden. Zu diesem Zweck werden im 2. Abschnitt die relevanten Begriffe definiert und der Zusammenhang zwischen diesen erläutert. Im Anschluss erfolgt eine kurze Vorstellung von Datenquellen, welche Informationen für die Entscheidungsfindung im Prozess der Sortimentsgestaltung liefern können. Im 4. Abschnitt werden ausgewählte Kennzahlen, Analysen und Modelle vorgestellt, die zur Analyse von bestehenden Sortimenten genutzt werden können. Die gewonnen Informationen können der geforderten Optimierung der Sortimente im Rahmen der Sortimentsgestaltung dienen und helfen, den Erfolg von getroffenen Entscheidungen zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielstellung und Vorgehensweise
- 2. Sortiment und Sortimentsgestaltung
- 2.1. Definition und Begriffsabgrenzung
- 2.2. Die Sortimentspyramide
- 2.3. Einflussfaktoren auf die Sortimentsgestaltung (Interpendenzproblem)
- 2.4. Beziehungssystem zwischen Einflussfaktoren und Sortimentsgestaltung
- 2.5. Sortimentspolitische Alternativen
- 2.6. Sortimentsgestaltung (Category Management) im Rahmen des ECR
- 3. Datenquellen als Grundlage für die Sortimentsgestaltung
- 3.1. Einleitung
- 3.2. Retail-Panel und Scannerpanel
- 3.3. Einzelgeschäftsdaten
- 3.4. Geschäftseigene Scannerdaten
- 3.5. Consumerpanel
- 3.6. Bondaten / Warenkorbdaten
- 3.7. Ad-hoc-Studien
- 4. Sortimentsgestaltung mit Hilfe von Kennzahlen / Analysen
- 4.1. Ausgewählte einzelproduktbezogene Kennzahlen / Analysen
- 4.1.1. Absatz, Umsatz und Preis
- 4.1.2. Handelsspanne
- 4.1.3. Deckungsbeitrag
- 4.1.4. Direkte Produkt Rentabilität (DPR)
- 4.2. Ausgewählte sortimentsbezogene Kennzahlen / Analysen
- 4.2.1. Preisklassenanalyse
- 4.2.2. Preisabstandsanalyse
- 4.3. Sortimentsgestaltung mit OR-Modellen
- 4.3.1. Nach Brauer
- 4.3.2. Das OLDIMOS Konzept
- 4.4. Das Conjoint Profit Modell
- 4.5. Kritische Würdigung
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Methoden für eine effiziente Sortimentsgestaltung im Einzelhandel. Der Fokus liegt auf der Analyse von Einflussfaktoren, der Nutzung verschiedener Datenquellen und der Anwendung von Kennzahlen und Modellen zur Optimierung des Sortiments.
- Analyse von Einflussfaktoren auf die Sortimentsgestaltung
- Relevante Datenquellen für die Sortimentsentscheidung
- Anwendung von Kennzahlen zur Sortimentsbewertung
- Einsatz von Operations Research (OR)-Modellen zur Sortimentsoptimierung
- Bewertung verschiedener Ansätze zur Sortimentsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel beschreibt die Problemstellung des Strukturwandels im Einzelhandel, gekennzeichnet durch sinkende Anzahl der Geschäfte bei steigenden Umsätzen und wachsenden Verkaufsflächen. Die zunehmende Konzentration und der daraus resultierende Wettbewerbsdruck erfordern Rentabilitätsverbesserungen durch Kostensenkungen und Sortimentsoptimierung, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Das stetige Wachstum des Sortiments und die begrenzten Verkaufsflächen stellen den Handel vor die Herausforderung, kontinuierlich Auswahlentscheidungen zu treffen und anzupassen. Die Arbeit zielt darauf ab, Methoden für eine effiziente Sortimentsgestaltung vorzustellen.
2. Sortiment und Sortimentsgestaltung: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Sortiment" und grenzt ihn ab. Es wird die Sortimentspyramide erläutert und die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Sortimentsgestaltung detailliert dargestellt, inklusive des Interpendenzproblems. Das Kapitel beleuchtet das Beziehungssystem zwischen Einflussfaktoren und Sortimentsgestaltung und präsentiert verschiedene sortimentspolitische Alternativen. Schließlich wird die Sortimentsgestaltung im Kontext des Efficient Consumer Response (ECR) und des Category Managements (CM) behandelt.
3. Datenquellen als Grundlage für die Sortimentsgestaltung: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Datenquellen, die als Grundlage für eine fundierte Sortimentsgestaltung dienen. Es werden Retail- und Scannerpanels, Einzelgeschäftsdaten, geschäftseigene Scannerdaten, Consumerpanels, Bondaten/Warenkorbdaten und Ad-hoc-Studien als wichtige Informationsquellen beschrieben und deren jeweilige Vor- und Nachteile diskutiert. Die Auswahl der passenden Datenquelle hängt stark von den jeweiligen Zielen und Anforderungen der Sortimentsgestaltung ab.
4. Sortimentsgestaltung mit Hilfe von Kennzahlen / Analysen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung von Kennzahlen und Analysen für die Sortimentsgestaltung. Es werden sowohl einzelproduktbezogene Kennzahlen wie Absatz, Umsatz, Preis, Handelsspanne, Deckungsbeitrag und die Direkte Produkt Rentabilität (DPR) als auch sortimentsbezogene Kennzahlen wie die Preisklassen- und die Preisabstandsanalyse erläutert. Darüber hinaus werden OR-Modelle wie das Konzept nach Brauer und das OLDIMOS Konzept vorgestellt und das Conjoint Profit Modell beschrieben. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Würdigung der vorgestellten Methoden.
Schlüsselwörter
Sortimentsgestaltung, Einzelhandel, Wettbewerbsdruck, Rentabilität, Datenquellen, Kennzahlenanalyse, OR-Modelle, Category Management, ECR, Sortimentspyramide, Preisanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Effiziente Sortimentsgestaltung im Einzelhandel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit Methoden zur effizienten Sortimentsgestaltung im Einzelhandel. Der Fokus liegt auf der Analyse von Einflussfaktoren, der Nutzung verschiedener Datenquellen und der Anwendung von Kennzahlen und Modellen zur Sortimentsoptimierung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse von Einflussfaktoren auf die Sortimentsgestaltung, relevante Datenquellen für Sortimentsentscheidungen, Anwendung von Kennzahlen zur Sortimentsbewertung, Einsatz von Operations Research (OR)-Modellen zur Sortimentsoptimierung und die Bewertung verschiedener Ansätze zur Sortimentsgestaltung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise), Sortiment und Sortimentsgestaltung (Definition, Sortimentspyramide, Einflussfaktoren, Sortimentspolitische Alternativen, Category Management im Rahmen des ECR), Datenquellen als Grundlage für die Sortimentsgestaltung (Retail- und Scannerpanels, Einzelgeschäftsdaten, Consumerpanels, Bondaten, Ad-hoc-Studien), Sortimentsgestaltung mit Hilfe von Kennzahlen/Analysen (Einzelprodukt- und Sortimentsbezogene Kennzahlen, OR-Modelle wie Brauer und OLDIMOS, Conjoint Profit Modell) und Ausblick.
Welche Datenquellen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Datenquellen, darunter Retail- und Scannerpanels, Einzelgeschäftsdaten, geschäftseigene Scannerdaten, Consumerpanels, Bondaten/Warenkorbdaten und Ad-hoc-Studien. Die Auswahl der geeigneten Datenquelle hängt von den Zielen und Anforderungen der Sortimentsgestaltung ab.
Welche Kennzahlen und Analysen werden verwendet?
Es werden sowohl einzelproduktbezogene Kennzahlen (Absatz, Umsatz, Preis, Handelsspanne, Deckungsbeitrag, Direkte Produkt Rentabilität (DPR)) als auch sortimentsbezogene Kennzahlen (Preisklassenanalyse, Preisabstandsanalyse) behandelt. Zusätzlich werden Operations Research (OR)-Modelle zur Sortimentsoptimierung vorgestellt.
Welche OR-Modelle werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt das Konzept nach Brauer, das OLDIMOS Konzept und das Conjoint Profit Modell als Beispiele für Operations Research Modelle zur Sortimentsgestaltung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Methoden für eine effiziente Sortimentsgestaltung vorzustellen, um im Einzelhandel im Angesicht von steigendem Wettbewerbsdruck und Strukturwandel die Rentabilität zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sortimentsgestaltung, Einzelhandel, Wettbewerbsdruck, Rentabilität, Datenquellen, Kennzahlenanalyse, OR-Modelle, Category Management, ECR, Sortimentspyramide, Preisanalyse.
Wie wird die Sortimentsgestaltung im Kontext von ECR und Category Management behandelt?
Die Arbeit behandelt die Sortimentsgestaltung im Kontext des Efficient Consumer Response (ECR) und des Category Managements (CM), indem sie die Integration dieser Ansätze in die Sortimentsgestaltung erläutert.
Welche Herausforderungen im Einzelhandel werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert den Strukturwandel im Einzelhandel mit sinkender Anzahl an Geschäften bei steigenden Umsätzen und wachsenden Verkaufsflächen. Der daraus resultierende Wettbewerbsdruck und das stetige Wachstum des Sortiments bei begrenzten Verkaufsflächen werden als zentrale Herausforderungen hervorgehoben.
- Quote paper
- Anja Repke (Author), 2004, Methoden für eine effiziente Sortimentsgestaltung im Handel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26055