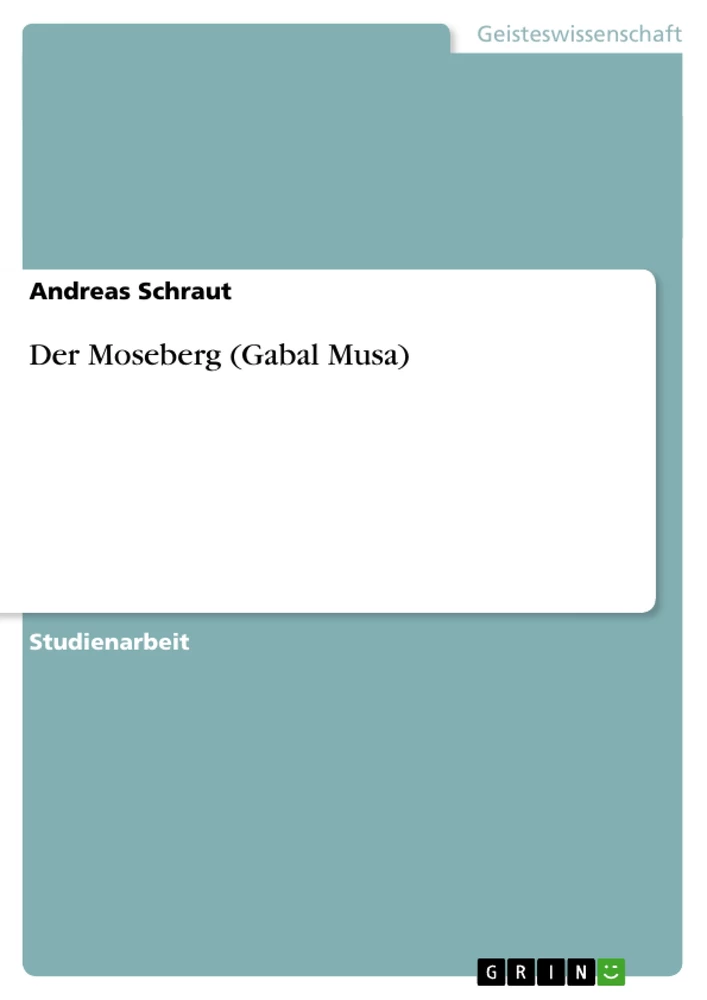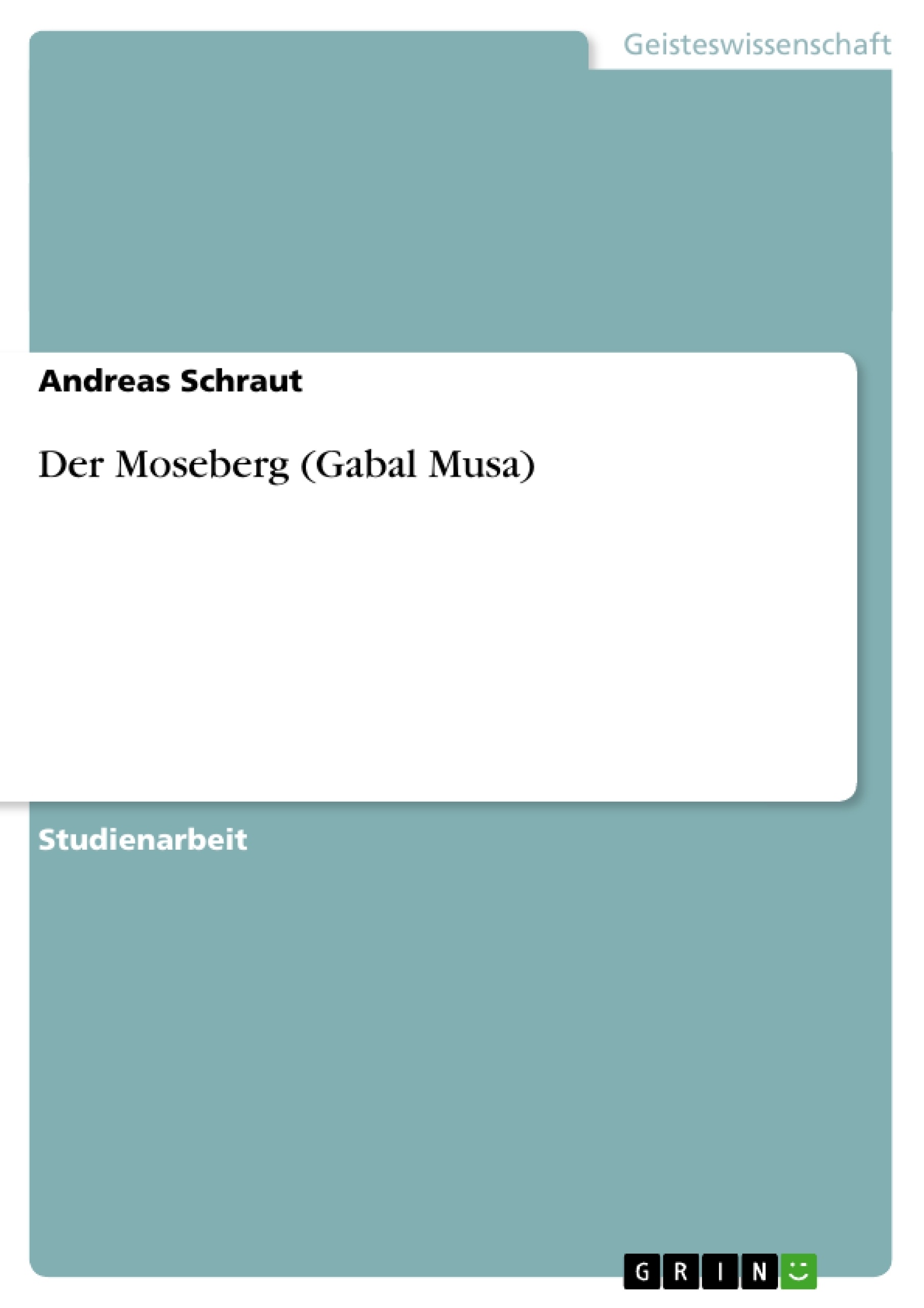Der Auszug aus Ägypten bedeutete für das Volk Israel einen gewaltigen Einschnitt in
ihrer Geschichte. Nicht nur die jahrelange Knechtschaft fand ein Ende, zugleich wurde
mit dem Dekalog das Fundament für ein eigenständiges Israel und sein Rechtssystem
gegeben. Das Alte Testament berichtet ausführlich von dieser Begebenheit
auf dem Berg Sinai:
„Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben
diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai.
Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der
Wüste; und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber.
Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berg aus zu: So sollst
du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen:
Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und <wie> ich euch auf Adlerflügeln
getragen und euch zu mir gebracht habe. (…)
Und der HERR sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen!
Und sie sollen ihre Kleider waschen,
damit sie für den dritten Tag bereit sind; denn am dritten Tag wird der HERR vor den
Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen.“1
So ist es also verständlich, dass man versucht hat (und es auch geschafft hat), diese
Stätte zu lokalisieren, an der das Gesetz an Mose übergeben wurde. Der Moseberg
(Ğabal Mūsā) auf der Sinaihalbinsel wurde dazu als Stätte ausersehen und wird seit
Jahrhunderten von Pilgern als solche verehrt. Doch durch das Aufkommen der Pentateuch-
Kritik wird von vielen die Authentizität dieses Ortes angezweifelt. Viele Forscher
- die bekanntesten unter ihnen sind ohne Zweifel Julius Wellhausen und Martin
Noth - gaben Vorschläge für alternative Auszugsrouten der Hebräer aus Ägypten und
somit auch für andere Orte der Gottesbegegnung ab. Es gibt wohl kaum ein Gebiet
zwischen Ägypten und Israel, in dem der Berg der Gesetzgebung nicht vermutet
wird. Doch zu einem Konsens wird es nie kommen, denn zu ungenau sind die geographischen
Beschreibungen des Alten Testamentes und auch die Doppelbenennung
von Sinai und Horeb im Alten Testament tut ihr Übriges dazu.
Doch ist es ja gerade die Doppelbenennung des Gottesberges, die einen dann angesichts
der festen Identifizierung des Ğabal Mūsā stutzig werden lässt. Horst Heinemann hat für diese Doppelbenennung folgende Erklärung herausgearbeitet:
„Aber im Nordreich heißt der Gottesberg »Horeb«. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Der Mosesberg - Ort der Gesetzgebung Jahwes?
- B. Das Verhältnis der beiden Weltreligionen Judentum und Christentum zum Sinai
- 1. Das Judentum
- 2. Das Christentum
- C. Der Sinai als „Heiliger Berg“ des Islam
- D. Die Diskussion um die Lage des Gottesberges in der neuzeitlichen Forschung
- 1. Die Sirbal - Theorie
- 2. Die Vulkanhypothese
- E. Zusammenfassung: Die Kriterien für die endgültige Identifizierung des Gabal Mūsā
- 1. Das Phänomen der Dendriten
- 2. Der Gabal Mūsā - ein heiliger Berg für die Nabatäer
- 3. Die Lokalisierung des biblischen Geschehens anhand des,Brennenden Dornbuschs'
- F. Fazit: Ist der Ğabal Mūsā tatsächlich der Sinai des AT?
- 1. Die außerchristlichen Hinweise auf die Sinaihalbinsel als Ort des Gottesberges
- 2. Die ewige Suche nach dem Gottesberg - Gibt es ihn überhaupt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den historischen und religiösen Hintergrund des Mosebergs (Gabal Mūsā) auf der Sinaihalbinsel. Ziel ist es, die Bedeutung des Berges in den drei abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam zu beleuchten und die historische Entwicklung der Identifizierung des Ğabal Mūsā als Ort der Gesetzgebung Jahwes zu analysieren.
- Der Moseberg als Ort der Gesetzgebung Jahwes im Alten Testament
- Die Rolle des Sinai in Judentum und Christentum
- Der Sinai als "Heiliger Berg" im Islam
- Die Diskussion um die Lage des Gottesberges in der neuzeitlichen Forschung
- Die Kriterien für die endgültige Identifizierung des Gabal Mūsā
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der historischen Bedeutung des Mosebergs im Alten Testament. Der Auszug aus Ägypten und die Übergabe des Dekalogs auf dem Berg Sinai werden als zentrale Ereignisse der biblischen Geschichte betrachtet. Der Autor diskutiert die Authentizität des Mosebergs als Ort der Gesetzgebung und beleuchtet die verschiedenen Theorien zur Lage des Gottesberges.
Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Beziehung des Sinai zu Judentum und Christentum. Dabei wird aufgezeigt, dass die Identifizierung des Sinai für das Judentum keine zentrale Rolle spielt, während das Christentum den Ğabal Mūsā als Ort der Offenbarung verehrt.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Sinai im Islam. Der Ğabal Mūsā wird als "Heiliger Berg" betrachtet und mit einer Reihe von Prophezeiungen und Ereignissen in Verbindung gebracht.
Der vierte Teil der Arbeit diskutiert die Debatte um die Lage des Gottesberges in der neuzeitlichen Forschung. Verschiedene Theorien und Argumente werden beleuchtet, darunter die Sirbal-Theorie und die Vulkanhypothese.
Der fünfte Teil der Arbeit fasst die wichtigsten Kriterien für die Identifizierung des Gabal Mūsā zusammen. Der Autor analysiert das Phänomen der Dendriten, die Bedeutung des Ğabal Mūsā für die Nabatäer und die Lokalisierung des biblischen "Brennenden Dornbuschs".
Der sechste Teil der Arbeit diskutiert die Frage, ob der Ğabal Mūsā tatsächlich der Sinai des Alten Testaments ist. Der Autor analysiert die außerchristlichen Hinweise auf die Sinaihalbinsel als Ort des Gottesberges und die ewige Suche nach dem Gottesberg.
Schlüsselwörter
Moseberg, Sinai, Gesetzgebung Jahwes, Judentum, Christentum, Islam, Gottesberg, Ğabal Mūsā, Sirbal-Theorie, Vulkanhypothese, Dendriten, Nabatäer, Brennender Dornbusch.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Gabal Musa wirklich der biblische Berg Sinai?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch und beleuchtet sowohl die jahrhundertelange Tradition als auch moderne Zweifel durch die Pentateuch-Kritik.
Welche alternativen Theorien zur Lage des Gottesberges gibt es?
Es werden unter anderem die Sirbal-Theorie und die Vulkanhypothese diskutiert, die den Berg an anderen Orten vermuten.
Welche Bedeutung hat der Berg Sinai im Islam?
Der Gabal Musa wird im Islam als „Heiliger Berg“ verehrt und mit verschiedenen Prophezeiungen und biblischen Ereignissen in Verbindung gebracht.
Was hat es mit dem Phänomen der „Dendriten“ auf sich?
Die Arbeit nennt Dendriten (pflanzenähnliche Mineralstrukturen im Gestein) als eines der Kriterien, die zur Identifizierung des Gabal Musa herangezogen werden.
Warum gibt es im Alten Testament die Doppelnamen Sinai und Horeb?
Diese Doppelbenennung sorgt für wissenschaftliche Diskussionen; eine Erklärung ist, dass „Horeb“ die Bezeichnung im Nordreich für denselben Gottesberg war.
- Quote paper
- Andreas Schraut (Author), 2004, Der Moseberg (Gabal Musa), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26010