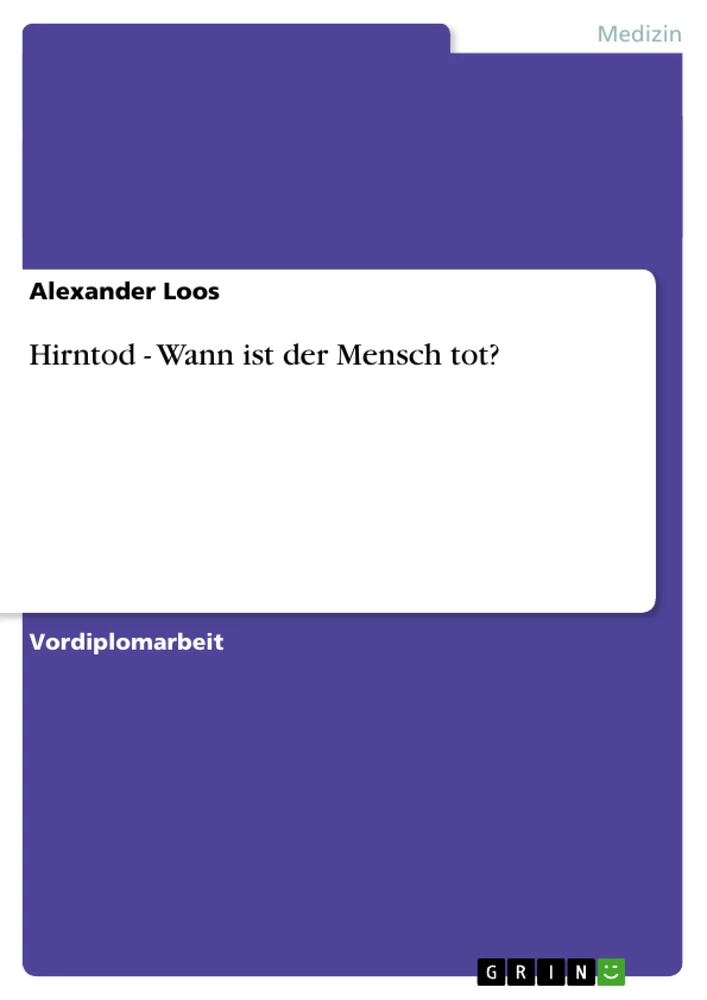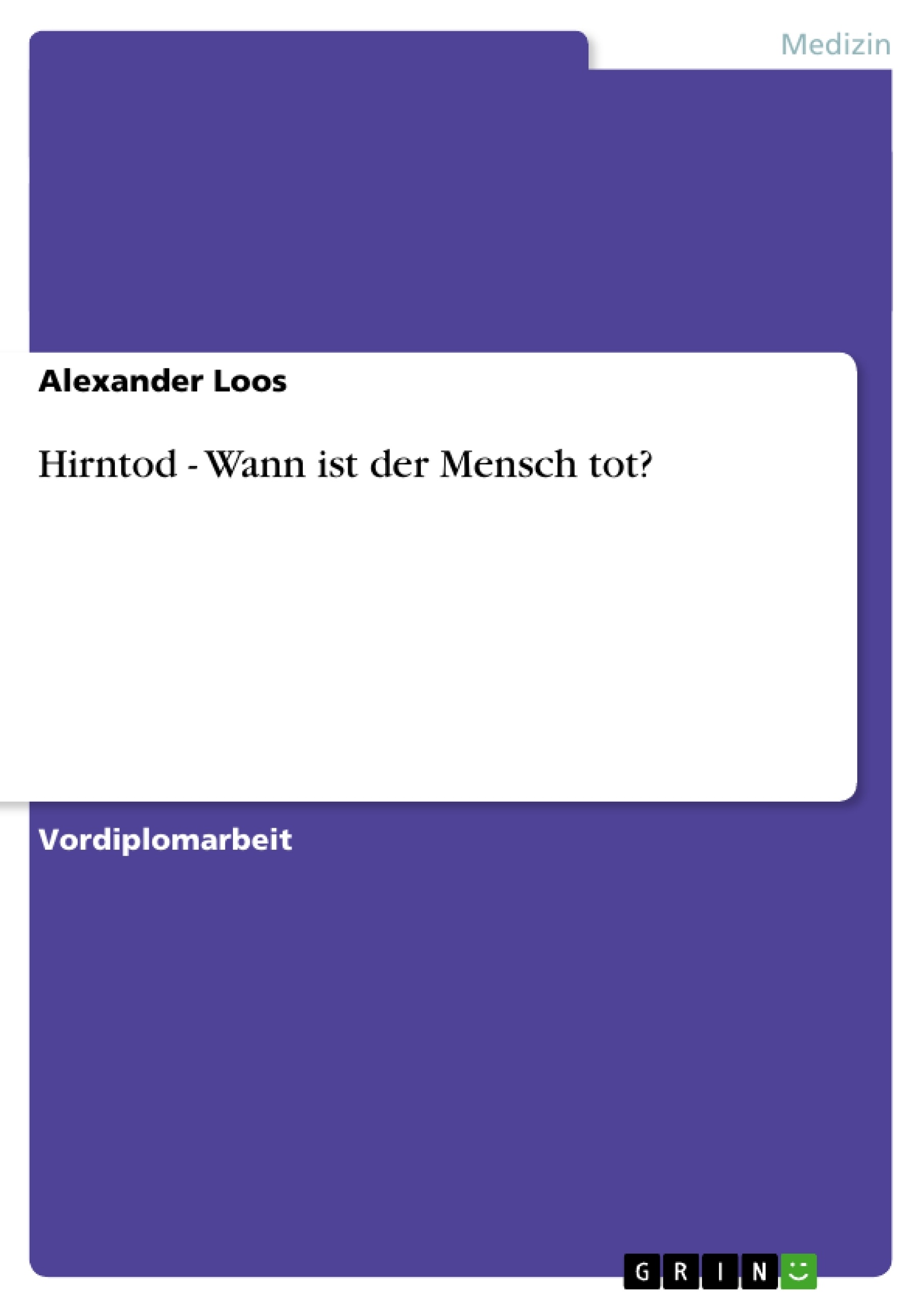Abstract
Die Debatte des Sachverhaltes „Hirntod“ ist aktueller denn je. Immer weniger Spender und immer mehr Personen, die ein Spenderorgan dringend benötigen, um zu Überleben bzw. eine höhere Lebensqualität zu erlangen.
Mit dem In Kraft treten des Transplantationsgesetzes (TPG) und der Ausarbeitung Hirntoddefinition der Bundesärztekammer ist der so genannte Gesamthirntod Vorraussetzung für die Organentnahme in Deutschland geworden. Der Gesamthirntod eines Menschen wird somit gleichgesetzt mit dem Tod des Menschen, denn es ist Medizinern gesetzlich nur erlaubt, Organe aus einem „toten Körper“ zu entnehmen. Die entscheidende Frage wurde schon weit vor dem In Kraft treten des Transplantationsgesetzes diskutiert. Wann ist ein Mensch tot? Ist der Tod des Organs Gehirn gleichzusetzen mit dem Tod des Menschen als ganzheitliches Individuum? Viele Kritiker sprechen von einer Vorverlegung des Todeszeitpunktes, um möglich früh an die Organe, die ja auch ein großes Wirtschaftspotential sind, zu gelangen. Das Hirntodkriterium sei ein Eingriff in den Sterbeprozess. Ethische Fragen wurden und werden diskutiert, nicht allein seit dem „Erlanger-Fall“. Die Frage um die Pietät gegenüber den Hirntoten, die Frage nach dem was von diesen Menschen möglicherweise noch wahrgenommen und gefühlt werden kann steht immer noch im Raum, und eine Lösung scheint schwer erreichbar in einer so pluralistischen Gesellschaft, wie der unseren. Die Wissenschaften streiten sich um Definitionen. Die Medizin bezieht sich meist auf rein biologische Erklärungsversuche, um gewisse „Unregelmäßigkeiten“ bei der Hirntoddiagnostik, wie z.B. spontane Bewegungen des Hirntoten bei der Entnahme von Organen zu rechtfertigen. Dient der hirntote Mensch nur noch als Ersatzteillager für andere, die dringend ein Organ benötigen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffserklärungen zur Einführung in die Hirntoddiskussion
- 1.1. Hirntoddefinition und Hirntodkriterium
- 1.2. Ganzhirntod und Teilhirntod
- 1.3. Die diagnostischen Verfahren zur Hirntodfeststellung
- 1.4. Das Hirntodprotokoll
- 2. Gesetzliche Grundlage der Organtransplantation
- 3. Die historische Entwicklung der Hirntoddefinition
- 4. Der Erlanger Fall als Musterbeispiel der Hirntoddiskussion
- 5. Schlussbetrachtung mit eigener Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zeitpunkt des Todes im Kontext des Hirntods, insbesondere im Hinblick auf die Organtransplantation. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, die historische Entwicklung der Hirntoddefinition und ethische Fragen, die sich daraus ergeben.
- Definition und Kriterien des Hirntods
- Gesetzliche Grundlagen der Organtransplantation in Bezug auf den Hirntod
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Tod und Hirntod
- Ethische und gesellschaftliche Implikationen der Hirntoddefinition
- Der Erlanger Fall als Beispiel für die Kontroverse um den Hirntod
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Hirntods als Voraussetzung für Organtransplantationen in Deutschland ein. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Zeitpunkt des Todes und den damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Kritische Stimmen, die eine Vorverlegung des Todeszeitpunktes befürchten, werden erwähnt. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die Thematik zu geben und die verschiedenen Aspekte der Hirntoddiskussion zu beleuchten, inklusive der Organspende und der mangelnden öffentlichen Aufklärung.
1. Begriffserklärungen zur Einführung in die Hirntoddiskussion: Dieses Kapitel klärt wichtige Begriffe wie Hirntoddefinition und -kriterium, Ganz- und Teilhirntod. Es differenziert zwischen dem wissenschaftlich überprüfbaren Kriterium und der ethisch und gesellschaftlich geprägten Definition des Todes. Die Ausführungen betonen die philosophischen, theologischen und juristischen Dimensionen des Personenbegriffs und deren Einfluss auf die Definition des Todes. Die Grenzen zwischen medizinischer Feststellung und ethischer Bewertung des Hirntods werden deutlich herausgearbeitet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Hirntod und Organtransplantation
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Hirntod im Kontext der Organtransplantation. Sie untersucht den Zeitpunkt des Todes, die gesetzlichen Grundlagen, die historische Entwicklung der Hirntoddefinition und die damit verbundenen ethischen Fragen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Kriterien des Hirntods, gesetzliche Grundlagen der Organtransplantation, historische Entwicklung des Verständnisses von Tod und Hirntod, ethische und gesellschaftliche Implikationen der Hirntoddefinition und den Erlanger Fall als Beispiel für die Kontroverse um den Hirntod.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffserklärungen zur Einführung in die Hirntoddiskussion (inkl. Hirntoddefinition, Hirntodkriterien, Ganz- und Teilhirntod, diagnostische Verfahren und Hirntodprotokoll), Gesetzliche Grundlage der Organtransplantation, Die historische Entwicklung der Hirntoddefinition, Der Erlanger Fall als Musterbeispiel der Hirntoddiskussion und Schlussbetrachtung mit eigener Stellungnahme.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik des Hirntods als Voraussetzung für Organtransplantationen ein. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Zeitpunkt des Todes und den damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Kritische Stimmen, die eine Vorverlegung des Todeszeitpunktes befürchten, werden erwähnt. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die Thematik zu geben und die verschiedenen Aspekte der Hirntoddiskussion zu beleuchten, inklusive der Organspende und der mangelnden öffentlichen Aufklärung.
Was wird im Kapitel "Begriffserklärungen zur Einführung in die Hirntoddiskussion" behandelt?
Dieses Kapitel klärt wichtige Begriffe wie Hirntoddefinition und -kriterium, Ganz- und Teilhirntod. Es differenziert zwischen dem wissenschaftlich überprüfbaren Kriterium und der ethisch und gesellschaftlich geprägten Definition des Todes. Die Ausführungen betonen die philosophischen, theologischen und juristischen Dimensionen des Personenbegriffs und deren Einfluss auf die Definition des Todes. Die Grenzen zwischen medizinischer Feststellung und ethischer Bewertung des Hirntods werden deutlich herausgearbeitet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zeitpunkt des Todes im Kontext des Hirntods, insbesondere im Hinblick auf die Organtransplantation. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, die historische Entwicklung der Hirntoddefinition und ethische Fragen, die sich daraus ergeben.
- Citar trabajo
- Alexander Loos (Autor), 2001, Hirntod - Wann ist der Mensch tot?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25855