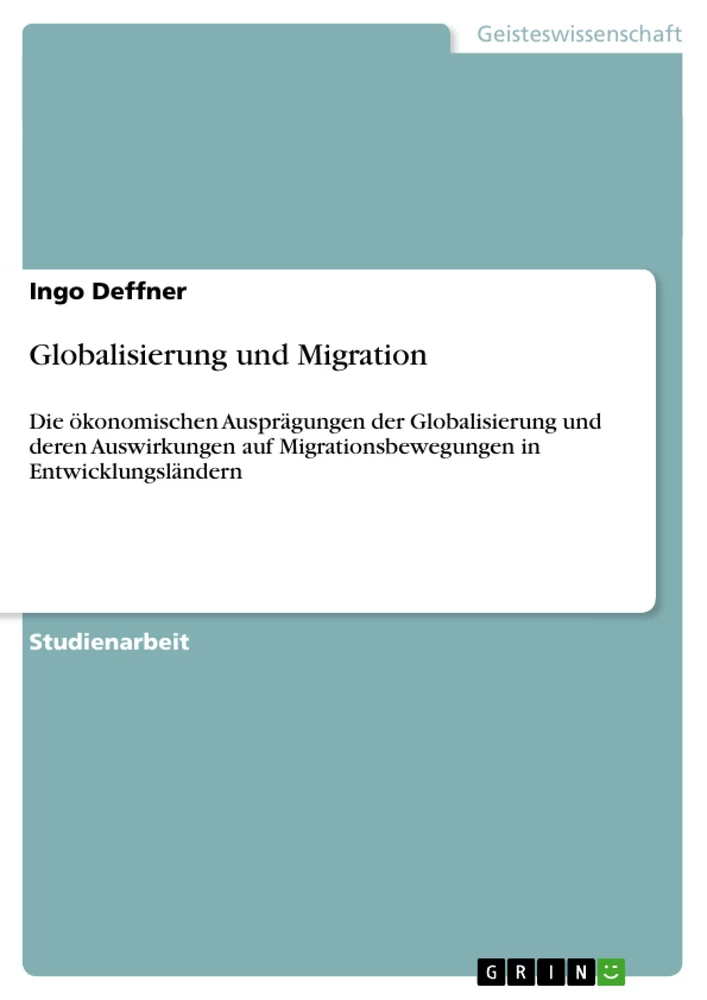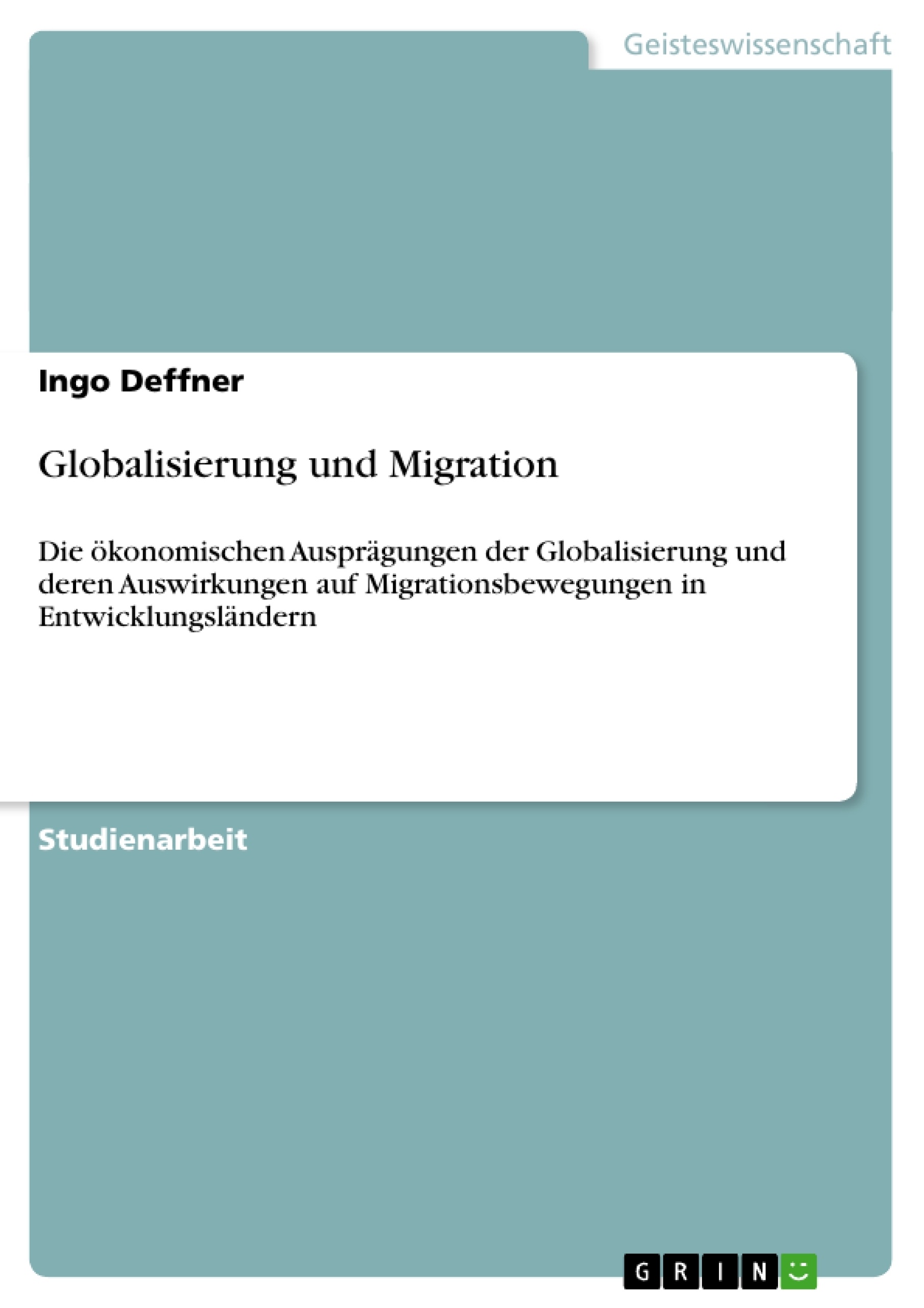Einleitung
„Globalisierung“ bezeichnet eine Entwicklung, die zwischen Befürwortern, für die es sich dabei in erster Linie um einen Weg zu weltweitem Wohlstand durch den Abbau von Handelshemmnissen und Wettbewerbsbeschränkungen handelt, und Kritikern, die u.a. zunehmende soziale Ungleichheit zwischen den reichen Industrienationen und den „Entwicklungsländern“ sowie fehlende staatliche Kontrolle über multinationale Unternehmen bemängeln, sehr umstritten ist. Während „Globalisierung“ also bei den einen Aufbruchsstimmung, bei den anderen Ängste auslöst, hat ein anderer weltpolitischer Trend, nämlich die Zunahme der internationalen Migration, ebenfalls für einige Aufmerksamkeit gesorgt und gerade in der Frage der Regulierung Besorgnis ausgelöst. Im Zeitalter der Globalisierung stellt sich die Frage, ob der Nationalstaat als „Wächter über Grenzen“ überhaupt noch in der Lage ist, Wanderungsbewegungen steuern zu können, oder ob dieses Ziel nur durch internationale Zusammenarbeit im Sinne des Konzeptes der „Global Governance“ und damit der Aufgabe einstmals selbstverständlicher nationaler Souveränitätsrechte zu erreichen ist. Grundsätzlich ist es in der wissenschaftlichen Debatte aber unstrittig, dass die Globalisierung die traditionellen Vorstellungen des Regierens im Nationalstaat in Frage stellt.
Obwohl auch die Frage nach den Handlungsspielräumen bei der Steuerung der perspektivisch eher zunehmenden globalen und regionalen Migrationsströme einen hohen Stellenwert sowohl in nationaler als auch internationaler Politik einnimmt, ist es keineswegs so, dass bei allen Wanderungsbewegungen der Einfluss der Globalisierung plausibel erscheint, denn oft besteht nur ein mittelbarer oder gar kein Zusammenhang, , was in der öffentlichen politischen Debatte aber oft nicht zur Kenntnis genommen wird, da die Themen „Zuwanderung“ und „Integrationspolitik“ und die damit zusammenhängenden Fragen in den einzelnen Staaten ein emotional hoch brisantes und ideologisiertes Politikfeld darstellen. Nicht zuletzt die Bilder von überfüllten Flüchtlingsschiffen vor der Küste Italiens, die „Belagerung“ der Grenze zwischen Mexico und den USA durch potentielle Migranten sowie die erwartete Migrationswelle aus den ehemaligen Ostblockstaaten im Zuge der EU-Erweiterung prägen die Eindrücke vieler Bürger in den westlichen Industriestaaten von den unheilvollen Einflüssen der Globalisierung auf die weltweite Migrationsproblematik.
Inhaltsverzeichnis
- Die ökonomischen Auswirkungen der Globalisierung auf die Least Developed Countries
- Ausgewählte soziologische Aspekte der Globalisierung
- Der Begriff der Globalisierung in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte
- Innovationen und Infrastrukturverbesserungen als Motor der Globalisierung
- Telekommunikation und Datenverarbeitung als Voraussetzungen für die Teilhabe an der globalen Wissensgesellschaft der Zukunft
- Infrastruktur und die Senkung der Transportkosten
- Die Liberalisierung von Handel und Finanzmärkten
- Arbeitsteilung und Handel zwischen den Staaten als Grundlage der Globalisierung
- Der Abbau von Zollschranken und Handelshemmnissen
- Die Liberalisierung der Finanzmärkte
- Die Bedeutung von Direktinvestitionen für die Entwicklungsländer
- Die Chancen und Risiken der Globalisierung für die Least Developed Countries
- Migrationsbewegungen in Entwicklungsländern im Zeitalter der Globalisierung
- Ökonomische Aspekte von Migrationstheorien im Überblick und ihre Bedeutung für die Least Developed Countries
- Arbeitsmigration in Asien im Zeitalter der Globalisierung
- Migration zu Beginn des 21.Jahrhunderts in NIC's und LDC's
- Die Asienkrise von 1997 und ihre Auswirkungen auf inter- und intraregionale Migrationsströme im asiatisch-pazifischen Raum
- Arbeitsmigration auf den Philippinen als Beispiel für die LDC's
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Globalisierung und Migrationsbewegungen in Entwicklungsländern, insbesondere in Bezug auf die ökonomischen Implikationen der Globalisierung für die Least Developed Countries (LDC's).
- Die ökonomischen Auswirkungen der Globalisierung auf die LDC's
- Die Rolle von Handel und Finanzmärkten im Globalisierungsprozess
- Theorien der Arbeitsmigration und ihre Anwendbarkeit im Kontext der Globalisierung
- Migrationsbewegungen in Asien, insbesondere auf den Philippinen
- Die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung für die LDC's und ihre Auswirkungen auf Migrationsströme
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich den ökonomischen Auswirkungen der Globalisierung auf die Least Developed Countries. Es behandelt verschiedene soziologische und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte der Globalisierung, darunter die Liberalisierung von Handel und Finanzmärkten sowie die Bedeutung von Innovationen und Infrastrukturverbesserungen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, welche Chancen und Risiken die Globalisierung für die LDC's mit sich bringt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Migrationsbewegungen in Entwicklungsländern im Zeitalter der Globalisierung. Es beleuchtet die ökonomischen Aspekte von Migrationstheorien und untersucht deren Relevanz für die LDC's. Das Kapitel analysiert Arbeitsmigration in Asien, insbesondere die Folgen der Asienkrise von 1997 und die Situation der Arbeitsmigration auf den Philippinen als Beispiel für die LDC's.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Entwicklungsländer, Least Developed Countries, Arbeitsmigration, Handel, Finanzmärkte, Migrationstheorien, Asienkrise, Philippinen.
- Citar trabajo
- Ingo Deffner (Autor), 2004, Globalisierung und Migration, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25759