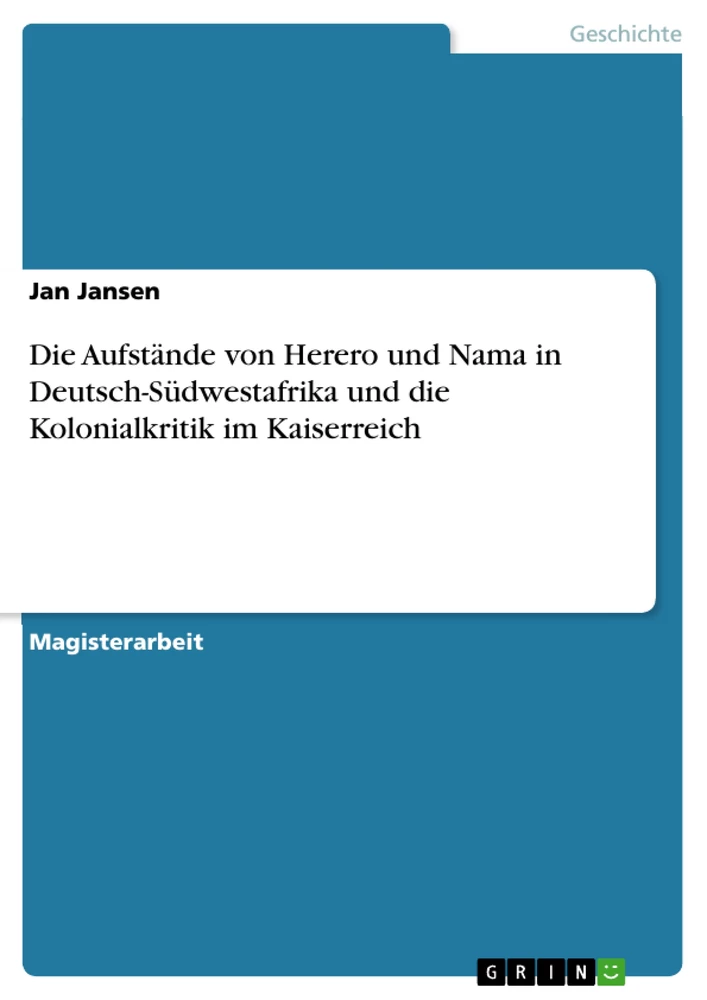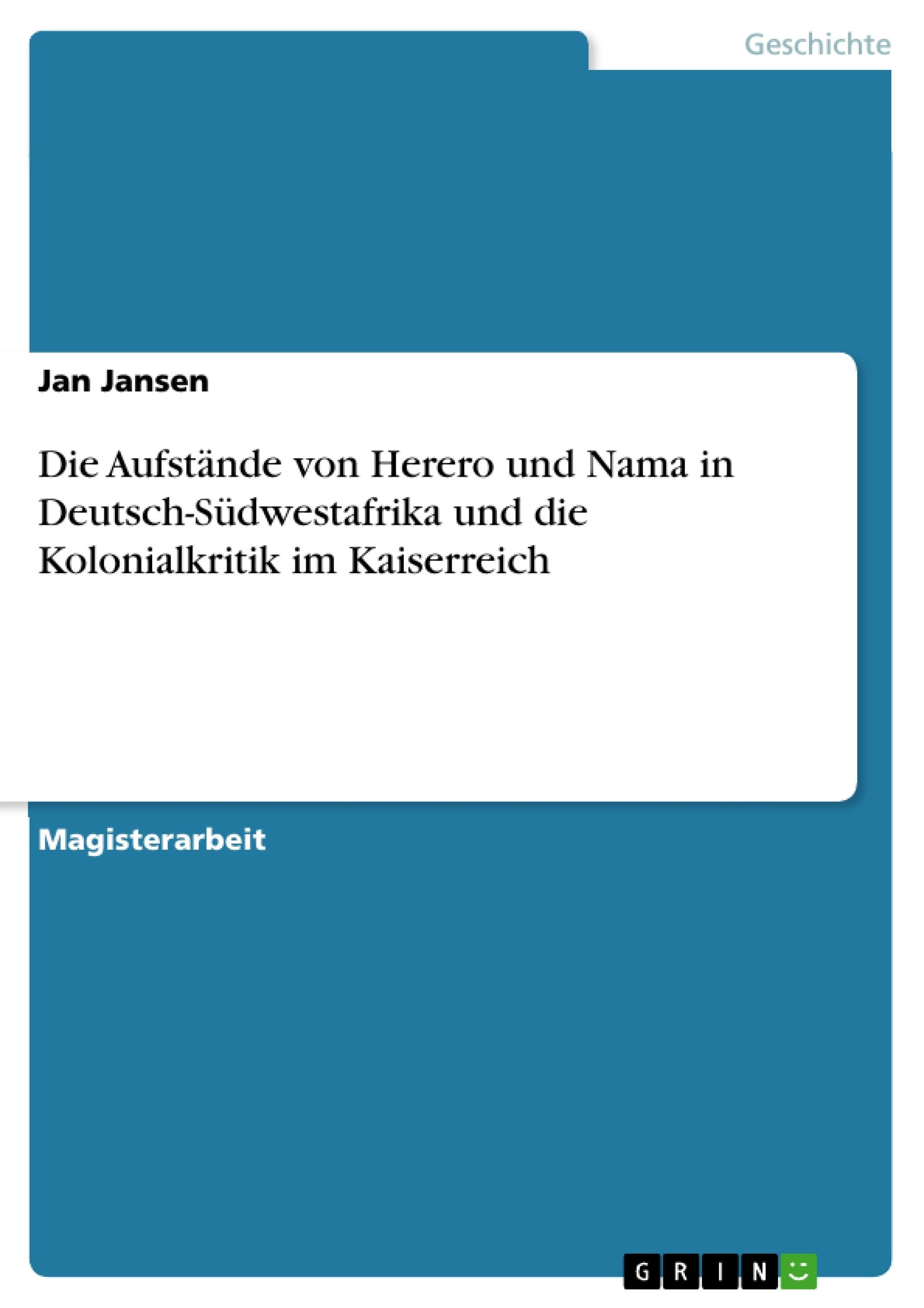Mit den Aufständen von Herero und Nama in „Deutsch-Südwestafrika“ begann 1904 der längste Krieg, den das Kaiserreich gegen indigene Bevölkerungsgruppen seiner Kolonien führte. Bis 1907 wurden 14.000 Soldaten in das Gebiet des heutigen Namibia geschickt, von denen knapp 2.350 getötet, vermisst oder verwundet wurden. Erklärtes Ziel der Militärführung war über Monate die „Vernichtung“ der Afrikaner. Männer und Frauen, Kinder und Alte sollten erschossen oder in die Wüste getrieben werden und dort den Tod durch Verdursten erleiden. Tausende wurden in Lagern interniert und starben infolge von katastrophalen Haftbedingungen, Zwangsarbeit und Prügel. Auf Seiten der Herero und Nama kamen zwischen 30.000 und 75.000 Menschen zu Tode – weit mehr als die Hälfte, eventuell sogar zwei Drittel der Bevölkerung. Ihre „Stammesverbände“ wurden nach dem Ende der Kämpfe aufgelöst, der Besitz an Land und Vieh enteignet. Die Überlebenden wurden zu nahezu rechtlosen Arbeitskräften degradiert, die umfassend kontrolliert und jederzeit verfügbar sein sollten. Der Kolonialkrieg markierte damit eine tiefe Zäsur in der Entwicklung des Landes.
Zur deutschen Kolonialvergangenheit in Namibia und besonders auch zum Krieg gegen Herero und Nama ist eine Fülle von Literatur verfügbar. Nahezu einhellig und mit überzeugenden Argumenten wird die Kriegsführung gegen die Afrikaner heute als Genozid qualifiziert. Weitgehend unbeachtet blieb aber bisher die Frage, inwiefern Kriegsführung und Kolonisationsmethoden in „Südwestafrika“ seinerzeit im Deutschen Reich kritisch diskutiert wurden. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke. Sie skizziert zunächst die Ereignisse in der Kolonie auf der Basis des aktuellen Forschungsstands. Im Hauptteil beschreibt und analysiert sie ausführlich die Rezeption des Kriegs durch die kolonialkritischen Parteien SPD und Zentrum, widmet sich ihren Zielen und Argumentationen, ihren Strategien und Erfolgen in Bezug auf den Konflikt. Die öffentliche Anteilnahme war immens! Es wird deutlich, wie die heftigen Kontroversen über die Aufstände und ihre Bekämpfung einerseits zu einer Reform der offiziellen Kolonialpolitik, andererseits zu folgeschweren innenpolitischen Kräfteverschiebungen führten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Aufstände von Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika: Ursachen, Verlauf und Konsequenzen der Ereignisse in der Kolonie.
- 1. Vorbemerkungen: Das Territorium Deutsch-Südwestafrikas, seine Bevölkerung und Entwicklung vor 1893.
- 2. Ursachen: Grundzüge und Konsequenzen des „Systems Leutwein“.
- 3. Verlauf: Die Aufstände von 1904 bis 1907 und ihre Niederschlagung
- 3.1. Der Herero-Aufstand.
- 3.2. Der Nama-Aufstand.
- 4. Konsequenzen: Die Situation von Herero und Nama nach dem Ende der Kämpfe
- III. Die Kritik an Kolonisation und Kriegsführung im Kaiserreich.
- 1. Kolonialpolitische Kompetenzen und die Möglichkeiten der Kolonialkritik.
- 2. Die Kritik der SPD an Kolonisation und Kriegsführung
- 2.1. Vorbemerkungen
- 2.2. Erste Reaktionen: Die Kontroversen um die Stimmenthaltung im Reichstag
- 2.3. Die Frage nach den Ursachen des Herero-Aufstands: Der Blick auf die Akteure in der Kolonie.
- 2.3.1. Probleme der Informationsbeschaffung.
- 2.3.2. Das allgemeine Bild von den Kolonisten.
- 2.3.3. Die Händler.
- 2.3.4. Die Misshandlungen an den Afrikanern und das Gerichtswesen in der Kolonie
- 2.3.5. Die Mängel der Verwaltung in der Kolonie.
- 2.3.6. Die Landfrage.
- 2.3.7. Quintessenz: Die deutsche Kolonialpolitik und der „nationale Befreiungskampf“ der Herero
- 2.4. Die Kritik an der deutschen Kriegsführung gegen Herero und Nama.
- 2.4.1. Die ethisch-moralische Argumentation
- 2.4.2. Die ökonomische Argumentation
- 3. Die Entwicklung der Zentrums-Positionen zu Kolonisation und Kriegsführung
- 3.1 Vorbemerkungen.
- 3.2. Erste Reaktionen: Loyalität zu Siedlern und Regierung.
- 3.3. Etappen der Distanzierung von der Kolonialpolitik
- 3.3.1. Die Entschädigungsdebatte.
- 3.3.2. Die ersten Kritikpunkte Peter Spahns an der Kolonialverwaltung
- 3.3.3. Matthias Erzberger zu den Aufständen von Herero und Nama
- 3.3.3.1. Erzberger zur Vernichtungsstrategie des Generals von Trotha
- 3.3.3.2. Grundsätzliches zu Erzbergers Kampagne gegen die bisherige Kolonialpolitik
- 3.3.3.3. Deutsch-Südwestafrika in Erzbergers Kolonialkritik.
- 4. Dernburg, die „Hottentotten-Wahlen“ und die Folgen.
- IV. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Aufstände der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika und die damit verbundene Kolonialkritik im Deutschen Kaiserreich. Ziel ist es, die Ursachen, den Verlauf und die Konsequenzen der Aufstände sowie die Reaktionen der verschiedenen politischen Akteure im Kaiserreich zu analysieren.
- Die Ursachen der Herero- und Nama-Aufstände.
- Der Verlauf der Aufstände und die deutsche Kriegsführung.
- Die Konsequenzen der Aufstände für die Herero und Nama.
- Die Kritik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) an der Kolonialpolitik und Kriegsführung.
- Die Positionen des Zentrums zur Kolonialpolitik und den Aufständen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beschreibt die aktuelle mediale Aufmerksamkeit, die der Herero- und Nama-Aufstand hundert Jahre nach seinem Beginn erfährt. Sie führt in die Thematik ein und erwähnt die brutale deutsche Kriegsführung, die zur systematischen Vernichtung der Herero- und Nama-Bevölkerung führte.
II. Die Aufstände von Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika: Ursachen, Verlauf und Konsequenzen der Ereignisse in der Kolonie: Dieses Kapitel behandelt die Hintergründe, den Ablauf und die Folgen der Aufstände. Es analysiert das „System Leutwein“, die verschiedenen Phasen der Kämpfe, die Rolle von General von Trotha und seine Vernichtungsstrategie, sowie die katastrophalen Bedingungen in den Konzentrationslagern. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Ereignisse in ihrer Gesamtheit und den langfristigen Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung.
III. Die Kritik an Kolonisation und Kriegsführung im Kaiserreich: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen auf die Ereignisse im Deutschen Kaiserreich. Es beleuchtet die unterschiedlichen Positionen von SPD und Zentrum, ihre anfängliche Loyalität und die spätere Entwicklung hin zu kritischeren Standpunkten. Die Kapitel untersuchen die Debatten um die Stimmenthaltung im Reichstag, die Auseinandersetzung mit den Ursachen der Aufstände und die Kritik an der deutschen Kriegsführung, sowohl aus ethisch-moralischen als auch aus ökonomischen Perspektiven. Die Entwicklung der Kritik wird detailliert nachgezeichnet und die jeweiligen Argumentationslinien werden umfassend dargestellt.
Schlüsselwörter
Herero-Aufstand, Nama-Aufstand, Deutsch-Südwestafrika, Kolonialkrieg, Völkermord, Kolonialkritik, SPD, Zentrum, General Lothar von Trotha, Vernichtungsstrategie, Konzentrationslager, Landfrage, Kolonialpolitik, Kaiserreich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Die Aufstände der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika und die Kolonialkritik im Kaiserreich
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Aufstände der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika (1904-1907) und die darauf folgende Kritik an der deutschen Kolonialpolitik und Kriegsführung im Deutschen Kaiserreich. Sie analysiert die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der Aufstände sowie die Reaktionen verschiedener politischer Akteure, insbesondere der SPD und des Zentrums.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Ursachen der Aufstände (z.B. das „System Leutwein“, Landfrage, Misshandlungen), den Verlauf der Kämpfe (einschließlich der Rolle von General von Trotha und seiner Vernichtungsstrategie), die Folgen für die Herero und Nama (Konzentrationslager, systematische Vernichtung), die Kritik der SPD an der Kolonialpolitik und Kriegsführung (ethisch-moralische und ökonomische Argumente), und die Positionen des Zentrums zur Kolonialpolitik und den Aufständen (Anfangsloyalität und spätere Distanzierung).
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist im Haupttext der Magisterarbeit aufgeführt. Die Arbeit stützt sich vermutlich auf historische Dokumente, Zeitungsartikel, politische Reden und sekundärliterarische Quellen, um ein umfassendes Bild der Ereignisse und Reaktionen zu zeichnen.
Welche Akteure werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Rolle verschiedener Akteure, darunter die Herero und Nama, General Lothar von Trotha, die deutsche Kolonialverwaltung, die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), das Zentrum (katholische Partei) und weitere relevante Persönlichkeiten wie Peter Spahn und Matthias Erzberger.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Fazit der Magisterarbeit zusammengefasst. Die Arbeit wird wahrscheinlich zu einem tieferen Verständnis der Ursachen, des Verlaufs und der Folgen der Aufstände und der Bedeutung der Kolonialkritik im Kaiserreich beitragen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über die Aufstände selbst (Ursachen, Verlauf, Folgen), ein Kapitel zur Kolonialkritik im Kaiserreich (SPD und Zentrum), und ein Fazit. Jedes Kapitel ist weiter unterteilt in Unterkapitel, die spezifische Aspekte der Thematik behandeln.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Herero-Aufstand, Nama-Aufstand, Deutsch-Südwestafrika, Kolonialkrieg, Völkermord, Kolonialkritik, SPD, Zentrum, General Lothar von Trotha, Vernichtungsstrategie, Konzentrationslager, Landfrage, Kolonialpolitik, Kaiserreich.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Historiker, Politikwissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Geschichte des deutschen Kolonialismus, die Geschichte Namibias und die Auseinandersetzung mit Kolonialverbrechen interessieren.
- Citation du texte
- Jan Jansen (Auteur), 2004, Die Aufstände von Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika und die Kolonialkritik im Kaiserreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25685