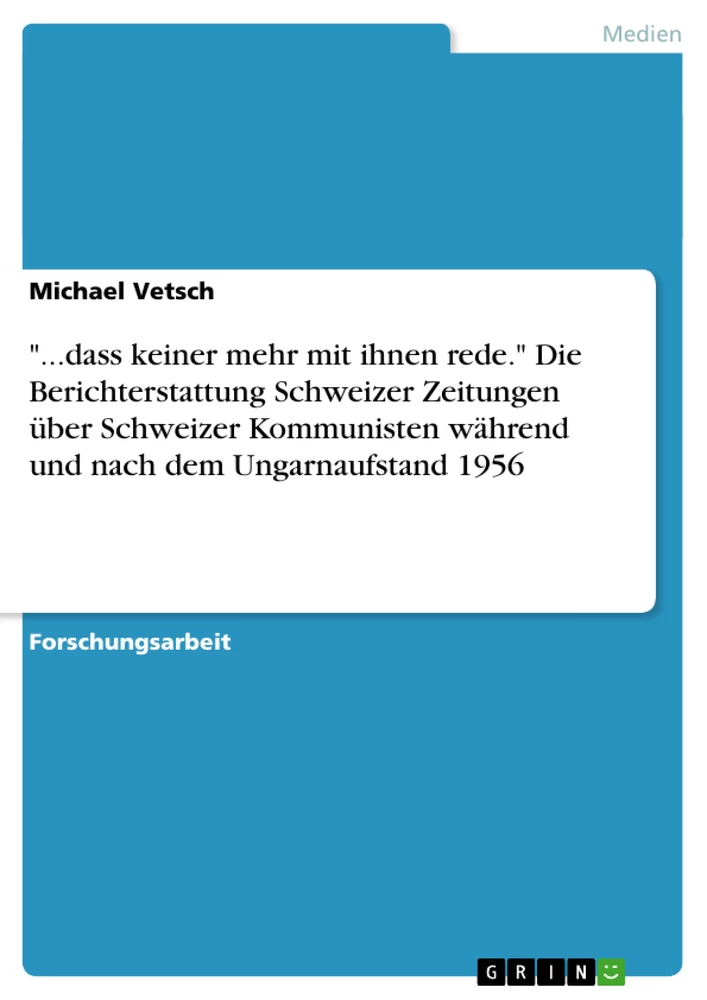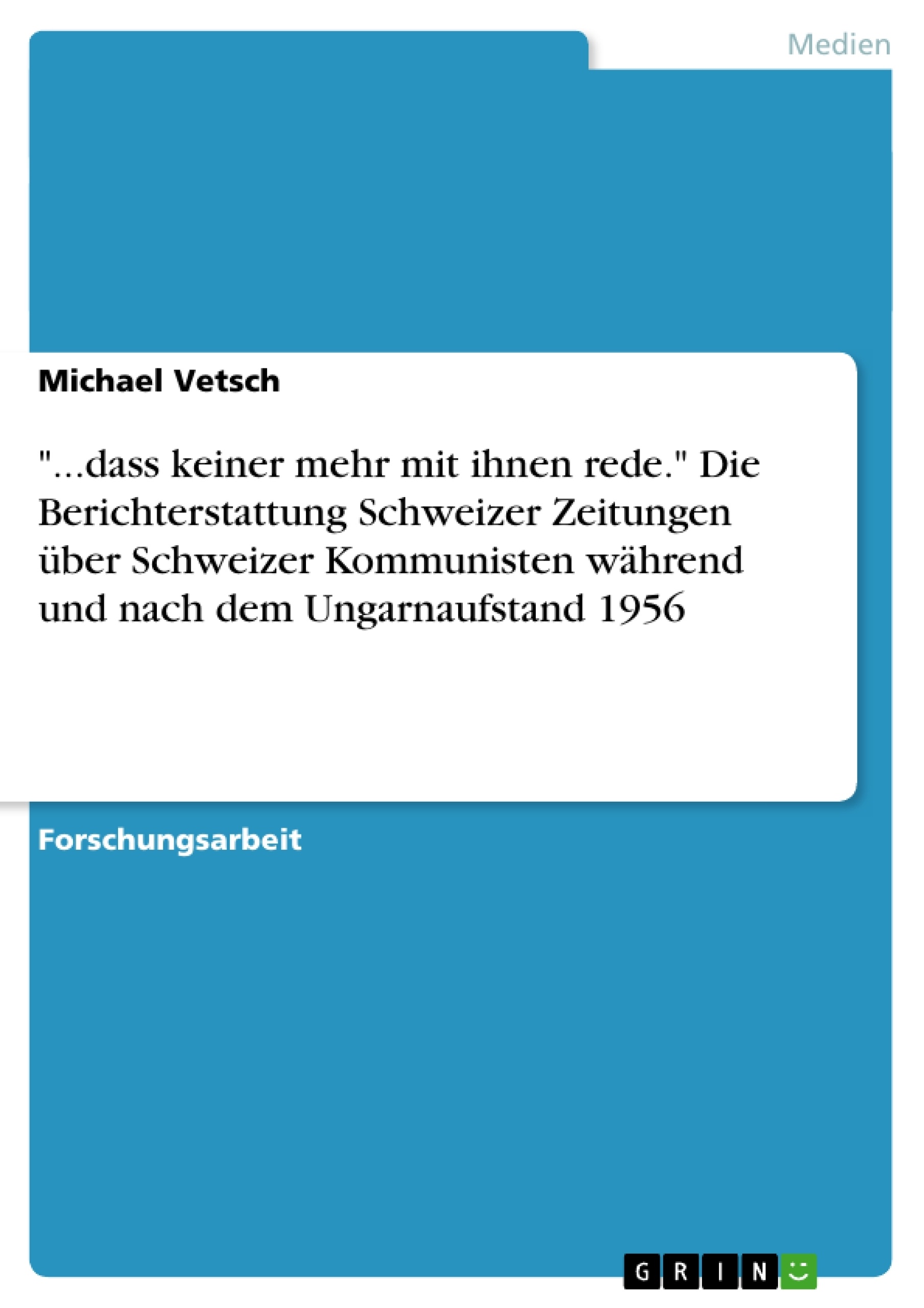Im Sommer 2000 waren einige britische Pädophile Opfer einer medialen Hetzkampagne. Verschiedene Zeitungen veröffentlichten Fotos, Namen und vermutlichen Aufenthaltsort straffällig gewordener Personen. Mit der Forderung nach drakonischer Bestrafung der Delinquenten und immer lauterem Ruf nach Vergeltung heizten die Blätter die Atmosphäre an. Die Folge war ein Lynchjustiz-Klima in Grossbritannien.
Diese hysterischen Szenen muten aus schweizerischer Perspektive auf den ersten Blick befremdend an, scheinen doch solche Hetzjagden gegenüber Minderheiten in der Schweiz undenkbar. Allerdings genügt ein Blick in die jüngere Geschichte des Landes, um zu erkennen, dass auch Personen in der Schweiz schon auf ähnliche Art und Weise ins mediale und öffentliche Fadenkreuz geraten sind. Im Herbst 1956 schlugen sowjetische Truppen die ungarischen Aufständischen nieder, die sich gegen das stalinistische System aufgelehnt hatten. Die Schweizer Regierung, die Parteien und die Medien reagierten einerseits mit riesigen Solidaritäts- und Sympathiebekundungen für das gebeutelte ungarische Volk und andererseits mit einer Welle der Empörung gegen den Kommunismus. Die Wut und den Zorn bekamen besonders jene im Land zu spüren, die sich trotz der blutigen Ereignisse in Ungarn weiter zur kommunistischen Ideologie bekannten und der kommunistischen Partei der Arbeit treu blieben.
Eine massgebliche Rolle spielten bei der Anheizung des antikommunistischen Klimas die damals noch viel stärker an politische Parteien gebundenen Medien. Diese Arbeit hat daher zum Ziel, die Berichterstattung von Schweizer Zeitungen über Schweizer Kommunisten, beziehungsweise über die kommunistische Partei der Arbeit, während und kurze Zeit nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes genauer zu untersuchen. Es stellt sich dabei unter anderem die Frage, ob, und wenn ja inwiefern, sich die sozialdemokratische Presse in der Berichterstattung über den Kommunismus und kommunistische Personen von der bürgerlichen Presse unterschieden hat. Im Hintergrund steht die vom Soziologen Kurt Imhof vertretene Ansicht, dass der Antikommunismus in der heissen Phase des Kalten Krieges – analog dem Antifaschismus der 30er Jahre – das entscheidende, einende Element zwischen den vier grossen Schweizer Parteien war und zu einem Burgfrieden zwischen Sozialdemokratie und Bürgertum sowie zwischen Katholisch-Konservativen und Freisinnigen führte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DIE SCHWEIZ UND DER UNGARNAUFSTAND IM KONTEXT DER ZEIT.
- 2.1 POLITISCHE FOLGEN DER FASCHISTISCHEN BEDROHUNG
- 2.2 DIE GRÜNDUNG DER PARTEI DER ARBEIT
- 2.3 RENAISSANCE DER „GEISTIGEN LANDESVERTEIDIGUNG“
- 2.4 DER ANTIKOMMUNISMUS IN DEN 50ER JAHREN
- 2.5 DER UNGARNAUFSTAND UND DIE HETZJAGD AUF KOMMUNISTEN.
- 3. BESONDERHEITEN MEDIALER KRISENKOMMUNIKATION
- 3.1 VERZERRTE BERICHTERSTATTUNG IN DEN MASSENMEDIEN
- 3.2 MEDIEN IN KRISENZEITEN
- 3.3 DER KALTE KRIEG UND DIE MEDIEN.
- 3.4 UNGARN, DIE SCHWEIZER MEDIEN UND DER AUFBAU DES OST-INSTITUTS.
- 4. EMPIRISCHE ANALYSE DER BERICHTERSTATTUNG IM HERBST 1956
- 4.1 METHODISCHES VORGEHEN
- 4.1.1 Hypothesenbildung
- 4.1.2 Untersuchungsgegenstand.
- 4.1.3 Untersuchungszeitraum......
- 4.1.4 Auswahl des Untersuchungsmaterials
- 4.1.5 Analyseeinheit
- 4.1.6 Kategoriensystem.
- 4.1.7 Reliabilität..
- 4.2 ERGEBNIS HYPOTHESE 1: KAMPAGNENJOURNALISMUS GEGEN DIE PDA.
- 4.3 ERGEBNIS HYPOTHESE 2: INTENSITÄT DER ANTIKOMMUNISTISCHEN ANGRIFFE
- 4.4 ERGEBNIS HYPOTHESE 3: SELEKTIVE ANTIKOMMUNISTISCHE ARTIKULATION.
- 4.5 ERGEBNIS HYPOTHESE 4: KAMPAGNENJOURNALISMUS GEGEN DAS ESTABLISHMENT…....
- 4.6 ERGEBNIS HYPOTHESE 5: INTENSITÄT DER KOMMUNISTISCHEN ANGRIFFE
- 4.7 ERGEBNIS HYPOTHESE 6: SELEKTIVE KOMMUNISTISCHE ARTIKULATION
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Berichterstattung Schweizer Zeitungen über Schweizer Kommunisten und die Partei der Arbeit während und nach dem Ungarnaufstand 1956. Das Hauptziel ist es, Unterschiede in der Berichterstattung zwischen der bürgerlichen und der sozialdemokratischen Presse zu analysieren. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Medien zum antikommunistischen Klima beitrugen und ob und wie sich die Darstellung des Kommunismus und kommunistischer Personen zwischen den verschiedenen Presseorganen unterschied.
- Medienberichterstattung während Krisenzeiten
- Der Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinung
- Vergleichende Analyse der Berichterstattung in bürgerlichen und sozialdemokratischen Zeitungen
- Die Rolle des Anti-Kommunismus in der Schweizer Gesellschaft der 1950er Jahre
- Der Ungarnaufstand und seine Auswirkungen auf die Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie einen Vergleich zwischen einer britischen Hetzkampagne gegen Pädophile und der Reaktion der Schweizer Medien auf den Ungarnaufstand 1956 zieht. Sie hebt die Parallele der medialen Hetzjagd hervor und benennt die zentrale Forschungsfrage: Wie unterschiedlich berichteten bürgerliche und sozialdemokratische Zeitungen über den Kommunismus und die Partei der Arbeit in der Schweiz während und nach dem Aufstand? Der Fall Konrad Farners wird als Beispiel für die antikommunistische Stimmung genannt.
2. Die Schweiz und der Ungarnaufstand im Kontext der Zeit: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext des Ungarnaufstandes und dessen Auswirkungen auf die Schweiz. Es beleuchtet die politischen Folgen der faschistischen Bedrohung, die Gründung der Partei der Arbeit, die Renaissance der „geistigen Landesverteidigung“ und den Anti-Kommunismus in den 1950er Jahren. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des politischen Klimas in der Schweiz und wie es den Boden für die antikommunistische Hetzjagd bereitete. Die Niederschlagung des Aufstandes wird als Katalysator für die antikommunistischen Reaktionen in der Schweiz dargestellt.
3. Besonderheiten medialer Krisenkommunikation: Dieses Kapitel analysiert die Besonderheiten der Medienberichterstattung in Krisenzeiten, insbesondere im Kontext des Kalten Krieges. Es beleuchtet die verzerrte Berichterstattung in den Massenmedien und die Rolle der Medien beim Aufbau des Ost-Instituts. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der methodischen Herangehensweise der empirischen Analyse der folgenden Kapitel. Die spezifischen Herausforderungen der Berichterstattung in Zeiten politischer Konflikte werden hier im Detail beleuchtet.
4. Empirische Analyse der Berichterstattung im Herbst 1956: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse der Berichterstattung in verschiedenen Schweizer Zeitungen über den Ungarnaufstand und die Partei der Arbeit. Es beschreibt die methodischen Schritte, einschließlich Hypothesenbildung, Untersuchungsgegenstand und -methoden. Die Analyse konzentriert sich auf die Unterschiede in der Darstellung des Kommunismus, der Parteien und der Emotionalisierung der Berichterstattung zwischen bürgerlichen und sozialdemokratischen Zeitungen. Konkrete Beispiele aus den untersuchten Zeitungen werden analysiert und verglichen, um die Hypothesen zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Ungarnaufstand 1956, Schweiz, Medienberichterstattung, Partei der Arbeit (PdA), Anti-Kommunismus, Kalter Krieg, bürgerliche Presse, sozialdemokratische Presse, Kampagnenjournalismus, Emotionalisierung, Diffamierung, empirische Analyse, vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Schweizer Medienberichterstattung über den Ungarnaufstand 1956 und die Partei der Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Berichterstattung Schweizer Zeitungen über den Ungarnaufstand 1956 und die Rolle der Schweizer Kommunisten und der Partei der Arbeit (PdA) in dieser Berichterstattung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der Berichterstattung in bürgerlichen und sozialdemokratischen Medien.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht, wie sich die Berichterstattung über den Kommunismus und die PdA in bürgerlichen und sozialdemokratischen Schweizer Zeitungen während und nach dem Ungarnaufstand unterschied. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie die Medien zum antikommunistischen Klima beitrugen.
Welche Zeitungen wurden untersucht?
Die Arbeit benennt zwar nicht explizit die untersuchten Zeitungen, aber es wird deutlich, dass der Fokus auf dem Vergleich zwischen bürgerlichen und sozialdemokratischen Presseorganen liegt. Die Auswahl der Zeitungen und die Methodik der Auswahl werden im Kapitel 4.1 detailliert beschrieben.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Analyse der Medienberichterstattung. Das Kapitel 4.1 beschreibt die methodischen Schritte im Detail: Hypothesenbildung, Untersuchungsgegenstand und -zeitraum, Auswahl des Materials, Analyseeinheit, Kategoriensystem und die Sicherung der Reliabilität der Ergebnisse.
Welche Hypothesen wurden untersucht?
Die Arbeit formuliert mehrere Hypothesen, die sich auf den Kampagnenjournalismus gegen die PdA und das Establishment, die Intensität anti- und prokommunistischer Angriffe sowie die selektive Artikulation in der Berichterstattung beziehen. Die Ergebnisse zur Überprüfung dieser Hypothesen werden in den Abschnitten 4.2 bis 4.7 präsentiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Analyse zeigen Unterschiede in der Berichterstattung zwischen bürgerlichen und sozialdemokratischen Zeitungen auf. Konkrete Ergebnisse zu den einzelnen Hypothesen sind in den Kapiteln 4.2 bis 4.7 zu finden. Die Analyse konzentriert sich auf die Unterschiede in der Darstellung des Kommunismus, der Parteien und die Emotionalisierung der Berichterstattung.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den historischen Kontext des Ungarnaufstandes und dessen Auswirkungen auf die Schweiz, einschließlich der politischen Folgen der faschistischen Bedrohung, der Gründung der PdA, der „geistigen Landesverteidigung“ und des Anti-Kommunismus in den 1950er Jahren. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des politischen Klimas und der antikommunistischen Stimmung in der Schweiz.
Welche Rolle spielten die Medien im Kontext des Kalten Krieges?
Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten medialer Krisenkommunikation im Kalten Krieg, die verzerrte Berichterstattung und die Rolle der Medien beim Aufbau des Ost-Instituts. Sie analysiert den Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinung und die Herausforderungen der Berichterstattung in Zeiten politischer Konflikte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Ungarnaufstand 1956, Schweiz, Medienberichterstattung, Partei der Arbeit (PdA), Anti-Kommunismus, Kalter Krieg, bürgerliche Presse, sozialdemokratische Presse, Kampagnenjournalismus, Emotionalisierung, Diffamierung, empirische Analyse, vergleichende Analyse.
- Quote paper
- Michael Vetsch (Author), 2002, "...dass keiner mehr mit ihnen rede." Die Berichterstattung Schweizer Zeitungen über Schweizer Kommunisten während und nach dem Ungarnaufstand 1956, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25572