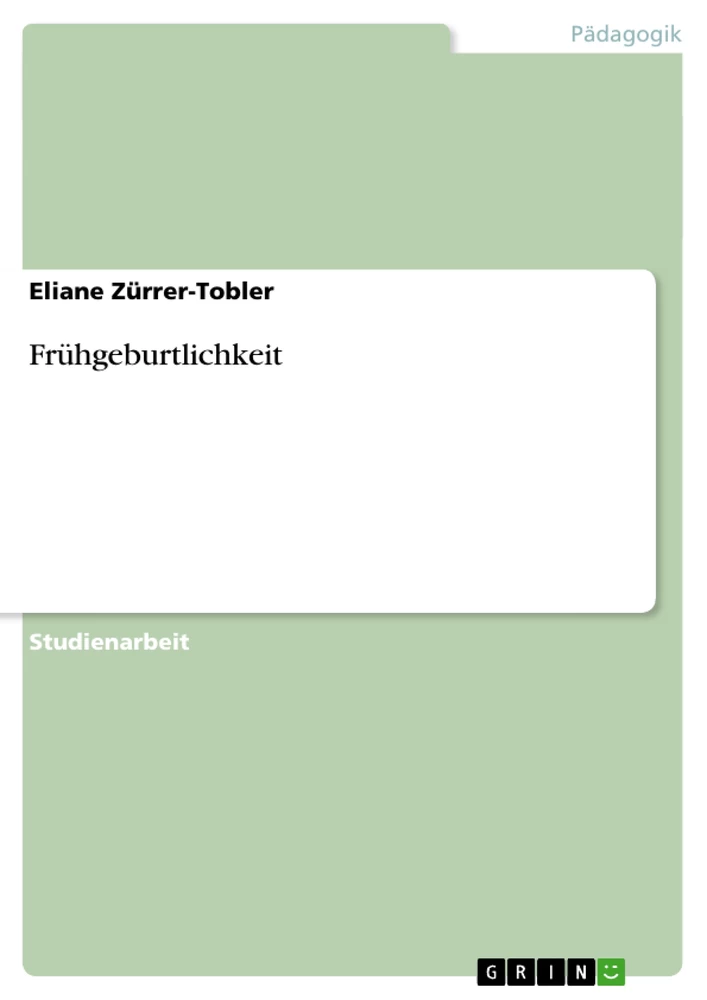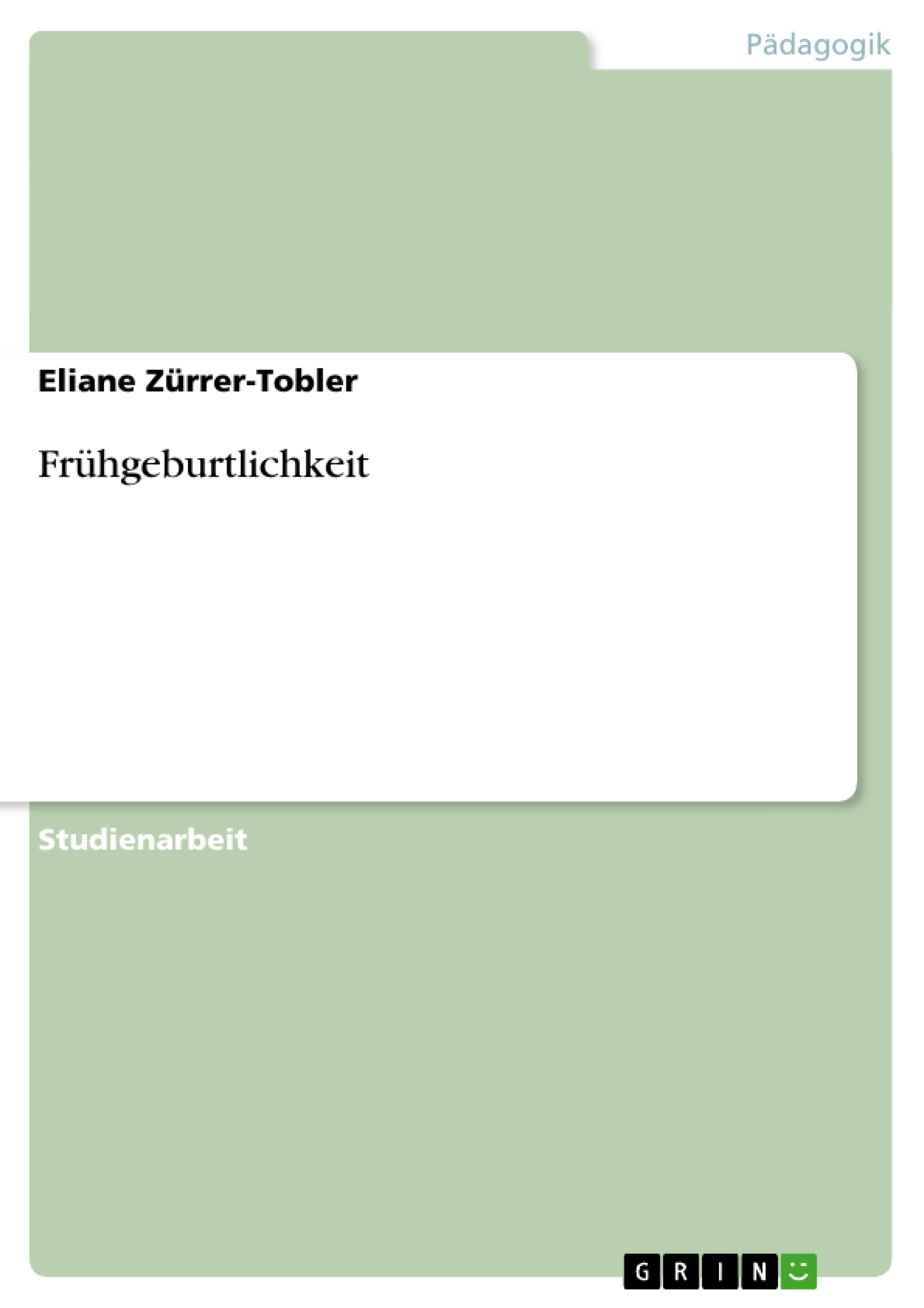Verschiedene Ursache führen dazu, dass ca. vier bis neun Prozent aller Kinder vor der 38. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Diese Frühgeborenen Kinder haben heutzutage bereits ab der 22. Schwangerschaftswoche Chancen zu überleben. Aufgrund der Unreife der Lunge haben die meisten Frühchen Probleme mit dem Atmen, was die Sauerstoffversorgung verschiedener Organe gefährdet. Das unreife Gehirn ist für viele andere Störungen verantwortlich. Behinderungen sind deshalb oft der Preis für das Überleben. Es gilt, je kleiner das Frühgeborene, desto grösser das Risiko einer Behinderung. Nebst den offensichtlichen körperlichen und geistigen Behinderungen, muss man heutzutage vermehrt feststellen, dass Frühgeburtlichkeit auch massive Folgen auf psychosozialer und emotionaler Ebene habe kann. Laut verschiedenen Studien weisen Frühgeborene signifikant häufiger Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Probleme und hyperkinetische Symptome auf als reifgeborene Kinder. Auch in der Schule haben Frühgeborene Kinder massive Probleme. Verschiedene Belastungen, die eine Frühgeburt mit sich bringt, können die Eltern- Kind Beziehung stark beeinträchtigen. Gerade diese Beziehung ist jedoch für die Entwicklung des Kindes sehr wichtig.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten um die Folgen der zu frühen Geburt zu minimieren. Vor allem auf physiotherapeutischer Ebene gibt es viele Methoden, z. B . das ‚Känguruhn’, Bobath, Vojta, Sensorische Integrationstherapie, Basale Stimulation etc. Weiter gibt es die auditive Stimulation oder die Interaktive Frühförderung nach Sarimski. Behinderte Frühgeborene Kinder werden im Rahmen der heilpädagogischen Früherziehung gefördert. Doch nicht nur behinderte Frühgeborene, sondern der gesamte Bereich der Frühgeburtlichkeit ist für die Sonderpädagogik relevant. Denn Frühgeborene sind Risikokinder und bedürfen spezieller Förderung.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Epidemiologie
- 3. Die biologisch-medizinische Entwicklung des Frühgeborenen
- 3.1 Respiratorische Erkrankungen
- 3.2 Zentrales Nervensystem (Gehirn)
- 3.3 Immunsystem
- 3.4 Magendarmsystem
- 3.5 Behinderungen
- 4. Psychosozial emotionale Entwicklung des Frühgeborenen
- 4.2 Die Schulische Entwicklung des Frühgeborenen
- 5. Die Situation der Eltern
- 6.1 Belastungsaspekte
- 6.2 Eltern-Kind-Beziehung
- 6. Therapie
- 6.1 Physiotherapie
- 6.1.1 Känguruh Methode
- 6.1.2 Die Bobath und Vojta Methoden
- 6.1.3 Sensorische Integrationstherapie
- 6.1.4 Minihandling
- 6.2 Auditive Stimulation
- 6.1 Physiotherapie
- 7. Die Rolle der Sonderpädagogik
- 7.1 Frühgeburt: Eine interdisziplinäre Aufgabe
- 7.2 Beratung und Betreuung auf der Neonatologie
- 7.3 Sonderpädagogische Aufgaben auf der Neonatologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Folgen von Frühgeburtlichkeit, die angewendeten Therapien und die Rolle der Sonderpädagogik. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten im Umgang mit Frühgeborenen zu entwickeln.
- Mögliche körperliche und psychosoziale Folgen von Frühgeburtlichkeit
- Anwendbare Therapien und Fördermaßnahmen
- Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit, insbesondere die Rolle der Sonderpädagogik
- Belastung der Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung
- Langfristige Entwicklungsperspektiven von Frühgeborenen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Frühgeburtlichkeit ein und formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit: Welche Folgen hat Frühgeburtlichkeit? Welche Therapien werden angewendet? Welche Rolle spielt die Sonderpädagogik? Die Autorin beschreibt ihr persönliches Interesse an der Thematik und skizziert den Aufbau der Arbeit, wobei sie die verschiedenen Kapitel und deren Inhalt kurz vorstellt.
2. Definition und Epidemiologie: Dieses Kapitel definiert den Begriff Frühgeburtlichkeit und beleuchtet die Häufigkeit des Auftretens. Es werden verschiedene Kategorien von Frühgeburten nach Schwangerschaftswoche und Geburtsgewicht unterschieden (z.B. sehr frühe Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht). Die Überlebenschancen von Frühgeborenen werden anhand von aktuellen Daten dargestellt, und der Apgar-Index als Maßstab für die Beurteilung des Allgemeinzustands des Neugeborenen wird eingeführt.
3. Die biologisch-medizinische Entwicklung des Frühgeborenen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die medizinischen Aspekte der Entwicklung von Frühgeborenen. Es werden häufige gesundheitliche Probleme wie respiratorische Erkrankungen, Probleme des zentralen Nervensystems, des Immunsystems und des Magendarmsystems erläutert. Besonderes Augenmerk liegt auf den möglichen Behinderungen, die als Folge der Frühgeburt auftreten können, und deren Ausmaß in Abhängigkeit vom Schwangerschaftsalter und Geburtsgewicht.
4. Psychosozial emotionale Entwicklung des Frühgeborenen: Dieser Abschnitt behandelt die psychosoziale und emotionale Entwicklung von Frühgeborenen. Es werden mögliche Auswirkungen der Frühgeburt auf die Entwicklung des Kindes in diesen Bereichen beschrieben, beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Schwierigkeiten und hyperkinetische Symptome. Auch die schulische Entwicklung wird im Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit betrachtet.
5. Die Situation der Eltern: Das Kapitel beleuchtet die Situation der Eltern von Frühgeborenen. Es werden verschiedene Belastungsfaktoren beschrieben, denen sich Eltern nach der Frühgeburt ausgesetzt sehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung für die Entwicklung des Kindes im Kontext einer Frühgeburt.
6. Therapie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Therapiemöglichkeiten für Frühgeborene. Es werden physiotherapeutische Methoden wie die Känguruh-Methode, Bobath, Vojta und die Sensorische Integrationstherapie vorgestellt. Auch die auditive Stimulation wird als therapeutische Maßnahme erwähnt. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ansätzen, um die negativen Folgen der Frühgeburt zu minimieren und die Entwicklung des Kindes zu unterstützen.
7. Die Rolle der Sonderpädagogik: Der letzte thematische Abschnitt konzentriert sich auf die Rolle der Sonderpädagogik im Umgang mit Frühgeborenen. Die Autorin betont die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Bedeutung der sonderpädagogischen Beratung und Betreuung, sowohl auf der Neonatologie als auch im weiteren Verlauf der Entwicklung des Kindes. Frühgeborene werden als Risikokinder betrachtet, die einer speziellen Förderung bedürfen.
Schlüsselwörter
Frühgeburtlichkeit, Folgen, Therapien, Sonderpädagogik, Entwicklung, Behinderungen, Eltern-Kind-Beziehung, Risikokinder, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Neonatologie, Physiotherapie, auditive Stimulation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Folgen von Frühgeburtlichkeit"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit den Folgen von Frühgeburtlichkeit, den angewendeten Therapien und der Rolle der Sonderpädagogik. Sie untersucht mögliche körperliche und psychosoziale Folgen, anwendbare Therapien und Fördermaßnahmen, die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit, die Belastung der Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung sowie langfristige Entwicklungsperspektiven von Frühgeborenen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition und Epidemiologie von Frühgeburten, biologisch-medizinische Entwicklung des Frühgeborenen, psychosoziale und emotionale Entwicklung des Frühgeborenen, die Situation der Eltern, Therapiemöglichkeiten und die Rolle der Sonderpädagogik.
Was wird unter "biologisch-medizinische Entwicklung des Frühgeborenen" verstanden?
Dieses Kapitel behandelt häufige gesundheitliche Probleme bei Frühgeborenen wie respiratorische Erkrankungen, Probleme des zentralen Nervensystems, des Immunsystems und des Magendarmsystems sowie mögliche daraus resultierende Behinderungen. Der Schweregrad wird mit dem Schwangerschaftsalter und Geburtsgewicht in Verbindung gebracht.
Wie wird die psychosoziale und emotionale Entwicklung von Frühgeborenen betrachtet?
Der Abschnitt beleuchtet mögliche Auswirkungen der Frühgeburt auf die psychosoziale und emotionale Entwicklung, einschließlich des Risikos für Aufmerksamkeitsprobleme, soziale Schwierigkeiten und hyperkinetische Symptome. Die schulische Entwicklung im Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit wird ebenfalls untersucht.
Welche Belastungen erfahren die Eltern von Frühgeborenen?
Das Kapitel beschreibt verschiedene Belastungsfaktoren für Eltern von Frühgeborenen und betont die Wichtigkeit der Eltern-Kind-Beziehung für die kindliche Entwicklung im Kontext einer Frühgeburt.
Welche Therapien werden für Frühgeborene eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, darunter physiotherapeutische Methoden wie die Känguruh-Methode, Bobath, Vojta und sensorische Integrationstherapie sowie auditive Stimulation. Der Fokus liegt auf der Minimierung negativer Folgen und der Entwicklungsförderung.
Welche Rolle spielt die Sonderpädagogik?
Der letzte Abschnitt betont die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Bedeutung der sonderpädagogischen Beratung und Betreuung von Frühgeborenen, sowohl auf der Neonatologie als auch später. Frühgeborene werden als Risikokinder mit speziellem Förderbedarf betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Frühgeburtlichkeit, Folgen, Therapien, Sonderpädagogik, Entwicklung, Behinderungen, Eltern-Kind-Beziehung, Risikokinder, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Neonatologie, Physiotherapie, auditive Stimulation.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von der Definition und Epidemiologie. Anschließend werden die biologisch-medizinische und psychosoziale Entwicklung behandelt. Die Situation der Eltern und verschiedene Therapien werden erläutert, bevor die Rolle der Sonderpädagogik im letzten Kapitel beleuchtet wird. Die Arbeit beinhaltet eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Inhaltsverzeichnis.
- Quote paper
- lic. phil. Eliane Zürrer-Tobler (Author), 2004, Frühgeburtlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25518