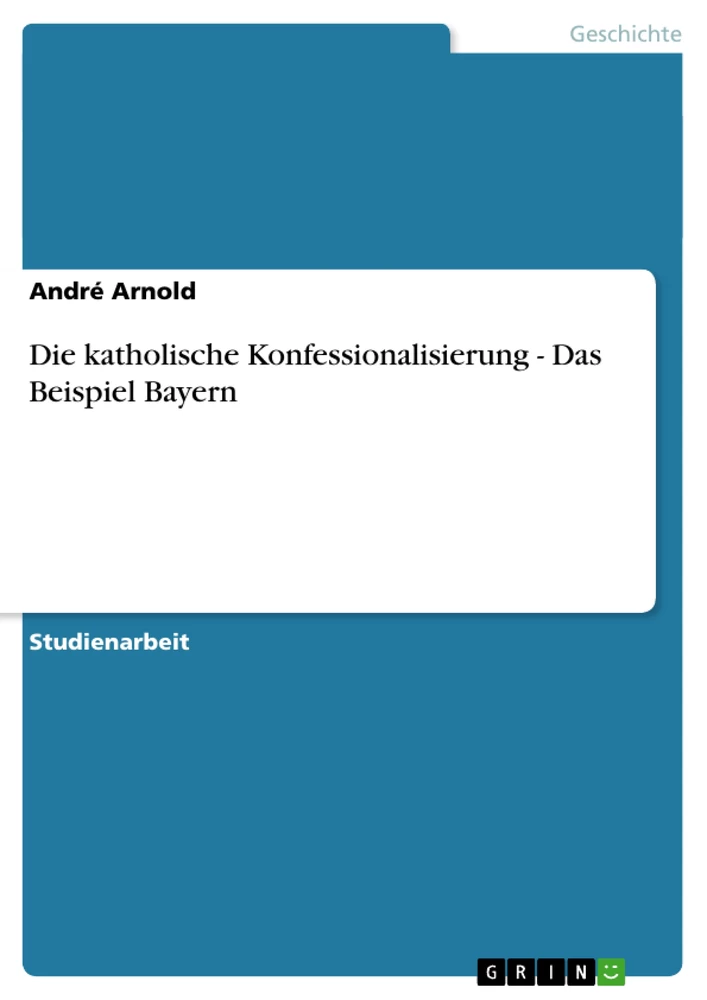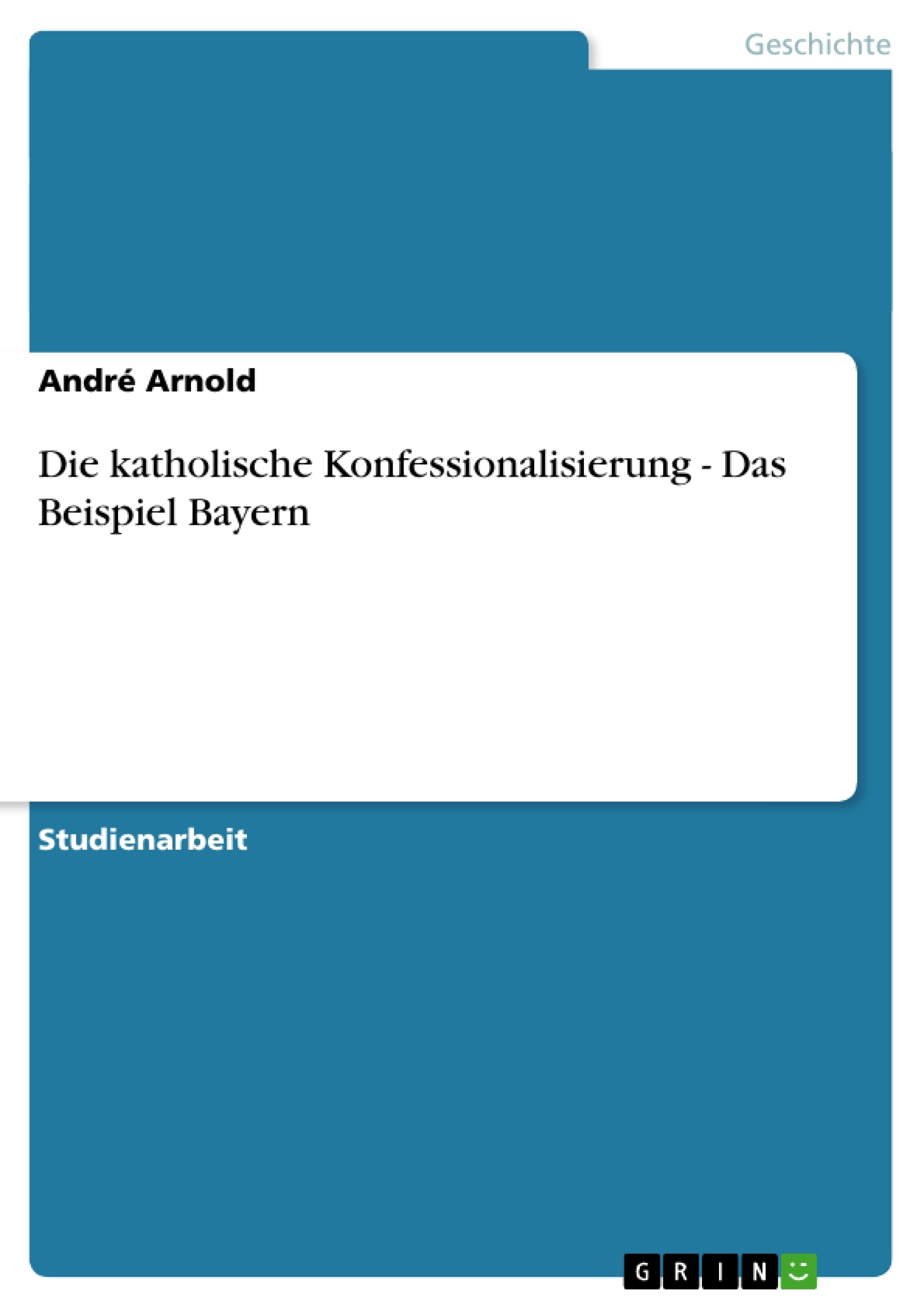Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Gründe, Methoden und Ergebnisse der am Anfang
des 16. Jahrhundert einsetzenden katholischen Konfessionalisierung, fokussiert auf das
Herzogtum Bayern, herauszuarbeiten. Ausgehend von den 1520er Jahren soll der Verlauf des
Konfessionalisierungsprozesses bis zur Herrschaft von Herzog Maximilian I. dargestellt
werden. Dabei sind die zu verschiedenen Zeiten aufgetretenen reformatorischen Bewegungen
in bezug auf Zustandekommen, Verbreitung im und Auswirkung auf das Herzogtum, sowie
die daraufhin getroffenen Maßnahmen zu untersuchen. Festzustellen ist außerdem, warum
gerade Bayern, in einer Zeit in der die Auswirkungen der Reformation überall in Deutschland
zu spüren waren, im Vergleich zum Beispiel zum Kurfürstentum Sachsen, nur wenig von
diesen reformatorischen Bestrebungen beeinflusst wurde bzw. warum sich diese nicht
weitläufig verbreiten und fest etablieren konnten. Schließlich sind noch Ausmaß und Ergebnis
der Konfessionalisierungsmaßnahmen außerhalb des Herzogtums zu klären.
Von dem in früheren Zeiten der Geschichtsschreibung und zum Teil auch noch in neuerer
Literatur verwendeten Begriff der Gegenreformation1 wird dabei abgesehen. Zum Einen, weil
Reformation und Gegenreformation zeitlich parallele Vorgänge waren, zum anderen, da die
Gegenreformation eigentlich auch eine Reformation war, oder anders ausgedrückt eine
Katholische Reform. Diese eben war nicht nur „reaktionär“, wie es mit dem Begriff der
Gegenreformation schon assoziiert werden würde, sondern in einem gewissen Rahmen auch
„innovativ“2, was vorher nur der eigentlichen Reformation zugesprochen wurde. Als
Beispiele seien hierzu Spanien und Italien aufgeführt, wo schon gegen Ende des 15. [...]
1 Siehe z.B. Lutz, Heinrich: Reformation und Gegenreformation (= OGG, Bd. 10), München 1997.
2 Die Begriffe beruhen auf der im 19. Jh. geschaffenen Dreiteilung der Frühneuzeitforschung in: innovative
Reformation, reaktionäre Gegenreformation und konfessionsneutraler Absolutismus – vgl. Völker-Rasor,
Anette (Hrsg.): Frühe Neuzeit (=Oldenburg Lehrbuch Geschichte), München 2000, S. 299. Zu näherer Kritik
an dem Begriff Gegenreformation siehe: Reinhard, Wolfgang: Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena
zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters, In: ZHF 10 (1983), S. 257-277. oder Burckhardt, Johannes:
Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution und Institutionenbildung
1517-1617, Stuttgart 2002, S. 77ff.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Katholische Konfessionalisierung von den Anfängen bis 1563/64
- II.1. Erste evangelische Bewegung und Positionierung der Regierung
- II.2. Vom Augsburger Reichstag 1530 zum Religionsfrieden 1555
- II.3. Zweite evangelische Bewegung und die Anfänge von Albrecht V.
- III. Die Konfessionalisierungshelfer: Tridentinum und Jesuitenorden
- III.1. Das Tridentinum
- III.2. Der Jesuitenorden
- IV. Bayern auf dem Weg zur Vormacht der katholischen Konfessionalisierung
- IV.1. Einfluss Bayerns in Österreich
- IV.2. Bayern und Rom
- IV.3. Das Ende der Regierungszeit von Albrecht V.
- V. Konfessionalisierung unter Wilhelm V. und Maximilian I.
- V.1. Wilhelm V. (1579-1598)
- V.2. Maximilian I., Donauwörth und die Liga
- V.3. Jülicher Erbfolgekrieg und Auflösung der Liga
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe, Methoden und Ergebnisse der katholischen Konfessionalisierung im Herzogtum Bayern vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis zur Herrschaft Herzog Maximilians I. Der Fokus liegt auf dem Verlauf des Konfessionalisierungsprozesses, den reformatorischen Bewegungen und den daraufhin getroffenen Maßnahmen. Es wird untersucht, warum Bayern im Vergleich zu anderen Gebieten Deutschlands nur wenig von der Reformation beeinflusst wurde. Abschließend wird das Ausmaß und das Ergebnis der Konfessionalisierungsmaßnahmen außerhalb Bayerns beleuchtet.
- Die Ursachen und der Verlauf der katholischen Konfessionalisierung in Bayern.
- Die Rolle reformatorischer Bewegungen und deren Auswirkungen auf Bayern.
- Der Vergleich Bayerns mit anderen deutschen Gebieten bezüglich der Reformationsauswirkungen.
- Die Maßnahmen der bayerischen Regierung zur Durchsetzung der katholischen Konfession.
- Die Auswirkung der bayerischen Konfessionalisierungspolitik auf andere Regionen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung legt die Zielsetzung der Arbeit dar: die Analyse der katholischen Konfessionalisierung in Bayern von ihren Anfängen bis zur Herrschaft Maximilians I. Es wird der Begriff "Konfessionalisierung" dem Begriff "Gegenreformation" vorgezogen und die Notwendigkeit einer Erneuerung der katholischen Kirche im Angesicht der Reformation begründet. Die Einleitung skizziert die Forschungsfragen und den methodischen Ansatz der Arbeit.
II. Katholische Konfessionalisierung von den Anfängen bis 1563/64: Dieses Kapitel beschreibt die ersten Phasen der katholischen Konfessionalisierung in Bayern. Es analysiert die ersten evangelischen Bewegungen, die Positionierung der bayerischen Regierung, den Einfluss des Wormser Edikts von 1521 und die frühen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Luthertums. Die Rolle von Persönlichkeiten wie Johann Eck wird beleuchtet, und die unterschiedlichen Meinungen zum Beginn des Konfessionalisierungsprozesses werden diskutiert. Das Kapitel zeigt, wie die bayerischen Herzöge frühzeitig und entschieden gegen die Reformation vorgingen.
III. Die Konfessionalisierungshelfer: Tridentinum und Jesuitenorden: Dieses Kapitel behandelt die Rolle des Konzils von Trient und des Jesuitenordens bei der katholischen Konfessionalisierung. Es beschreibt die Reformen des Konzils und die Aktivitäten des Jesuitenordens in Bayern zur Stärkung des Katholizismus. Die Bedeutung beider Institutionen für die erfolgreiche Durchsetzung der katholischen Konfession in Bayern wird analysiert und ihre jeweiligen Strategien und Methoden zur Bekämpfung der Reformation werden dargelegt. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung von institutionellen Reformen für die katholische Erneuerung.
IV. Bayern auf dem Weg zur Vormacht der katholischen Konfessionalisierung: Dieses Kapitel untersucht den wachsenden Einfluss Bayerns in der katholischen Konfessionalisierung, insbesondere seine Beziehungen zu Österreich und Rom. Es analysiert die Rolle Bayerns bei der Durchsetzung der katholischen Konfession und die innenpolitischen Entwicklungen unter Albrecht V.. Die Kapitel beschreibt die strategischen Allianzen und die Maßnahmen, mit denen Bayern seine Position als führende Macht im katholischen Lager festigte. Es beleuchtet die Rolle Bayerns in der Gegenbewegung zur Reformation.
V. Konfessionalisierung unter Wilhelm V. und Maximilian I.: Dieses Kapitel setzt die Analyse der Konfessionalisierung unter den Nachfolgern Albrecht V. fort. Es analysiert die Regierungszeiten von Wilhelm V. und Maximilian I. und deren jeweilige Beiträge zum Prozess der katholischen Konfessionalisierung. Der Fokus liegt auf den Maßnahmen zur Festigung des Katholizismus, auf bedeutenden Ereignissen wie der Auseinandersetzung um Donauwörth und dem Jülicher Erbfolgekrieg, und deren Einfluss auf die Konfessionalisierungspolitik. Die Kapitel analysiert die Entwicklung der Konfessionalisierung während einer Phase der politischen und religiösen Instabilität.
Schlüsselwörter
Katholische Konfessionalisierung, Bayern, Reformation, Gegenreformation, Jesuitenorden, Tridentinum, Albrecht V., Wilhelm V., Maximilian I., Religionspolitik, Konfessionskampf, Wormser Edikt.
Häufig gestellte Fragen zum Text über die Katholische Konfessionalisierung in Bayern
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert die katholische Konfessionalisierung im Herzogtum Bayern vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis zur Herrschaft Herzog Maximilians I. Er untersucht die Gründe, Methoden und Ergebnisse dieses Prozesses, die Rolle reformatorischer Bewegungen und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen der bayerischen Regierung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich Bayerns mit anderen deutschen Gebieten bezüglich der Auswirkungen der Reformation.
Welche Zeitspanne wird im Text behandelt?
Der Text umfasst die Zeit vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis zur Herrschaft Herzog Maximilians I. Dies beinhaltet die ersten Phasen der Reformation und die darauf folgende Gegenreformation in Bayern.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Ursachen und der Verlauf der katholischen Konfessionalisierung in Bayern, die Rolle reformatorischer Bewegungen und deren Auswirkungen, der Vergleich Bayerns mit anderen deutschen Gebieten, die Maßnahmen der bayerischen Regierung zur Durchsetzung des Katholizismus und die Auswirkung der bayerischen Konfessionalisierungspolitik auf andere Regionen.
Welche Personen spielen eine wichtige Rolle im Text?
Wichtige Persönlichkeiten sind die bayerischen Herzöge Albrecht V., Wilhelm V. und Maximilian I., sowie Johann Eck. Der Text beleuchtet deren Rolle bei der Durchsetzung der katholischen Konfession.
Welche Institutionen werden im Kontext der Konfessionalisierung behandelt?
Der Text behandelt das Konzil von Trient und den Jesuitenorden als wichtige Akteure der katholischen Konfessionalisierung. Ihre Reformen und Strategien zur Bekämpfung der Reformation werden analysiert.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln, die die verschiedenen Phasen der Konfessionalisierung behandeln. Jedes Kapitel fasst seine Ergebnisse zusammen. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welcher Begriff wird dem Begriff "Gegenreformation" vorgezogen und warum?
Der Text bevorzugt den Begriff "Konfessionalisierung" gegenüber "Gegenreformation", um den Prozess der Festigung und Erneuerung der katholischen Kirche im Angesicht der Reformation präziser zu beschreiben.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text analysiert das Ausmaß und das Ergebnis der Konfessionalisierungsmaßnahmen in Bayern und deren Auswirkungen auf andere Gebiete. Er zeigt, wie Bayern frühzeitig und entschieden gegen die Reformation vorging und eine führende Rolle in der katholischen Gegenbewegung einnahm. Die genauen Schlussfolgerungen sind in dem Kapitel "Fazit" zusammengefasst, welches im vorliegenden Auszug nicht enthalten ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Katholische Konfessionalisierung, Bayern, Reformation, Gegenreformation, Jesuitenorden, Tridentinum, Albrecht V., Wilhelm V., Maximilian I., Religionspolitik, Konfessionskampf, Wormser Edikt.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für akademische Zwecke bestimmt, um die Themen der katholischen Konfessionalisierung in Bayern zu analysieren. Er eignet sich für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
- Quote paper
- André Arnold (Author), 2003, Die katholische Konfessionalisierung - Das Beispiel Bayern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25494