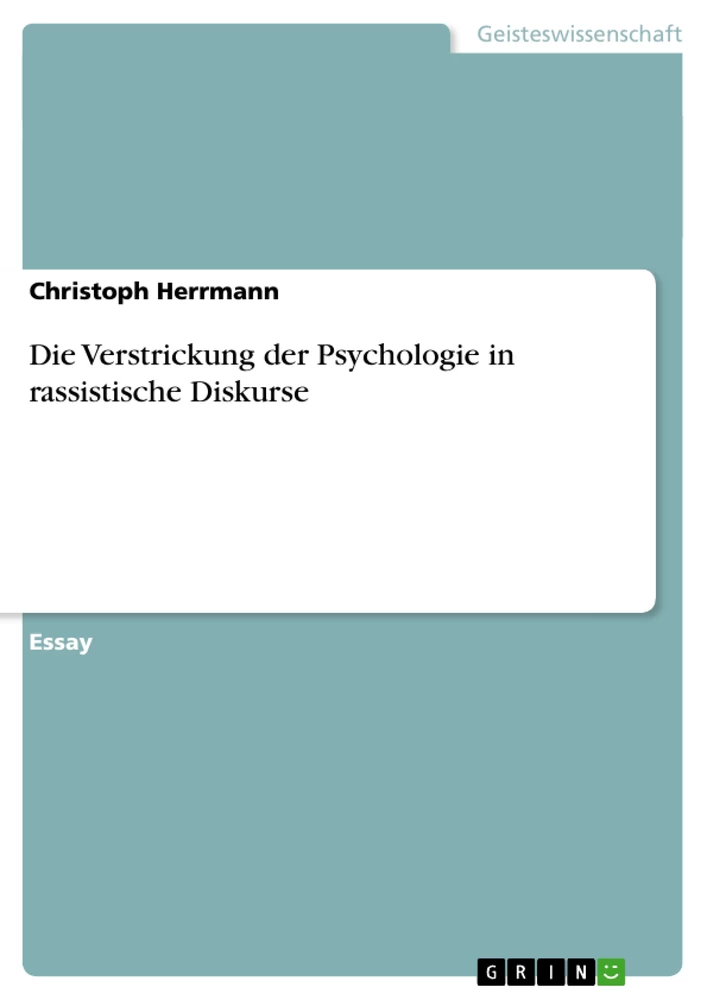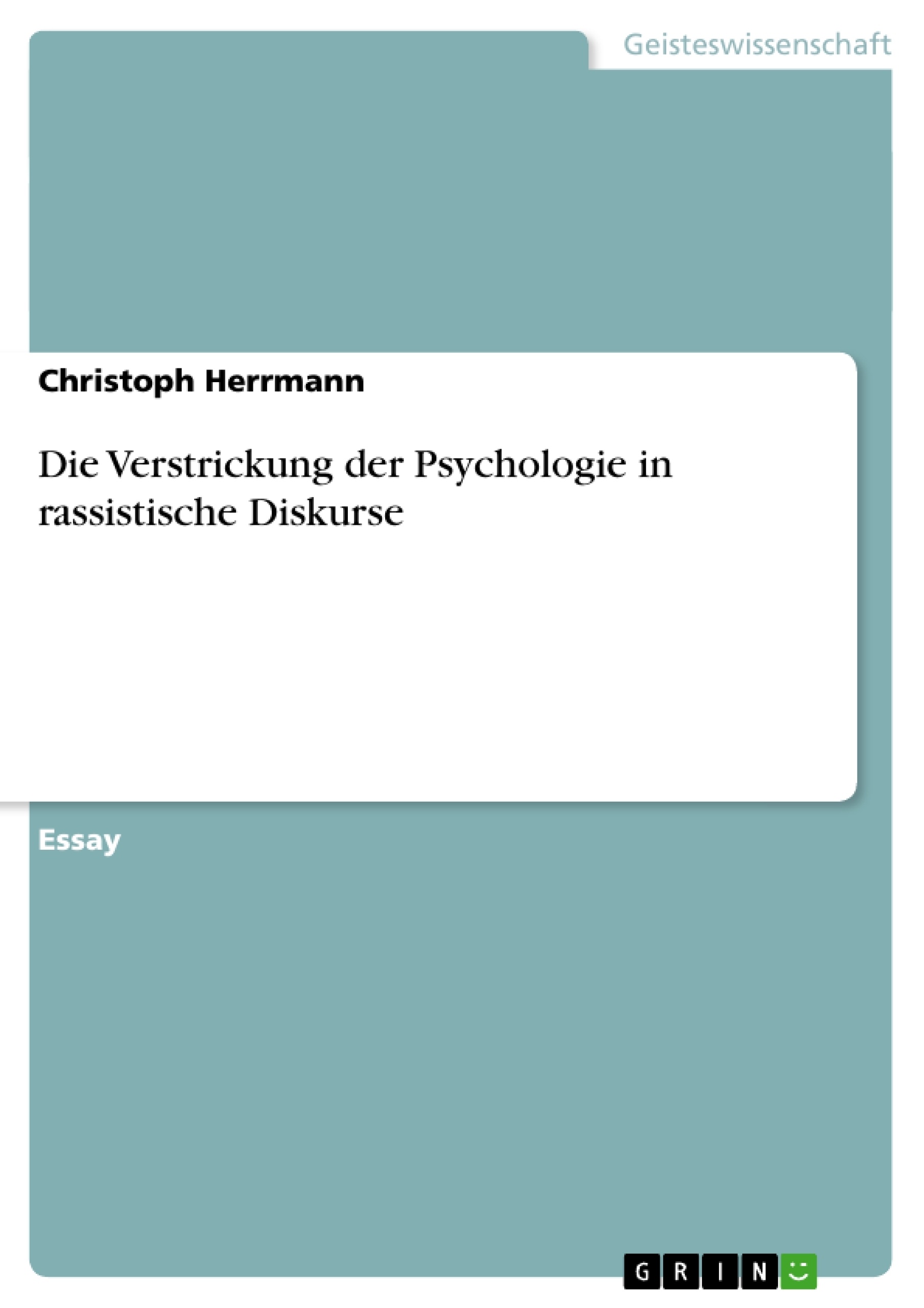Nach Dodd (1998) umfasst der Terminus Interkulturelle Kommunikation „(…) the influence of cultural variability and diversity on interpersonally oriented communication outcomes. Differences in communication and social style, world view, customs, expectations, rules, roles, and myths illustrate a few of the elements that explain how culture shapes the communication process.” (S. 4, Hervorh. nicht im Original).
Einen Begriff von Interkultureller Kommunikation zu haben setzt (so auch in obiger Definition) ein Verständnis davon voraus, was jeweils unter Kultur zu verstehen ist. Die begriffliche Festsetzung von „Kultur“ ist jedoch nicht unproblematisch, weil hier die Möglichkeit der politischen Instrumentalisierung besteht (siehe hierzu Waldow 2002). Im diskursiv akzeptierten Kulturbegriff liegt immer schon eine Quasilegitimation für die Etikettierung von „Fremder Kultur“ mitsamt den daraus abgeleiteten Rechten für die Zugehörigen (bspw. Hoheitsansprüche) bzw. Pflichten (bspw. Integrationsgebot) für die Nicht-Zugehörigen und somit Potential für rassistische Argumentationen. Sind Angehörige einer Gruppe (häufig Minoritäten) erst einmal als „fremde Kultur“ deklariert, erscheinen Ausgrenzungsproblematiken zwangsläufig als „selbstverständlich“ und als „in der Sache liegend“.
Inhaltsverzeichnis
- Einen Begriff von Interkultureller Kommunikation zu haben setzt (so auch in obiger Definition) ein Verständnis davon voraus, was jeweils unter Kultur zu verstehen ist.
- Ein Verständnis von Interkultureller Kommunikation und somit von Kultur zu entwickeln erfordert (ähnlich wie beim Identitätsbegriff) ferner die Suche nach Differenzierungskriterien³.
- Hier muss sich nun die Psychologie fragen lassen, nach welchen Kriterien sie zur Begriffsbildung beiträgt.
- In diesem Kontext nimmt die Interkulturelle Psychologie als Sozialwissenschaft eine problematische Stellung ein.
- Entsprechend dieser Erörterung ist bei der Analyse von Kultur bzw. Interkultureller Psychologie und damit zusammenhängenden Konzepten (wie bspw. Rassismus) zu berücksichtigen, dass bereits begriffliche Gegenstandsbestimmungen (wenn auch ungewollt) rassistische Argumentation unterstützen, im schlimmsten Falle gar konstituieren können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der kritischen Analyse der Verstrickung der Psychologie in rassistische Diskurse. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie die Psychologie durch ihren Umgang mit Begriffen wie Kultur und Fremdheit, rassistische Argumentationen unbeabsichtigt unterstützt und sogar reproduziert.
- Die problematische Konstruktion des Begriffs „Kultur“ und seine politische Instrumentalisierung.
- Die Rolle der Psychologie in der Konstruktion und Reproduktion von rassistischen Denk- und Handlungsweisen.
- Die Notwendigkeit, die eigenen Vorannahmen und Verstrickungen in rassistische Diskurse zu reflektieren.
- Die Bedeutung eines kritischen und selbstreflexiven Umgangs mit „dem Anderen“ in der Interkulturellen Psychologie.
- Die Bedeutung der Dekonstruktion rassistischer Argumentationen und die Förderung einer antirassistischen Haltung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer kritischen Analyse des Begriffs „Kultur“ und zeigt auf, wie dieser Begriff in rassistische Argumentationen eingebunden sein kann.
- Im zweiten Teil werden die Herausforderungen bei der Suche nach Differenzierungskriterien im Kontext von Interkultureller Kommunikation beleuchtet.
- Der Essay fokussiert dann auf die Rolle der Psychologie in der Konstruktion von Begriffen und die damit verbundenen Risiken für rassistische Denk- und Handlungsweisen.
- Im letzten Teil des Essays wird die Interkulturelle Psychologie als Sozialwissenschaft kritisch betrachtet und die Bedeutung eines selbstreflexiven Umgangs mit „dem Anderen“ hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind Rassismus, Kultur, Interkulturelle Kommunikation, Interkulturelle Psychologie, Fremdheit, Identitätskonstruktion, wissenschaftlicher Diskurs, pseudopsychologische Postulate.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Begriff „Kultur“ in der Psychologie problematisch?
Der Kulturbegriff kann politisch instrumentalisiert werden, um Menschen als „fremd“ zu markieren und so Ausgrenzung oder rassistische Argumentationen unbewusst zu legitimieren.
Wie kann Psychologie rassistische Diskurse unterstützen?
Indem sie Differenzierungskriterien schafft, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder „Kultur“ festschreiben, statt diese Konstruktionen kritisch zu hinterfragen.
Was wird an der „Interkulturellen Psychologie“ kritisiert?
Kritisiert wird ihre oft problematische Stellung als Sozialwissenschaft, wenn sie ungewollt rassistische Argumentationen durch begriffliche Gegenstandsbestimmungen konstituiert.
Welche Rolle spielt der Begriff der „Identität“?
Identitätskonstruktionen erfordern oft Abgrenzung nach außen. Die Arbeit untersucht, wie diese Suche nach Differenzierung rassistische Denkweisen fördern kann.
Was fordert der Essay von Psychologen?
Er fordert einen selbstreflexiven Umgang mit „dem Anderen“ und die ständige Dekonstruktion eigener Vorannahmen, um eine antirassistische Haltung zu fördern.
Was bedeutet „politische Instrumentalisierung“ von Kultur?
Damit ist gemeint, dass kulturelle Unterschiede genutzt werden, um Rechte für Zugehörige einzufordern oder Pflichten (wie Integrationsgebote) für Nicht-Zugehörige zu rechtfertigen.
- Citar trabajo
- Christoph Herrmann (Autor), 2003, Die Verstrickung der Psychologie in rassistische Diskurse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25427