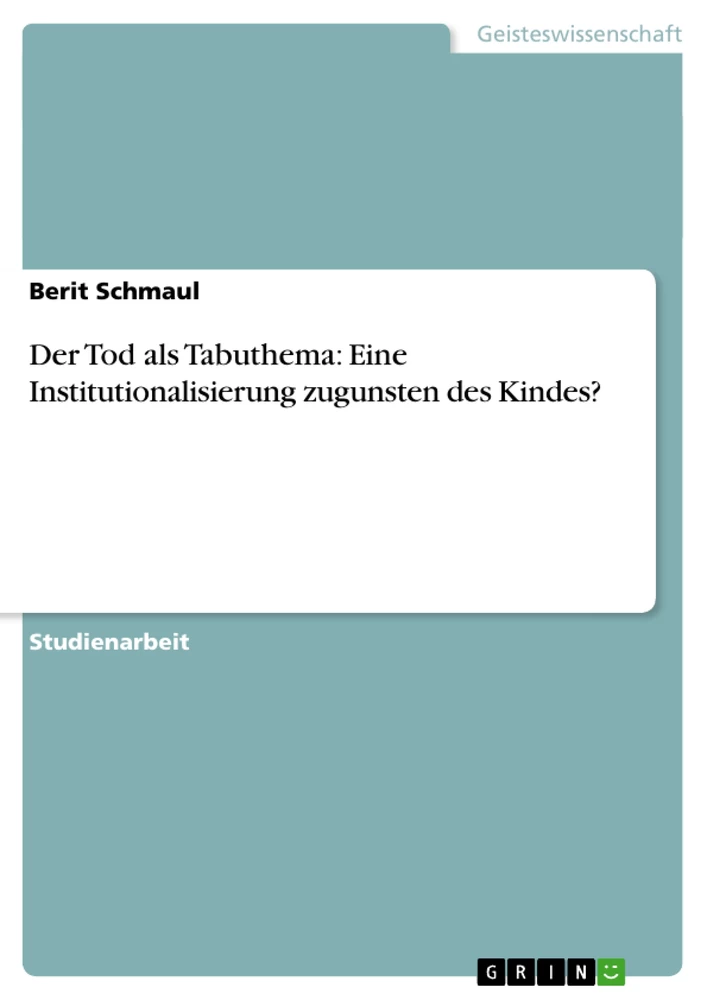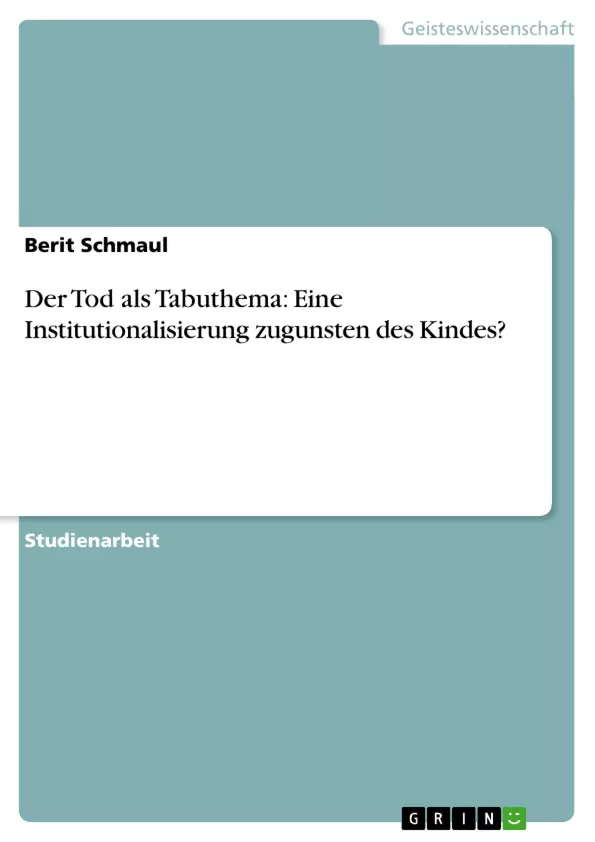Wie gehen Kinder mit dem Thema Tod um? Tabuisieren Sie es oder sind sie interessiert? Woran glauben sie. An ein "Danach"?
In einer interessanten Studie mit Grundschülern offenbarten diese ganz individuelle Vorstellungen, die zum Teil dem buddhistischen "Totenbuch der Tibeter" sehr ähneln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Tod als Tabuthema: Eine Institutionalisierung zugunsten des Kindes?
- 2. „Der Tod in unserer Gesellschaft“ – Eine Umfrage unter Menschen
- 2.1 Grundlegende Informationen über die Studie
- 2.1.1 Soziokulturelle und personale Bedingungen der Befragten
- 2.1.2 Spezielle Organisations- und Rahmenbedingungen der Befragung
- 2.2 Der Fragenkatalog
- 2.3 Darstellung und Interpretation der gegebenen Antworten
- 2.3.1 Was verbindet das Kind mit dem Tod?
- 2.3.2 Der Tod ein angstauslösender Gedanke?
- 2.3.2.1 Wenn ja, wovor fürchtest du dich genau?
- 2.3.2.2 Wenn nein, warum fürchtest du dich nicht?
- 2.3.3 Der Tod als Gesprächsthema- Integraler Bestandteil oder gar Mangelware unseres sozialen Gefüges?
- 2.3.4 Religiös oder laizistisch geprägt? Die Frage nach dem „Danach“?
- 2.4 Das Kind und der Tod – kein Antagonismus
- 2.1 Grundlegende Informationen über die Studie
- 3. Der andere Umgang mit dem Tod: „Das Totenbuch der Tibeter“
- 3.1 Der Begriff „Bardo“
- 3.2 Der Bardo des Lebens
- 3.3 Der Bardo des Todes
- 3.4 Zusammenfassung: Praktische Konsequenzen für die Alltagswelt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den kindlichen Umgang mit dem Tod und die gesellschaftliche Reaktion darauf. Ziel ist es, die Wahrnehmung des Todes bei Kindern zu erforschen und die Rolle von Kommunikation und Sozialisation in diesem Kontext zu beleuchten. Die Studie analysiert, wie Kinder den Tod wahrnehmen, ob sie Angst davor haben und wie über den Tod in verschiedenen sozialen Kontexten gesprochen wird.
- Kindliche Wahrnehmung und Verständnis des Todes
- Der Tod als Tabuthema in der Gesellschaft und seine Institutionalisierung
- Kommunikation über den Tod im familiären und schulischen Umfeld
- Der Einfluss von Religion und Kultur auf den Umgang mit dem Tod
- Vergleich des westlichen mit einem buddhistischen Verständnis des Todes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Tod als Tabuthema: Eine Institutionalisierung zugunsten des Kindes?: Die Einleitung beleuchtet die paradoxe Situation, in der wir tagtäglich mit dem Tod konfrontiert werden (z.B. durch Medien), gleichzeitig aber ein offener Dialog darüber fehlt. Der Tod wird als soziales Tabu dargestellt, dessen Vermeidung als rollenkonformes Verhalten innerhalb des Systems interpretiert wird. Die Arbeit spekuliert über die Gründe für diese Institutionalisierung des Tabus, die in der Wohlstands- und Langlebigkeitsgesellschaft verortet werden und mit der Vermeidung existentieller Fragen verknüpft sind. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Kinder, die noch nicht vollends sozialisiert sind, mit dem Tod umgehen und ob und wie ihre Fragen beantwortet werden. Die Hausarbeit kündigt eine empirische Studie an, welche die kindliche Wahrnehmung und den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Tod beleuchten soll und den Einfluss von Religion und Kultur auf die Wahrnehmung des Todes analysiert. Im dritten Teil soll der buddhistische Umgang mit dem Tod im Kontrast zum westlichen betrachtet werden.
2. „Der Tod in unserer Gesellschaft“ – Eine Umfrage unter Menschen: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Studie mit 61 Kindern im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren aus Euskirchen und Umgebung. Die Befragten repräsentieren verschiedene soziokulturelle Hintergründe (verschiedene Familienstrukturen, soziale Schichten, ethnische Herkunft und Religionen). Die Studie analysiert die kindlichen Assoziationen mit dem Tod, die damit verbundenen Ängste und die Rolle des Todes als Gesprächsthema. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über den kindlichen Umgang mit dem Tod und den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren geben, insbesondere hinsichtlich des Dialogs über den Tod innerhalb der Familie, Schule oder anderen Institutionen.
3. Der andere Umgang mit dem Tod: „Das Totenbuch der Tibeter“: Dieses Kapitel stellt einen Kontrast zum westlichen Umgang mit dem Tod dar, indem es den buddhistischen Begriff des Sterbens, insbesondere anhand des „Totenbuchs der Tibeter“, beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des „Bardo“ und dessen Relevanz für das Leben und den Tod. Es wird diskutiert, wie die tibetanische Kultur den Tod anders wahrnimmt und welche praktischen Konsequenzen sich daraus für den Alltag ergeben.
Schlüsselwörter
Kind, Tod, Wahrnehmung, Kommunikation, Sozialisation, Tabu, Gesellschaft, Religion, Kultur, Empirie, Studie, Buddhismus, „Totenbuch der Tibeter“, Bardo, Angst, Dialog.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Der Umgang von Kindern mit dem Tod
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den kindlichen Umgang mit dem Tod und die gesellschaftliche Reaktion darauf. Sie erforscht die Wahrnehmung des Todes bei Kindern, die Rolle von Kommunikation und Sozialisation, und analysiert, wie über den Tod in verschiedenen sozialen Kontexten gesprochen wird.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine Literaturrecherche mit einer empirischen Studie. Die empirische Studie besteht aus einer Umfrage unter 61 Kindern im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren aus Euskirchen und Umgebung. Die Befragten repräsentieren verschiedene soziokulturelle Hintergründe.
Welche Fragen wurden in der Umfrage gestellt?
Der Fragenkatalog der Studie umfasste Fragen zu den kindlichen Assoziationen mit dem Tod, den damit verbundenen Ängsten, der Rolle des Todes als Gesprächsthema und dem Einfluss von Religion und Kultur auf die Wahrnehmung des Todes. Konkret wurden Fragen gestellt zu dem, was Kinder mit dem Tod verbinden, ob der Tod als angstauslösender Gedanke erlebt wird und, falls ja, wovor genau die Angst besteht, ob und wie über den Tod gesprochen wird, und ob religiöse oder laizistische Vorstellungen eine Rolle spielen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie sollen Aufschluss über den kindlichen Umgang mit dem Tod und den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren geben, insbesondere hinsichtlich des Dialogs über den Tod innerhalb der Familie, Schule oder anderen Institutionen. Die detaillierten Ergebnisse sind in Kapitel 2 der Hausarbeit dargestellt.
Wie wird der Tod in der Gesellschaft dargestellt?
Die Hausarbeit beschreibt den Tod als ein soziales Tabu, dessen Vermeidung als rollenkonformes Verhalten interpretiert wird. Es wird spekuliert, dass die Institutionalisierung dieses Tabus in der Wohlstands- und Langlebigkeitsgesellschaft verortet werden kann und mit der Vermeidung existentieller Fragen verknüpft ist.
Wie wird der buddhistische Umgang mit dem Tod behandelt?
Die Arbeit vergleicht den westlichen Umgang mit dem Tod mit dem buddhistischen Verständnis, insbesondere anhand des „Totenbuchs der Tibeter“. Der Fokus liegt auf dem Begriff „Bardo“ und dessen Relevanz für das Leben und den Tod. Es wird diskutiert, wie die tibetanische Kultur den Tod anders wahrnimmt und welche praktischen Konsequenzen sich daraus für den Alltag ergeben.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 beleuchtet den Tod als Tabuthema; Kapitel 2 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie; Kapitel 3 vergleicht den westlichen mit dem buddhistischen Umgang mit dem Tod.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Kind, Tod, Wahrnehmung, Kommunikation, Sozialisation, Tabu, Gesellschaft, Religion, Kultur, Empirie, Studie, Buddhismus, „Totenbuch der Tibeter“, Bardo, Angst, Dialog.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Thema Tod und Trauer, insbesondere im Kontext von Kindern und Jugendlichen, auseinandersetzen. Dies umfasst Pädagogen, Sozialarbeiter, Theologen, Psychologen und alle, die im Umgang mit Kindern und ihren Fragen zum Thema Tod professionell tätig sind.
- Quote paper
- Berit Schmaul (Author), 2004, Der Tod als Tabuthema: Eine Institutionalisierung zugunsten des Kindes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25411