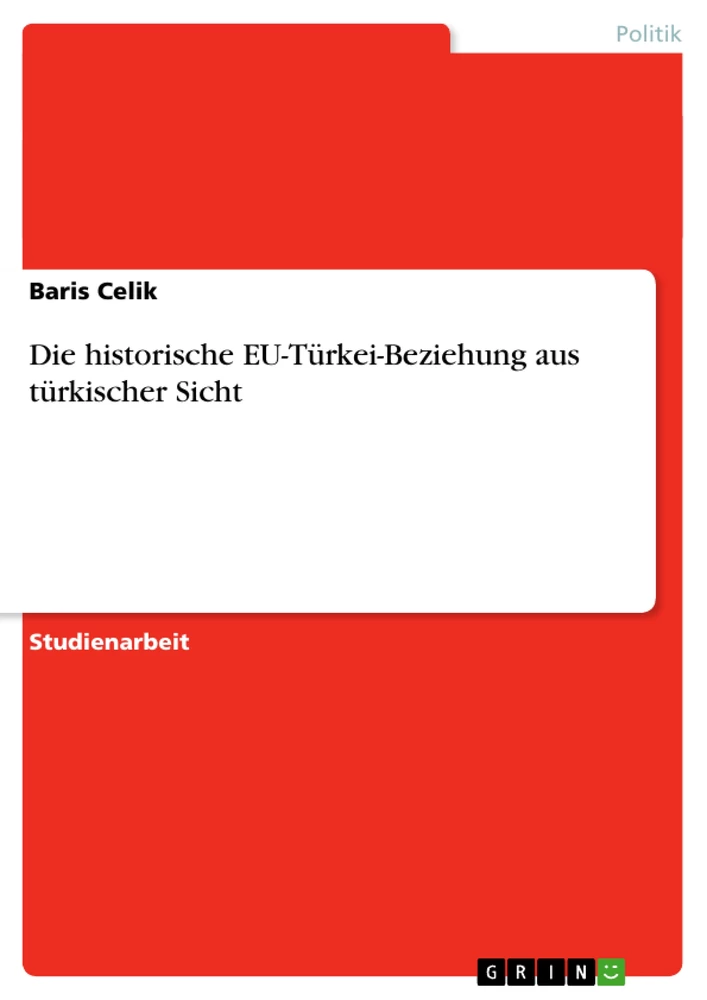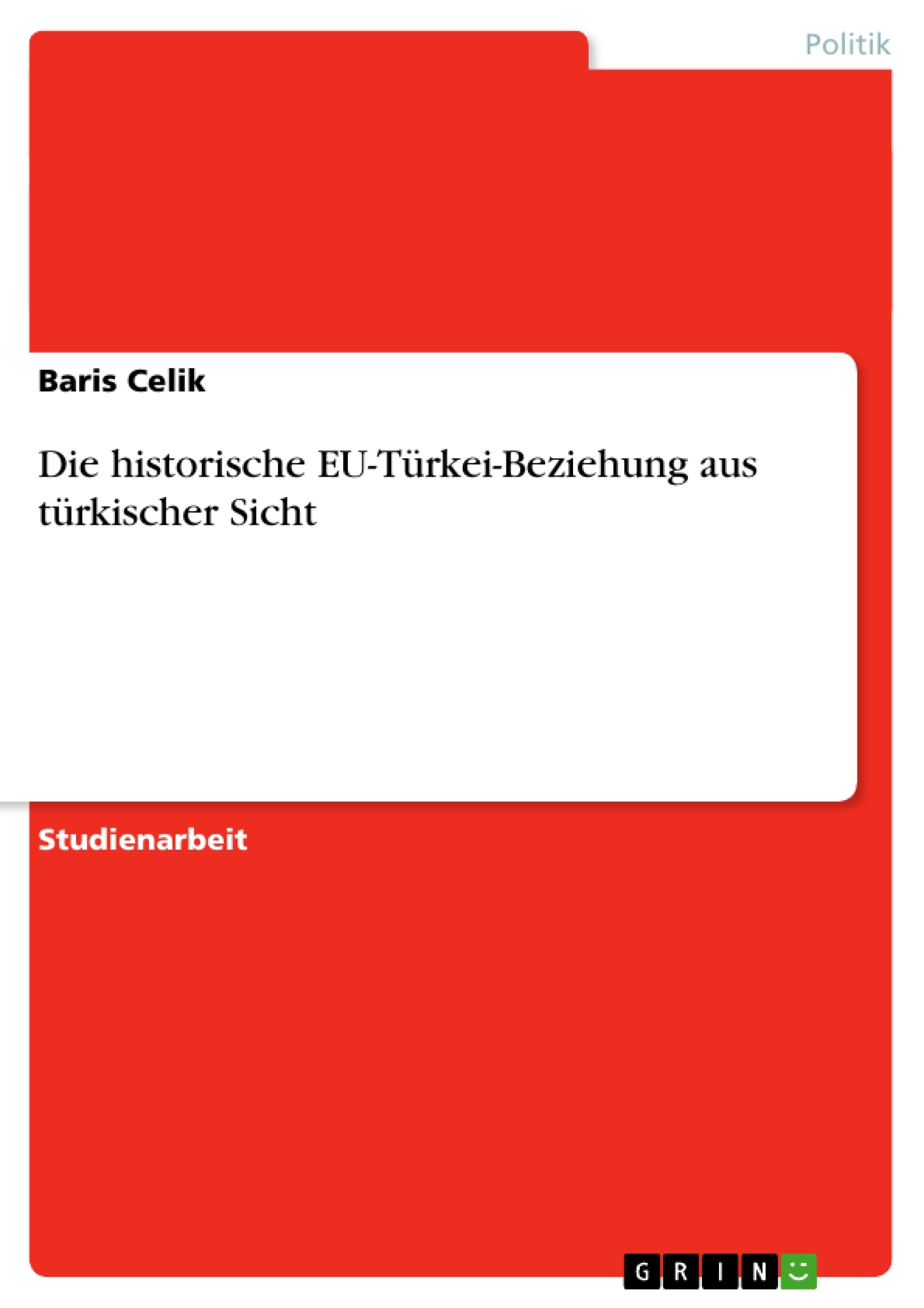Wir möchten in unserer Arbeit die EU – Türkei – Beziehungen einmal Mittels dieser
Arbeit einmal von der „anderen“ Seite, der Türkischen aufführen. Nach der Verleihung des
Kandidatenstatus an die Türkei wurde das Thema in den europäischen Medien heftigst
diskutiert. Wann wird die Türkei Vollmitglied? Wird sie es überhaupt? Sollte oder darf sie?
Diese und andere Fragen beschäftigten europäischen, darunter auch deutsche Wissenschaftler
und Journalisten zutiefst. Man machte Prognosen, Analysen und stellte Vermutungen an. Wir
möchten aber wissen; was denken die türkischen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten?
Wie gehen diese mit der neuen Situation um? Auch die konservativeren türkischen Kreise
sollen näher betrachtet werden. Diese sind in Europa gegenüber der Türkei als verschlossener
angesehen – wir werden sehen.
Nun, da der Kandidatenstatus erreicht, und eine Vollmitgliedschaft theoretisch nicht mehr
weit ist, wollen wir den geschichtlichen Hintergrund noch einmal beleuchten. Und zwar
Mittels einer türkischen Interpretation. Wie sehen die türkischen Forscher heute die
Entwicklung vom Assoziationsabkommen 1963 in Ankara bis heute? Was haben sie an der
Vergangenheit auszusetzen, wenn überhaupt?
Der Gipfel von Helsinki stellt eine Etappe in dieser Geschichtlichen Entwicklung dar. Die
Türkei ist nun offiziell, schwarz auf weiß Beitrittskandidat. Wie ist in dieser Beziehung die
Stimmung in der Türkei? Wie ist die Griechische Haltung von der Türkei aus betrachtet? Und
was ist mit dem Fall Öcalan nach dem Gipfel?
Als letztes sollten einige Pro’s und Contra’s bezüglich der Kandidatur aufgeführt werden.
Die Hauptbefürworter des Beitritts lassen sich in mehreren Bereichen finden. Die größten
Gruppen bilden Teile Medien und die Wirtschaft. Das der größte Teil der Medien in der Hand
der Wirtschaft sind, beschränken wir uns auf die Meinung der Wirtschaftsvertreter.
Stellvertretend für den Contra – Flügel führen wir v.a. einen Wissenschaftler, bzw. Professor
auf.
Wir hoffen mit unserer Arbeit einige offen stehende Fragen beantworten zu können. Vor
allem möchten wir einmal die „Gegenseite“ und ihre Argumente kennen lernen. Es ist
sicherlich sinnvoller als unwissend und minimal informiert aufeinander zu zuarbeiten oder es
zu versuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Einleitung
- Geschichtliche Entwicklung
- Vom Assoziationsvertrag von Ankara bis zum Antrag auf Vollmitgliedschaft (1987)
- Von 1987 bis zum Luxemburger Gipfel 1997
- Von Luxemburg nach Helsinki
- Der Gipfel in Helsinki (1999) und seine Folgen
- Die Entwicklungen vor dem Helsinki-Gipfel
- Griechenlands Haltung
- Der Helsinki-Gipfel
- Nach dem Helsinki-Gipfel
- Die Akte Öcalan
- Pro und Contra - innere Stimmen
- Pro: Die Wirtschaft
- Contra
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei aus türkischer Perspektive, insbesondere die Entwicklung vom Assoziationsvertrag von Ankara bis zum Kandidatenstatus. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe, die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Türkei (Wirtschaft vs. kritische Stimmen) und die Rolle des Helsinki-Gipfels. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis der türkischen Sichtweise auf diesen Prozess zu vermitteln.
- Die historische Entwicklung der EU-Türkei-Beziehungen
- Die türkische Interpretation der Vergangenheit und der Assoziationsverträge
- Die Rolle des Helsinki-Gipfels und seine Folgen für die Türkei
- Die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Türkei zum EU-Beitritt
- Die Bedeutung des Falls Öcalan für die EU-Türkei-Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Inhalt: Dieses Kapitel dient als Inhaltsverzeichnis der Arbeit und bietet einen Überblick über die Struktur und die behandelten Themen.
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der EU-Türkei-Beziehungen ein und betont die Bedeutung der türkischen Perspektive, die in den europäischen Medien oft zu kurz kommt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Sichtweisen türkischer Politiker, Wissenschaftler und Journalisten, einschließlich konservativer Kreise, zu beleuchten und den historischen Kontext des Beitrittsprozesses zu analysieren, besonders im Hinblick auf den Kandidatenstatus und die Frage der Vollmitgliedschaft.
Geschichtliche Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der EU-Türkei-Beziehungen von 1963 (Assoziationsvertrag von Ankara) bis zum Antrag der Türkei auf Vollmitgliedschaft 1987. Es analysiert den Assoziationsvertrag im Vergleich zu anderen Abkommen, die wirtschaftlichen Aspekte und die Herausforderungen und Verzögerungen bei der Umsetzung. Besonders hervorzuheben ist die Analyse der unterschiedlichen Positionen und Handlungen der EG/EU und der Türkei, sowie der Einfluss von innen- und außenpolitischen Faktoren. Die nicht erfolgte Umsetzung der Reisefreiheit türkischer Arbeitskräfte wird als ein bedeutender Punkt der Enttäuschung für die Türkei dargestellt.
Schlüsselwörter
EU-Türkei-Beziehungen, Assoziationsvertrag von Ankara, Vollmitgliedschaft, Kandidatenstatus, Helsinki-Gipfel, Fall Öcalan, türkische Perspektive, wirtschaftliche Integration, politische Bedingungen, Griechenland, Innenpolitik Türkei, Außenhandel.
Häufig gestellte Fragen zu: EU-Türkei Beziehungen aus türkischer Perspektive
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei aus türkischer Sicht, von den Anfängen des Assoziationsvertrags von Ankara bis zum Erreichen des Kandidatenstatus. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, verschiedene Positionen innerhalb der Türkei (Wirtschaft vs. Kritik), und die Bedeutung des Helsinki-Gipfels. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der türkischen Perspektive zu vermitteln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Beziehungen, die türkische Interpretation der Vergangenheit und der Assoziationsverträge, die Rolle des Helsinki-Gipfels und seine Folgen, unterschiedliche Positionen innerhalb der Türkei zum EU-Beitritt, und die Bedeutung des Falls Öcalan für die Beziehungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur geschichtlichen Entwicklung (unterteilt in Phasen bis zum Helsinki-Gipfel und danach), ein Kapitel zum Helsinki-Gipfel und seinen Folgen (inkl. der Rolle Griechenlands und des Falls Öcalan), sowie einen Schluss und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum vom Assoziationsvertrag von Ankara (1963) bis nach dem Helsinki-Gipfel (1999), mit besonderem Fokus auf die Entwicklung ab 1987 (Antrag auf Vollmitgliedschaft).
Welche Perspektiven werden berücksichtigt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die türkische Perspektive, indem sie die Sichtweisen türkischer Politiker, Wissenschaftler und Journalisten, inklusive konservativer Kreise, einbezieht und die oft in europäischen Medien vernachlässigte Sichtweise beleuchtet.
Welche Rolle spielt der Helsinki-Gipfel?
Der Helsinki-Gipfel (1999) und seine Folgen sind ein zentraler Punkt der Arbeit. Die Arbeit analysiert die Ereignisse vor dem Gipfel, die Position Griechenlands, den Gipfel selbst und die darauffolgenden Entwicklungen, inklusive der „Akte Öcalan“.
Wie werden die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Türkei dargestellt?
Die Arbeit zeigt die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Türkei auf, insbesondere den Gegensatz zwischen pro-europäischen Wirtschaftskreisen und kritischen Stimmen. Der Fall Öcalan dient als Beispiel für die Komplexität der innenpolitischen Debatte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: EU-Türkei-Beziehungen, Assoziationsvertrag von Ankara, Vollmitgliedschaft, Kandidatenstatus, Helsinki-Gipfel, Fall Öcalan, türkische Perspektive, wirtschaftliche Integration, politische Bedingungen, Griechenland, Innenpolitik Türkei, Außenhandel.
Wo finde ich mehr Informationen?
Ein Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit bietet weitere Quellen.
- Quote paper
- Baris Celik (Author), 2001, Die historische EU-Türkei-Beziehung aus türkischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25327