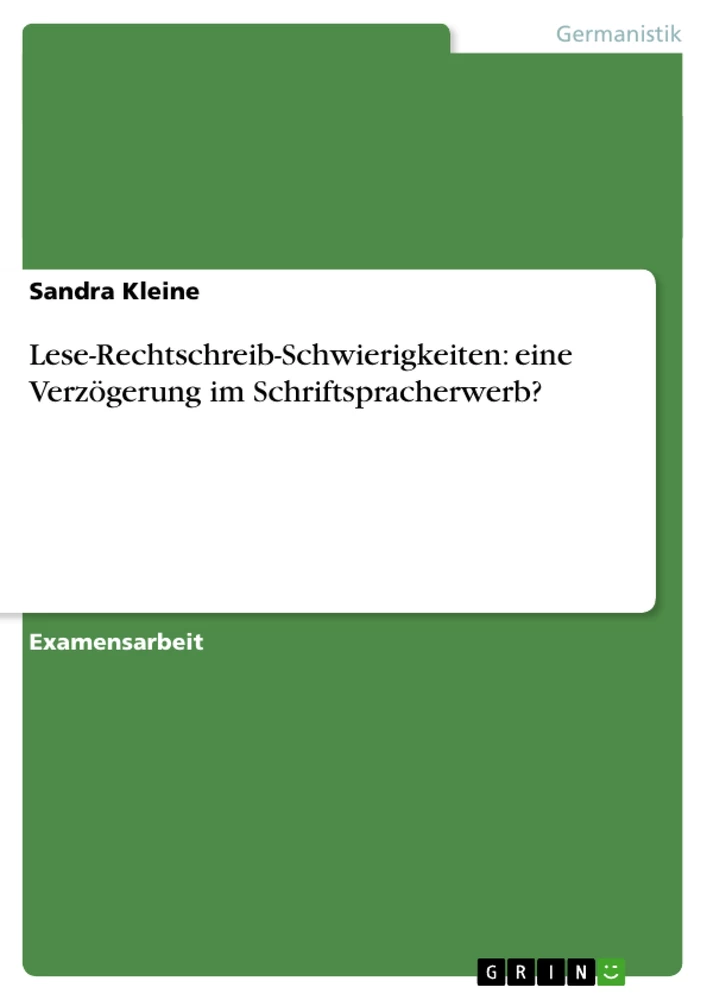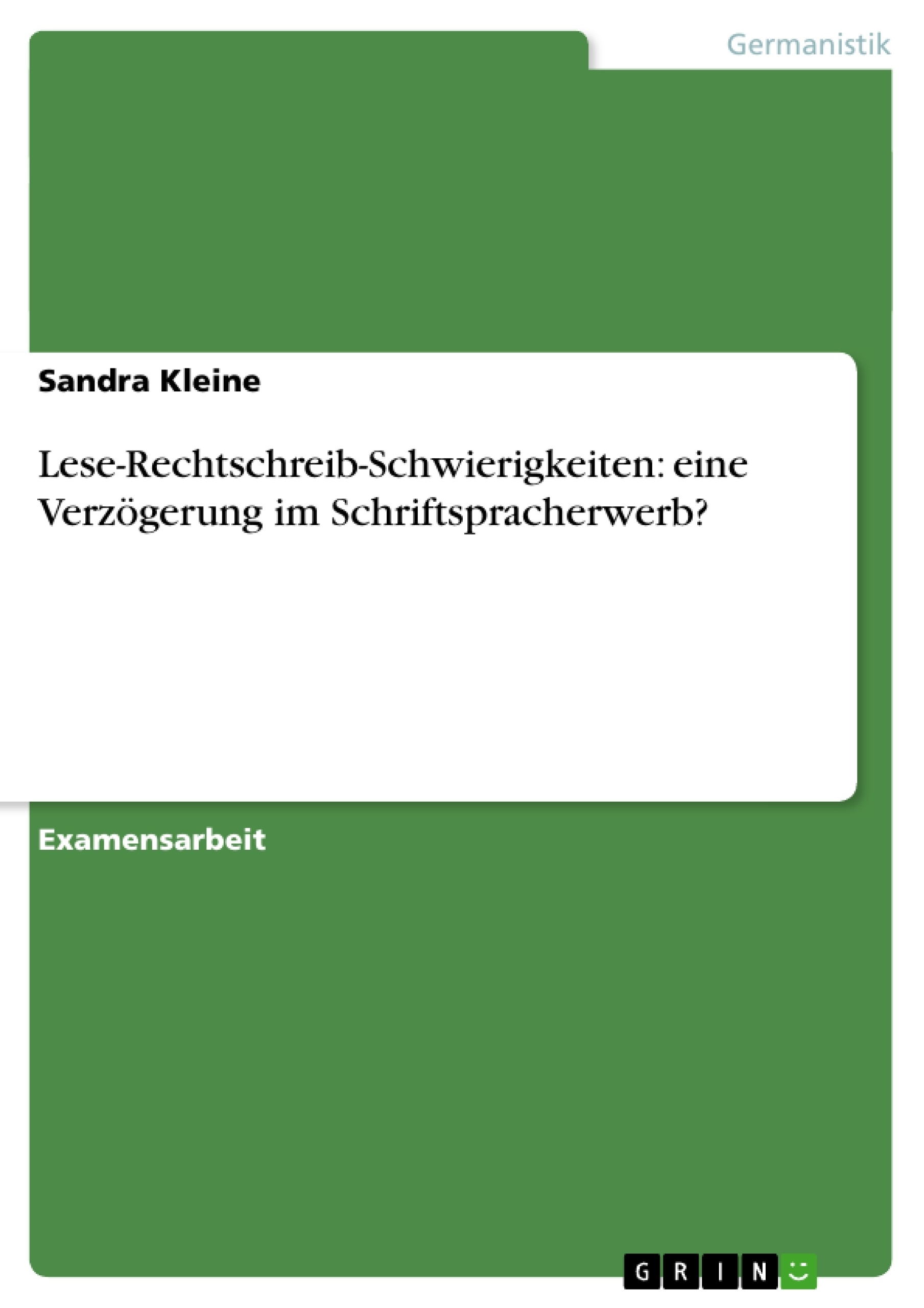Der Erwerb des Lesens und des Schreibens wird in neuerer Zeit als Denkentwicklung verstanden, während derer Einsichten in Funktion und Aufbau unseres Schriftsystems gemacht werden müssen. Fehler werden dabei als Notwendigkeit betrachtet, die den Entwicklungsstand eines Kindes bzw. sein Wissen über unser Schriftsystem offenbaren. Diese Betrachtungsweise der Schriftsprachentwicklung hatte eine ganz bestimmte Sichtweise von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zur Folge. Die Entwicklung der Schüler mit Problemen beim Schriftspracherwerb verläuft danach lediglich zeitlich verzögert, aber in der gleichen Form wie die der Kinder, die das Lesen und Schreiben ohne Schwierigkeiten erwerben.
Aus der heutigen Sichtweise von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten entstehen weitreichende Konsequenzen für die betroffenen Kinder. Sie werden bestimmten Stufen in der Entwicklung zugeordnet und Fördermaßnahmen orientieren sich am normalen Fortgang und beschränken sich auf die Entfaltung schriftsprachlicher Fähigkeiten gemäß der Zone der nächsten Entwicklung. Die Frage, die sich nun ergibt, ist, ob die Form der Erfassung lese-rechtschreib-schwacher Kinder in Stufenmodellen sinnvoll ist und ob die Entwicklung dieser Kinder mit der von Kindern ohne Schwierigkeiten vergleichbar ist.
Zu Beginn dieser Arbeit soll die Entstehung dieses Ansatzes vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute beschrieben werden. Dabei möchte ich ihr vorausgehende Konzepte, das Legastheniekonzept und den prozeßorientierten Ansatz, in ihrer Brauchbarkeit zur Erfassung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten bewerten. Im Folgenden soll deutlich werden, daß die derzeitige Sichtweise der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten der Komplexität des Phänomens nicht gerecht wird, daß vor allem eine sozialpsychologische Sichtweise der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten nötig ist, um das Problem adäquat zu erfassen. Die aus den Untersuchungen hervorgehenden Merkmale der Kinder werden deshalb in ein entsprechendes Modell eingeordnet. Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen und der im dritten Kapitel dargestellten differenzierten Sichtweise von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten entstehen Konsequenzen, die sich überwiegend auf Interventionsverfahren und die weitere Forschung beziehen. Diese werden zum Schluss dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung der Erforschung der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten
- Die Anfänge der Forschung
- Die Legasthenieforschung
- Kritik am Legastheniekonzept
- Funktion des Legastheniekonzepts
- Der prozeßorientierte Ansatz
- Redundanz-Modell des Lesens nach Haber
- Zwei-Wege-Modell des Lesens nach Coltheart
- Weiterentwicklungen des Zwei-Wege-Modells
- Der entwicklungsorientierte Ansatz
- Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs
- Stufenmodell der Entwicklung des Lesens und des Schreibens nach Günther
- Modell der Rechtschreibentwicklung nach Scheerer-Neumann
- Modell der Rechtschreibentwicklung nach Valtin
- Veränderte Sichtweisen
- Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten im Rahmen der Schriftsprachentwicklung
- Relevanz der Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs für die entwicklungsorientierte Sicht von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten
- Schriftsprachentwicklung aus sozialpsychologischer Perspektive
- Merkmale lese-rechtschreib-schwacher Kinder und deren Entwicklung
- 1. Stadium der Entwicklung
- 2. Stadium der Entwicklung
- 3. Stadium der Entwicklung
- 4. Stadium der Entwicklung
- Merkmale lese-rechtschreib-schwacher Kinder und deren Entwicklung
- Konsequenzen
- Schulische Konsequenzen
- Die soziale Situation
- Das Selbstvertrauen
- Der Schriftspracherwerb
- Konsequenzen für die Forschung
- Schulische Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die aktuelle Auffassung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten im Kontext der Schriftsprachentwicklung. Sie beleuchtet die historische Entwicklung verschiedener Konzepte, bewertet deren Brauchbarkeit und hinterfragt die Eignung von Stufenmodellen zur Erfassung lese-rechtschreib-schwacher Kinder. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Entwicklung dieser Kinder tatsächlich nur eine zeitliche Verzögerung darstellt oder ob weitere Faktoren eine Rolle spielen.
- Historische Entwicklung der Konzepte zu Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten
- Bewertung verschiedener Ansätze (Legastheniekonzept, prozessorientierter und entwicklungsorientierter Ansatz)
- Analyse von Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs
- Untersuchung der Relevanz sozialpsychologischer Perspektiven
- Konsequenzen für die schulische Praxis und die Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Sinnhaftigkeit der Einordnung lese-rechtschreib-schwacher Kinder in Stufenmodelle und der Vergleichbarkeit ihrer Entwicklung mit der von Kindern ohne Schwierigkeiten. Sie kündigt die historische Betrachtung der Konzepte und die kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Sichtweise an.
Historische Entwicklung der Erforschung der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Verständnisses von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Es analysiert frühere Konzepte wie das Legastheniekonzept und den prozessorientierten Ansatz, um die Vor- und Nachteile im Vergleich zur aktuellen, entwicklungsorientierten Sichtweise aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Bewertung der jeweiligen Ansätze bei der Erfassung und Erklärung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Es wird die Entwicklung von verschiedenen Modellen des Lesens und Schreibens betrachtet und deren Bedeutung für die heutige Sichtweise erläutert.
Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Stufenmodelle der Schriftsprachentwicklung (Günther, Scheerer-Neumann, Valtin) und analysiert deren Aufbau und Gemeinsamkeiten. Es untersucht die Anwendung dieser Modelle auf lese-rechtschreib-schwache Kinder und diskutiert die Frage, inwieweit diese Modelle geeignet sind, die Entwicklung dieser Kinder adäquat zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung der Modelle und deren Implikationen für das Verständnis von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Die veränderten Sichtweisen und die Entwicklung der Modelle im Laufe der Zeit werden umfassend beleuchtet.
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten im Rahmen der Schriftsprachentwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Relevanz der Stufenmodelle für die entwicklungsorientierte Sicht auf Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und erweitert den Blickwinkel auf eine sozialpsychologische Perspektive. Es werden Merkmale lese-rechtschreib-schwacher Kinder in verschiedenen Entwicklungsstadien detailliert beschrieben und analysiert, um zu zeigen, inwieweit die Annahme einer reinen Verzögerung der Entwicklung zutrifft. Der soziale und emotionale Kontext der Schwierigkeiten wird ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Schriftspracherwerb, Stufenmodelle, Legasthenie, entwicklungsorientierter Ansatz, sozialpsychologische Perspektive, Fehleranalyse, Fördermaßnahmen, Entwicklungsverzögerung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die aktuelle Auffassung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten im Kontext der Schriftsprachentwicklung. Sie beleuchtet die historische Entwicklung verschiedener Konzepte, bewertet deren Brauchbarkeit und hinterfragt die Eignung von Stufenmodellen zur Erfassung lese-rechtschreib-schwacher Kinder. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Entwicklung dieser Kinder tatsächlich nur eine zeitliche Verzögerung darstellt oder ob weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Konzepte zu Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, bewertet verschiedene Ansätze (Legastheniekonzept, prozessorientierter und entwicklungsorientierter Ansatz), analysiert Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs, untersucht die Relevanz sozialpsychologischer Perspektiven und beschreibt die Konsequenzen für die schulische Praxis und die Forschung.
Welche Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und analysiert verschiedene Stufenmodelle der Schriftsprachentwicklung von Günther, Scheerer-Neumann und Valtin. Es wird untersucht, wie gut diese Modelle die Entwicklung lese-rechtschreib-schwacher Kinder beschreiben.
Wie wird der entwicklungsorientierte Ansatz betrachtet?
Der entwicklungsorientierte Ansatz wird im Kontext der Relevanz der Stufenmodelle für die Betrachtung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten diskutiert. Es wird analysiert, inwieweit die Annahme einer reinen Entwicklungsverzögerung bei lese-rechtschreib-schwachen Kindern zutrifft.
Welche Rolle spielt die sozialpsychologische Perspektive?
Die Arbeit erweitert den Blickwinkel auf eine sozialpsychologische Perspektive und beschreibt detailliert Merkmale lese-rechtschreib-schwacher Kinder in verschiedenen Entwicklungsstadien. Der soziale und emotionale Kontext der Schwierigkeiten wird ebenfalls betrachtet.
Welche historischen Konzepte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des Verständnisses von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, beginnt bei den Anfängen der Forschung und betrachtet das Legastheniekonzept, den prozessorientierten Ansatz (einschliesslich Redundanz-Modell nach Haber und Zwei-Wege-Modell nach Coltheart) und den entwicklungsorientierten Ansatz. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Schriftspracherwerb, Stufenmodelle, Legasthenie, entwicklungsorientierter Ansatz, sozialpsychologische Perspektive, Fehleranalyse, Fördermaßnahmen, Entwicklungsverzögerung.
Welche Konsequenzen werden für Schule und Forschung gezogen?
Die Arbeit diskutiert die schulischen Konsequenzen von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (soziale Situation, Selbstvertrauen, Schriftspracherwerb) und zieht Konsequenzen für die zukünftige Forschung.
- Quote paper
- Sandra Kleine (Author), 2000, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten: eine Verzögerung im Schriftspracherwerb?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25303