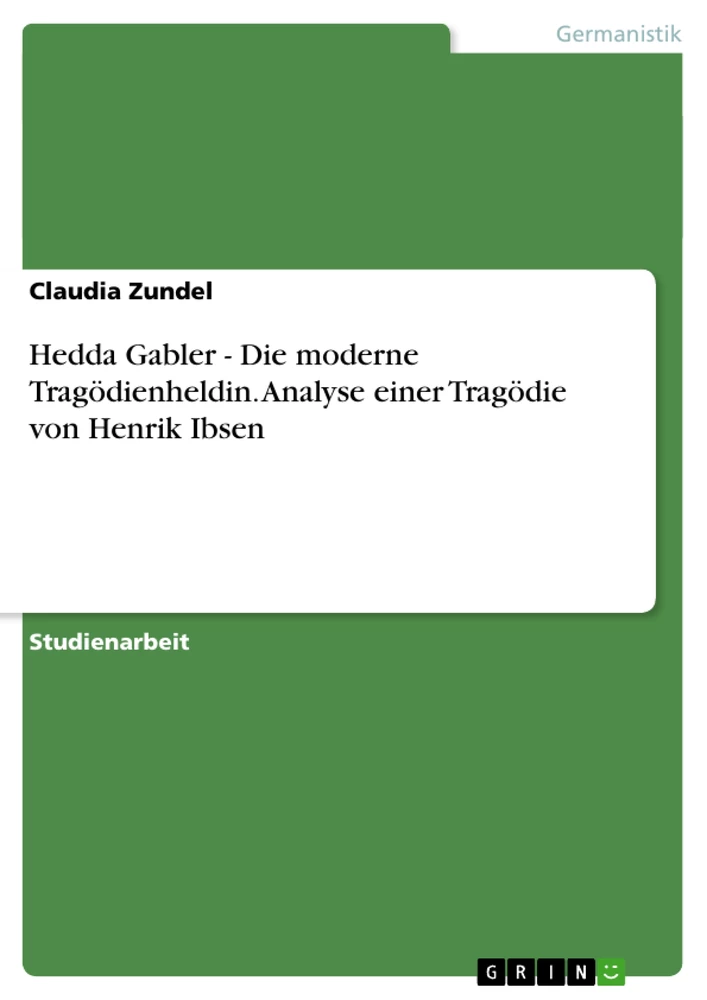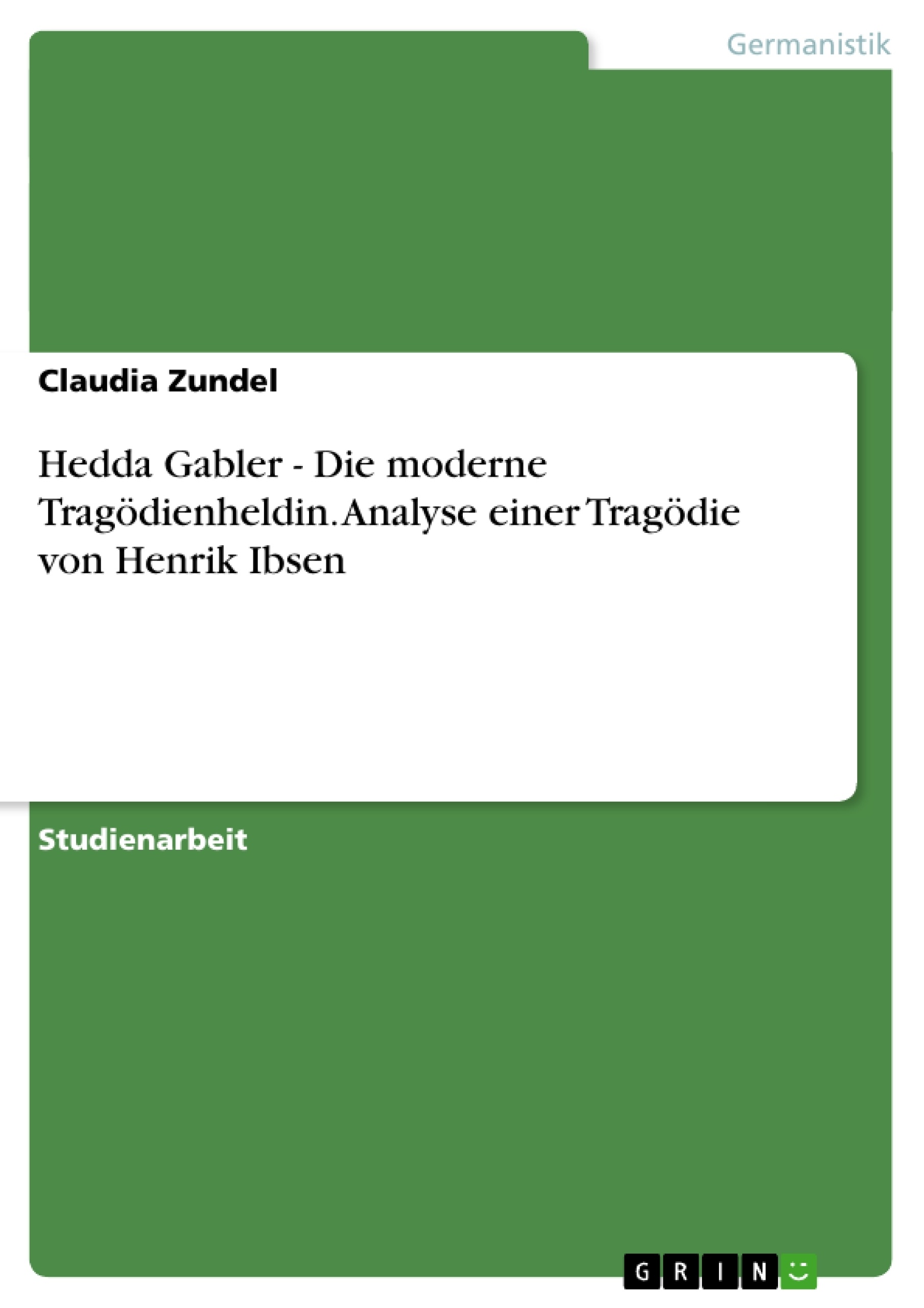Die Literatur über das Tragische und die Tragödie ist heute kaum noch überschaubar. Von der „Poetik“ Aristoteles` über Schellings „Philosophie der Kunst“ bis hin zu Dürrenmatts „Theaterprobleme(n)“ diskutieren die großen Geister über die Kunst und das Wesen der Tragödie. Das Gemeinsame alles Tragischen kommt wohl der Deutung Emil Staigers von der „Grenzsituation“ sehr nahe. Die Struktur der „Grenzsituation“ werde in der Tragödie so anschaulich, dass sie sich nur auf „paradoxe“, d.h. rein logisch betrachtet, „widerspruchsvolle Weise“ verstehen lässt. Eine vollkommene, vom Sinn durchdrungene, in sich geordnete und vernünftige Welt kann nicht tragisch sein. Ebenso eine völlig chaotische Welt, die sich im Sinnlosen verliert und nur noch gegenseitige Vernichtung der Werte kennt, löst das Tragische in den Nihilismus auf. Seit Aristoteles fragt man nach den Regeln der Tragödie, und seither wandeln sich die Antworten. Die strenge aristotelessche Dramaturgie ignorierend, verschieben sich die Begründungen des Tragischen epochenspezifisch. Die Akzentverlagerung von der Bewusstheit der klassischen Tragödie und ihrer Konflikte zu den Formen des Unbewussten umschreibt den Spielraum der Tragödie in der Zeit der Moderne. Nie zuvor drohte die Kunstform der Tragödie dem Scheitern so nahe zu sein, wie bei den Naturalisten, die ihrerseits die Moderne für sich beanspruchten.
Doch gilt das Interesse der vorliegenden Abhandlung nicht den Ursachen des drohenden Untergangs der Tragödie oder der Krise des tragischen Helden. Vielmehr sucht sie am Beispiel eines Dramas von Henrik Ibsen, andere neuere Erscheinungsformen des Tragischen hervorzukehren, die abweichen von der Tragödienform klassischen Stils.
Das 1890 vollendete Drama „Hedda Gabler“ ist möglicherweise die größte Herausforderung, die Ibsen bis dahin darbot. Es ist so ironisch in seiner Darstellung der Charaktere und Begebenheiten, dass es beinah zu voreingenommenen, widersprüchlichen Interpretationen verleitet; dennoch ist Ironie nicht die endgültige und vorherrschende Grundstimmung des Dramas. Das Stück verlangt nach einem ungeheuren Verständnis für Boshaftigkeit und Absurdität ebenso wie dem Begreifen des möglichen Nebeneinanderbestehens mit positiveren Qualitäten. Es gilt, aufmerksam die dramatische Poesie zu würdigen, um unter die ironische Oberfläche zum Innern vorzudringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tragödienliteratur
- Veränderungen des Tragischen
- Analyse des Dramas „Hedda Gabler“
- Hinführung zum Thema
- Der 1. Akt
- Heddas Unnahbarkeit und ihr Wutausbruch
- Heddas Freundlichkeit, Neid, Verachtung und Bewunderung gegenüber Thea
- Kameradschaft mit Lövborg
- Verbundenheit mit Brack
- Heddas Desinteresse an Tesman
- Triumph über die Welt der Kleinbürger
- Der 2. Akt
- Heddas Langeweile und Zerstörungslust
- Das Gespräch mit Brack
- Heddas Daseinsleere
- Kontrast Lövborg – Tesman
- Gespräch Heddas mit Lövborg
- Das Interesse Heddas an Skandalen und ihre Angst davor
- Lövborgs Hochschätzung von Theas Mut und Heddas Armutsbekenntnis
- Heddas Entschluss
- Heddas Leidenschaft und ihre neue Aufgabe
- Der 3. Akt
- Die überwundene Krise
- Heddas Interesse an Ereignissen des Abends
- Das Manuskript
- Hedda erfährt mehr von Brack
- Heddas Desillusionierung
- Bracks nachdrückliches Interesse an Hedda
- Gespräch Lövborg - Thea
- Lövborgs gebrochener Lebensmut
- Das Aufflammen einer Hoffnung
- Heddas Überzeugung
- Der Zerstörungsakt
- Der 4. Akt
- Heddas Unruhe und ihre Regression
- Das geheuchelte Geständnis
- Heddas Ekel
- Bewunderung für Theas Mut
- Bracks Bericht
- Der scheinbare Befreiungsakt
- Der Lebenssinn der anderen
- Heddas Rede
- Die Wahrheit über Lövborgs Tod
- Heddas Gefühlsausbruch
- Ausweglose Situation
- Ein Plädoyer für die Freiheit
- Resümee ihres Daseins
- Heddas Tat
- Die Tragödie
- Kollision
- Heddas Dilemma
- Dichtertum und Gesellschaft
- Die tragische Heldin
- Schluss
- Die Heldin in einer Modernen Tragödie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des Dramas „Hedda Gabler“ von Henrik Ibsen. Ziel ist es, die Figur der Hedda Gabler als moderne Tragödienheldin zu betrachten und ihre Rolle im Kontext der Tragödie zu untersuchen.
- Die Darstellung des Tragischen in der Moderne
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft
- Die Konflikte zwischen Individualität und gesellschaftlichen Normen
- Die Bedeutung von Macht und Ohnmacht
- Die Ambivalenz der Figur Hedda Gabler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Tragödienliteratur und ihren Veränderungen im Laufe der Zeit. Es wird auf die spezifischen Herausforderungen des modernen Tragischen und die Rolle des tragischen Helden in der Moderne eingegangen.
Im zweiten Kapitel wird die Analyse des Dramas „Hedda Gabler“ begonnen. Dabei wird die Figur Heddas aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, ihre Persönlichkeit und ihr Verhalten untersucht, und ihr Verhältnis zu den anderen Figuren des Dramas analysiert.
Das dritte Kapitel behandelt die Tragödie als Gattung und untersucht, wie sich die klassischen Elemente der Tragödie in „Hedda Gabler“ manifestieren. Es werden die Konflikte, das Dilemma Heddas, die Beziehung zwischen Dichtertum und Gesellschaft sowie die Rolle der tragischen Heldin beleuchtet.
Das Schluss-Kapitel befasst sich mit Hedda Gabler als Heldin einer modernen Tragödie und versucht, ihre Bedeutung im Kontext der modernen Tragödientheorien zu interpretieren.
Schlüsselwörter
Tragödie, Tragödientheorie, Hedda Gabler, Henrik Ibsen, Moderne, Moderne Tragödie, Tragische Heldin, Frauenrolle, Gesellschaft, Konflikt, Individualität, Macht, Ohnmacht, Ambivalenz, Ironie, Absurdität, Zerstörung, Lebenssinn, Freiheit
- Quote paper
- Claudia Zundel (Author), 1993, Hedda Gabler - Die moderne Tragödienheldin. Analyse einer Tragödie von Henrik Ibsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25183