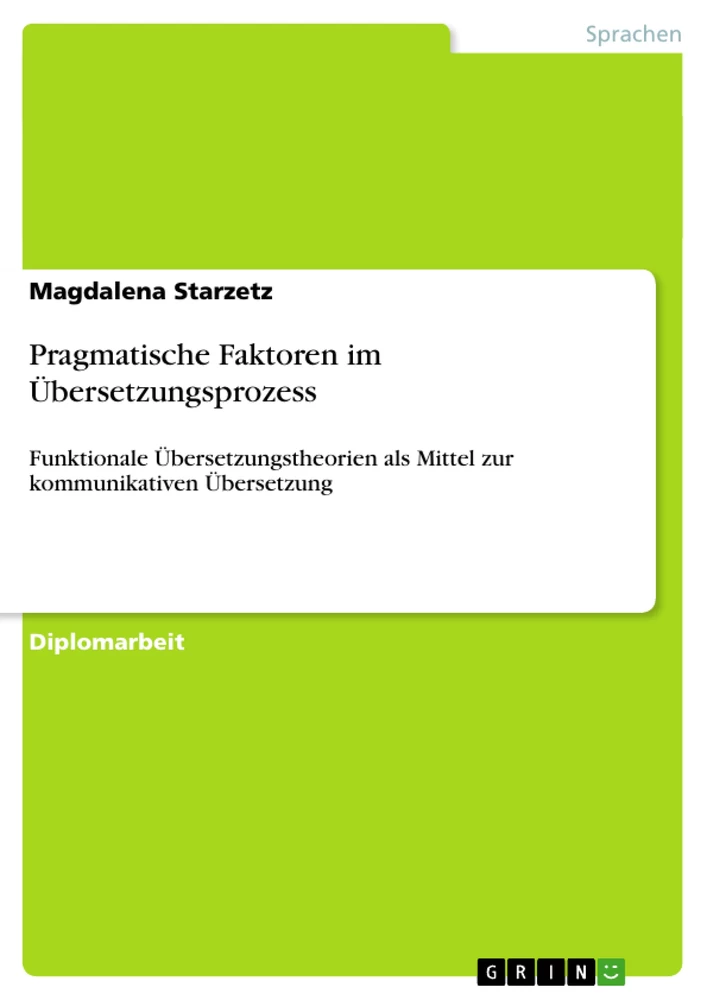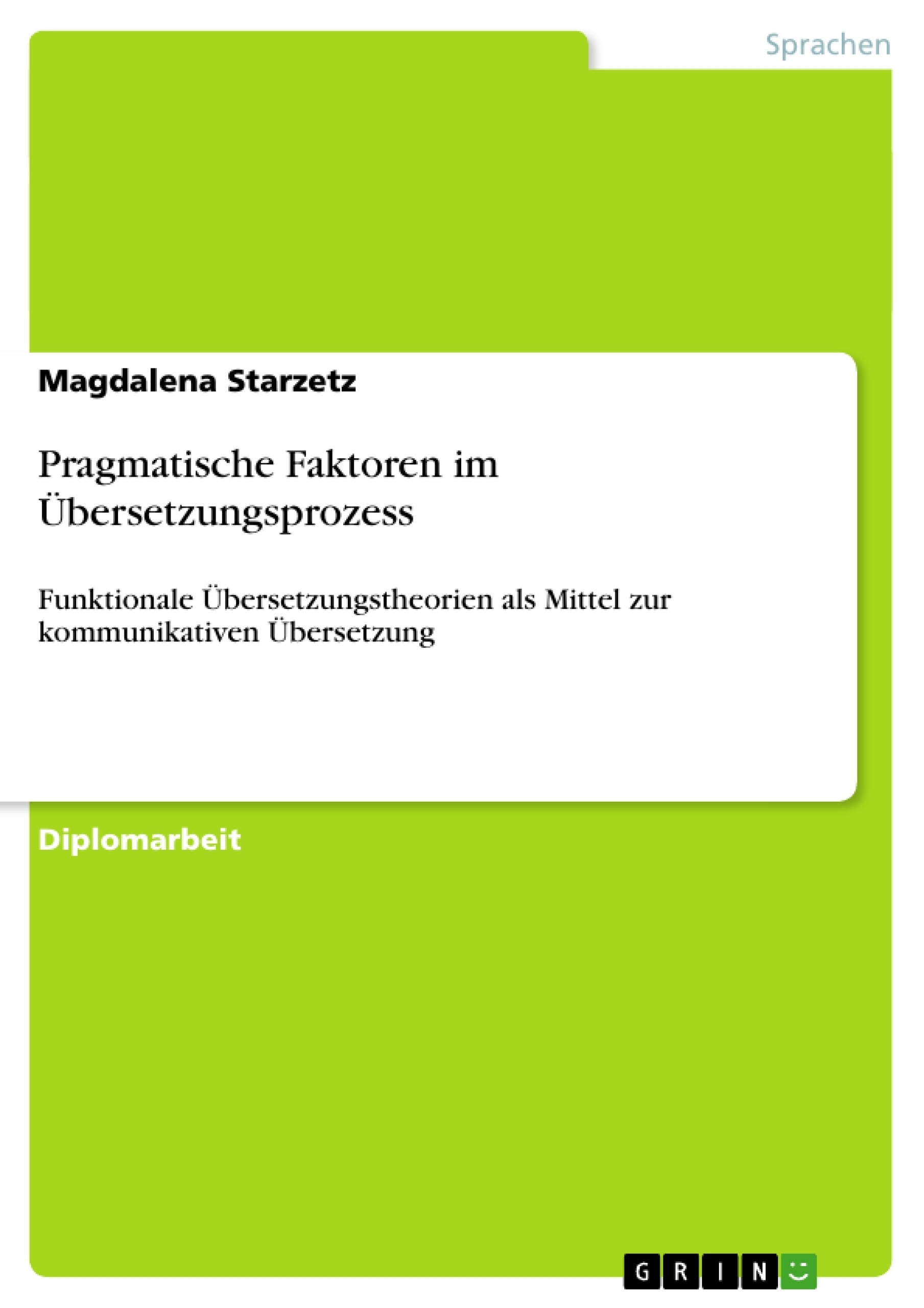Im Sommersemester 2001 wurde am Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim im Rahmen des Übersetzerseminars das in Polen damals neu erschienene „Vademecum tłumacza“ von Krzysztof Lipiński abschnittweise von den Teilnehmern ins Deutsche übersetzt. Ziel war es, eine Übersetzung des „Vademecum“ „für den deutschen Markt“ anzufertigen.
Recht schnell ergaben sich zahlreiche Fragen und Probleme bezüglich der Übersetzungsstrategie, die sich auch unter Berücksichtigung des angestrebten Übersetzungsziels nicht immer einfach lösen ließen, denn das „Vademecum“ beinhaltet eine Fülle von Übersetzungsproblemen, die sich bei näherer Betrachtung als pragmatisch bedingt erweisen. Selbst in Fällen, in denen auf sprachlicher Ebene scheinbar adäquat übersetzt werden konnte, taten sich oftmals Fragen auf, die die außersprachlichen Gegebenheiten der Übersetzung betrafen, z.B.: Inwiefern muss an dieser und jener Stelle auf den zielsprachigen (deutschen) Adressaten eingegangen werden? Welche Intentionen des Autors können berücksichtigt und in die Zielkultur übernommen werden, welche müssen zugunsten des Übersetzungsziels verwischt oder ganz außer Acht gelassen werden? Und welche Eingriffe und Modifikationen dürfen bzw. müssen am Ausgangstext vorgenommen werden, um zu einem „erfolgreichen“ Translat zu gelangen, und woran kann dieser „Erfolg“ überhaupt gemessen werden?
Das Fehlen einer klar umrissenen ausgangssprachlichen wie zielsprachlichen Pragmatik erschwert dem Übersetzer die Entscheidung in solchen Fragen. Oftmals betrachtet er dann Übersetzungsprobleme wie Anspielungen, Realia, Sprichwörter etc. zu eng nur unter linguistischen Gesichtspunkten, statt sie in einen größeren, textuellen und kulturellen Zusammenhang zu setzen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher, vor dem Hintergrund einer hypothetischen Übersetzung des „Vademecum“ ins Deutsche die Bedeutung der pragmatischen Textanalyse und der anschließenden Konstruktion einer zielkulturellen Pragmatik für die Erstellung eines kommunikativen Translats aufzuzeigen. Die Bedeutung der pragmatischen Parameter soll auf diese Weise für jede Phase des Übersetzungsprozesses – also von der Rezeption des Ausgangstextes durch den Übersetzer über die Zieltextproduktion bis hin zur Rezeption des Translats durch den Zieltextempfänger – dokumentiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle der Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft
- Eingrenzung des Begriffs der Pragmatik und allgemeine Begriffsklärung
- Kommunikationstheoretisches Modell der Translation
- Der Übersetzer als Empfänger
- Der Übersetzer als Sender
- Der Text als Kommunikationsinstrument und als Diskurs
- Kriterien der Textualität
- AT-Status und pragmatische Faktoren in verschiedenen funktionalen Ansätzen
- Skopostheorie (Reiß/Vermeer/Nord)
- Texttypologie nach Reiß
- Kommunikativer Ansatz von Hönig/Kußmaul
- Der Begriff der „Gerichtetheit“ nach Neubert
- Pragmatische Textanalyse
- Textexterne Faktoren
- Textinterne Faktoren
- Die Rekonstruktion der Zieltextpragmatik
- Problemstellung und Fragen zur deutschen Zieltextpragmatik
- Festsetzung der Zieltextparameter
- Auswirkungen der Zieltextparameter auf die Übersetzung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung pragmatischer Faktoren im Übersetzungsprozess, insbesondere im Hinblick auf die Erstellung eines kommunikativen Translats. Sie analysiert, wie pragmatische Parameter jede Phase der Übersetzung beeinflussen, von der Rezeption des Ausgangstextes bis zur Rezeption des Zieltextes. Die Arbeit zielt darauf ab, pragmatheoretische Erwägungen als Instrument zur Balance zwischen übersetzerischer Freiheit und Loyalität gegenüber dem Ausgangstext vorzustellen.
- Die Rolle der Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft
- Anwendung verschiedener funktionaler Übersetzungstheorien
- Pragmatische Textanalyse (textexterne und textinterne Faktoren)
- Rekonstruktion der Zieltextpragmatik
- Übersetzerische Entscheidungsfindung im Kontext pragmatischer Parameter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Übersetzung eines polnischen „Vademecums“ ins Deutsche im Rahmen eines Übersetzerseminars. Sie verdeutlicht die zahlreichen pragmatischen Herausforderungen, die sich bei dieser Übersetzung stellten, und die Notwendigkeit einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit pragmatischen Aspekten der Translation. Die Arbeit fokussiert darauf, die Bedeutung der pragmatischen Textanalyse und die Konstruktion einer zielkulturellen Pragmatik für die Erstellung eines kommunikativen Translats aufzuzeigen. Die pragmatischen Parameter sollen für jede Phase des Übersetzungsprozesses dokumentiert werden. Schließlich sollen pragmatheoretische Erwägungen als ein Instrument zur Lösung des Spannungsfeldes zwischen übersetzerischer Freiheit und Loyalität zum Ausgangstext präsentiert werden.
Die Rolle der Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung der Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft. Es wird ein kommunikatives Translationsmodell vorgestellt, das die einzelnen Phasen der Übersetzung und die Funktionen des Übersetzers im Kontext ihrer pragmatischen Bedingungen darlegt. Die Klärung des Pragmatikbegriffs und die Einordnung in das Gesamtgebiet der Übersetzungswissenschaft bilden den Schwerpunkt dieses Kapitels. Die verschiedenen Ebenen der Kommunikation im Übersetzungsprozess werden detailliert analysiert.
AT-Status und pragmatische Faktoren in verschiedenen funktionalen Ansätzen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene übersetzungstheoretische Ansätze, insbesondere funktionale Modelle, auf ihren Beitrag zu einer pragmatischen Betrachtungsweise des Übersetzungsprozesses. Es werden die Skopostheorie (Reiß/Vermeer/Nord), die Texttypologie nach Reiß, der kommunikative Ansatz von Hönig/Kußmaul und der Begriff der „Gerichtetheit“ nach Neubert analysiert und auf ihre Relevanz für die pragmatische Perspektive in der Übersetzung eingegangen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie diese Ansätze die kommunikativen und pragmatischen Aspekte der Translation betonen und wie sie bei der Lösung pragmatisch bedingter Übersetzungsprobleme hilfreich sein können.
Pragmatische Textanalyse: Dieses Kapitel beschreibt eine pragmatische Textanalyse des „Vademecum tłumacza“. Es verwendet einen Fragenkatalog, der sowohl textexterne (Sender, Empfänger, Medium, Kontext etc.) als auch textinterne Faktoren (Textthematik, Inhalt, Aufbau, Lexik, Syntax etc.) berücksichtigt. Die Bedeutung jedes Parameters, insbesondere der pragmatischen Parameter, für die Zieltexterstellung wird ausführlich dargelegt. Es wird detailliert analysiert, wie diese Faktoren die Übersetzung beeinflussen und welche Entscheidungen der Übersetzer im Lichte dieser Faktoren treffen muss.
Die Rekonstruktion der Zieltextpragmatik: Dieses Kapitel befasst sich mit der vom Übersetzer zu definierenden Pragmatik für einen potentiellen deutschen Empfängerkreis. Es wird untersucht, wie Ausgangstextpragmatik und Zieltextpragmatik übersetzerische Entscheidungen beeinflussen. Anhand ausgewählter Beispiele wird deutlich gemacht, wie die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen des deutschen Zielpublikums berücksichtigt werden müssen, um ein kommunikativ erfolgreiches Translat zu erstellen. Die Anpassung an die Zielkultur und die Berücksichtigung der zielsprachlichen Konventionen stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Schlüsselwörter
Pragmatik, Übersetzungsprozess, funktionale Übersetzungstheorien, kommunikative Übersetzung, Textanalyse, Textexterne Faktoren, Textinterne Faktoren, Zieltextpragmatik, Ausgangstextpragmatik, Übersetzerische Entscheidungsfindung, Skopostheorie, Texttypologie, Zielkultur, Adressatenorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung pragmatischer Faktoren im Übersetzungsprozess, insbesondere bei der Erstellung eines kommunikativen Translats. Sie analysiert den Einfluss pragmatischer Parameter auf jede Phase der Übersetzung, von der Rezeption des Ausgangstextes bis zur Rezeption des Zieltextes. Ziel ist es, pragmatheoretische Erwägungen als Instrument zur Balance zwischen übersetzerischer Freiheit und Loyalität zum Ausgangstext darzustellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft, die Anwendung verschiedener funktionaler Übersetzungstheorien (Skopostheorie, Texttypologie nach Reiss, kommunikativer Ansatz von Hönig/Kußmaul, "Gerichtetheit" nach Neubert), die pragmatische Textanalyse (textexterne und textinterne Faktoren), die Rekonstruktion der Zieltextpragmatik und die übersetzerische Entscheidungsfindung im Kontext pragmatischer Parameter. Als Beispiel dient die Übersetzung eines polnischen "Vademecums" ins Deutsche.
Welche funktionalen Übersetzungstheorien werden angewendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Skopostheorie (Reiß/Vermeer/Nord), die Texttypologie nach Reiß, den kommunikativen Ansatz von Hönig/Kußmaul und den Begriff der „Gerichtetheit“ nach Neubert. Diese Ansätze werden analysiert, um ihren Beitrag zu einer pragmatischen Betrachtungsweise des Übersetzungsprozesses zu beleuchten und ihre Hilfestellung bei der Lösung pragmatisch bedingter Übersetzungsprobleme zu zeigen.
Wie wird die pragmatische Textanalyse durchgeführt?
Die pragmatische Textanalyse des polnischen "Vademecums" erfolgt anhand eines Fragenkatalogs, der textexterne Faktoren (Sender, Empfänger, Medium, Kontext etc.) und textinterne Faktoren (Textthematik, Inhalt, Aufbau, Lexik, Syntax etc.) berücksichtigt. Die Bedeutung jedes Parameters, insbesondere der pragmatischen Parameter, für die Zieltexterstellung wird ausführlich dargelegt.
Wie wird die Zieltextpragmatik rekonstruiert?
Die Rekonstruktion der Zieltextpragmatik konzentriert sich auf die vom Übersetzer zu definierende Pragmatik für einen potentiellen deutschen Empfängerkreis. Es wird untersucht, wie Ausgangstextpragmatik und Zieltextpragmatik übersetzerische Entscheidungen beeinflussen. Die Anpassung an die Zielkultur und die Berücksichtigung der zielsprachlichen Konventionen stehen im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pragmatik, Übersetzungsprozess, funktionale Übersetzungstheorien, kommunikative Übersetzung, Textanalyse, Textexterne Faktoren, Textinterne Faktoren, Zieltextpragmatik, Ausgangstextpragmatik, Übersetzerische Entscheidungsfindung, Skopostheorie, Texttypologie, Zielkultur, Adressatenorientierung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Rolle der Pragmatik in der Übersetzungswissenschaft, ein Kapitel zu AT-Status und pragmatischen Faktoren in verschiedenen funktionalen Ansätzen, ein Kapitel zur pragmatischen Textanalyse, ein Kapitel zur Rekonstruktion der Zieltextpragmatik und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Citar trabajo
- Magdalena Starzetz (Autor), 2002, Pragmatische Faktoren im Übersetzungsprozess, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25078