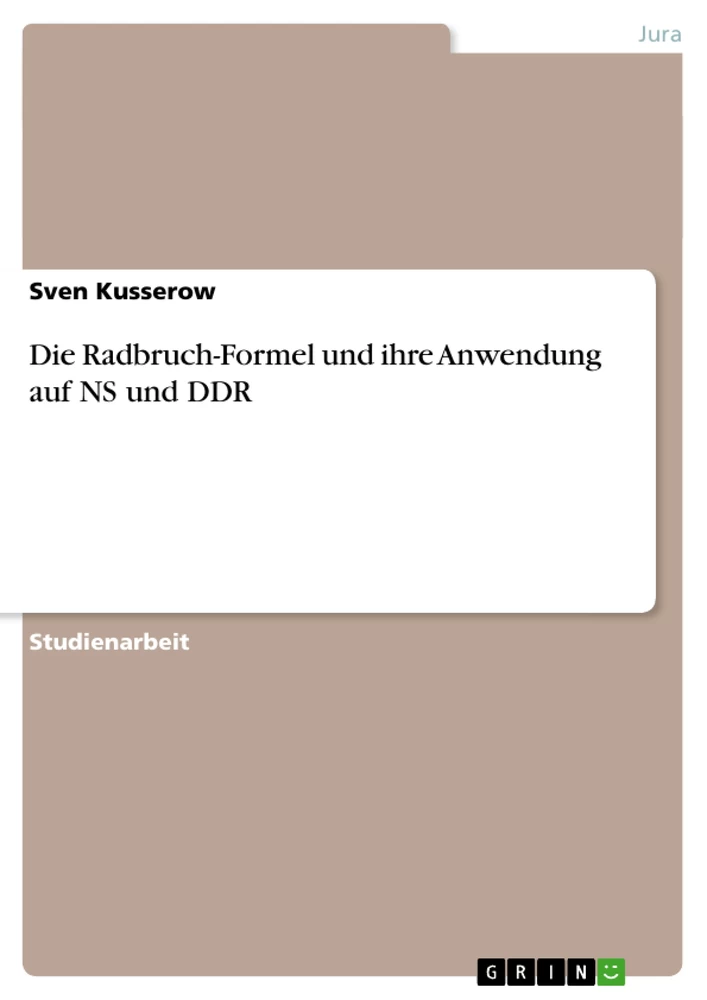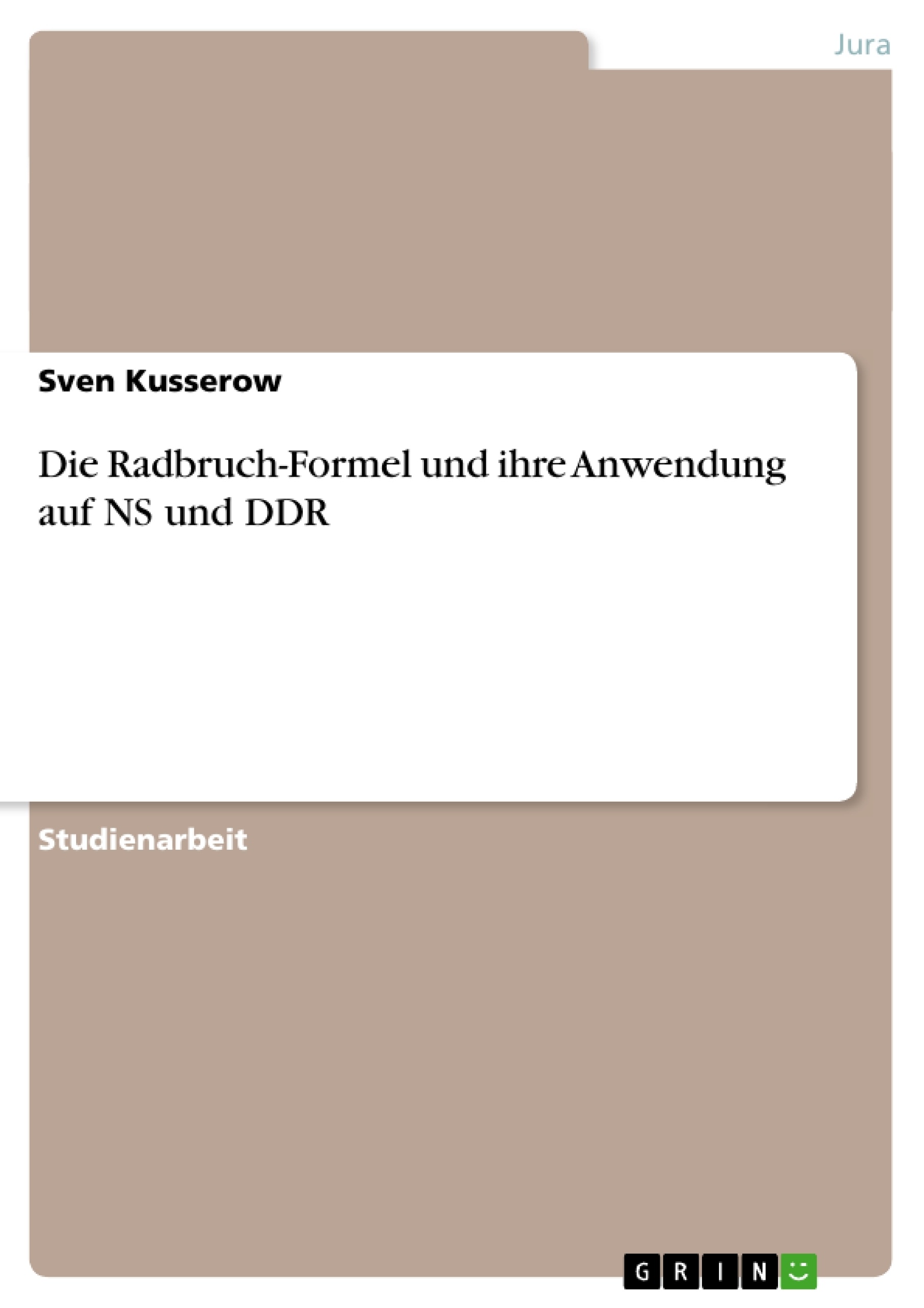Die nachfolgende Arbeit schließt fast direkt an den Relativismus von Hans Kelsen an. Sie
kann sozusagen in gewisser Weise als eine Art Antwort oder Gegenthese verstanden werden,
da man bei der Anwendung der Radbruchschen Formel „aufhört, ein Rechtspositivist
zu sein.“1
Was die Radbruchsche Formel nun im einzelnen ist, wird im Laufe der Arbeit dargelegt
werden. An dieser Stelle soll lediglich erwähnt werden, daß es um den möglichen Konflikt
zwischen Gerechtigkeit und Rechtssic herheit geht, der an einigen konkreten Beispielen
verdeutlicht werden soll. Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet dabei Radbruch selbst, da
die Radbruchsche Formel erst verständlich wird, wenn man sie im Kontext seiner Rechtsphilosophie
(vornehmlich seiner Rechtsidee) sowie deren Entwicklung versteht. Daher
wird sowohl das Leben Radbruchs, seine rechtsphilosophische Entwicklung sowie sein
Begriff von der Rechtsidee vorgestellt. Um der Forderung der vergangenen Seminarsitzungen,
sich mehr auf den Autor der vorgestellten Gerechtigkeitskonzeption zu beziehen,
nachzukommen, wurde, wo es sich ermöglichen lies, nur Radbruchs Gedanken vorgestellt.
Dabei war es für mich nicht immer einfach den Gedanken von Radbruch zu folgen, zumal
ein gewisser rechtsphilosophischer Wandel Radbruchs nach dem zweiten Weltkrieg stattgefunden
hat. Daher weiß ich nicht, inwieweit die Interpretation von Radbruchs Äußerungen
vor dem Dritten Reich im Lichte seiner Äußerungen nach dem Dritten Reich gesehen
werden.
Zum Ende dieser Einleitung möchte ich darauf hinweisen, daß ich kein Student der
Rechtswissenschaft bin. Was womöglich ein Grund dafür sein kann, dass die Darstellung
der Anwendungsbeispiele der Radbruchschen Formel den juristischen Anforderungen und
Erwartungen eventuell nicht genügt. Ich bitte daher um Nachsicht.
1 Alexy, Robert, Mauerschützen: zum Verhältnis von Recht, Moral und Strafbarkeit, Hamburg, 1993, S. 4.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Leben und Werk von Gustav Radbruch
- Zum Leben von Gustav Radbruch
- Zum Werk von Gustav Radbruch
- Exkurs zur rechtsphilosophischen Entwicklung von Gustav Radbruch
- Radbruchs Rechtsidee und Äußerungen zum Naturrecht
- Radbruchs Rechtsidee
- Radbruchs Äußerungen zum Naturrecht
- Das Rückwirkungsverbot: nullum crimen, nulla poena sine lege
- Wurzeln und Bedeutung des Rückwirkungsverbotes: nullum crimen, nulla poe na sine lege
- Die internationale Anerkennung des Rückwirkungsverbotes
- Die rechtlichen Auseinandersetzungen Radbruchs mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus
- Radbruchs rechtliches Urteil über den Nationalsozialismus
- Radbruchs Folgerungen aus den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus-die Radbruchsche Formel
- Die Rechtmäßigkeit der Verurteilung von NS-Unrecht im Lichte eines Rückwirkungsverbots
- Beispiele für die Anwendung der Radbruchschen Formel(n) auf das vom Nationalsozialismus begangene Unrecht
- Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 23, 98-113 vom 14.02.1968
- Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes: BGHZ 3, 94-110
- Beispiel: Mauerschützenurteile
- Zu den Mauerschützenurteilen
- Die maßgebliche Rechtsgrundlage nach dem Einigungsvertrag
- Strategien der deutschen Gerichte um das Rückwirkungsverbot zu umgehen
- Das Landgericht Berlin
- Der Bundesgerichtshof
- Das Bundesverfassungsgericht
- Bewertung der Umgehungstrategien der deutschen Gerichte bezüglich des Rückwirkungsverbots
- Politologische Anmerkungen zum Thema
- Zusammenfassung und Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Radbruchsche Formel und ihre Anwendung auf die Rechtsordnung des Nationalsozialismus und der DDR. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Formel im Kontext von Gustav Radbruchs Rechtsphilosophie, insbesondere seiner Rechtsidee. Darüber hinaus analysiert die Arbeit die Anwendung der Formel in verschiedenen Rechtsfällen und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf Gerechtigkeit und Rechtssicherheit.
- Die Entwicklung der Radbruchschen Formel im Kontext von Radbruchs Rechtsphilosophie
- Die Anwendung der Radbruchschen Formel auf die Rechtsordnung des Nationalsozialismus und der DDR
- Der Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit
- Die Anwendung der Formel in verschiedenen Rechtsfällen
- Die Herausforderungen der Anwendung der Formel in Bezug auf die Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Radbruchsche Formel als Gegenposition zum Relativismus von Hans Kelsen vor und erläutert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet Leben und Werk von Gustav Radbruch, wobei der Fokus auf seiner rechtsphilosophischen Entwicklung und seiner Rechtsidee liegt. Kapitel 3 betrachtet Radbruchs rechtsphilosophische Entwicklung und räumt mit verbreiteten Missverständnissen zu seiner Position auf. Kapitel 4 analysiert Radbruchs Rechtsidee und seine Äußerungen zum Naturrecht. Kapitel 5 befasst sich mit dem Rückwirkungsverbot und seiner Bedeutung im Kontext der Radbruchschen Formel. Kapitel 6 untersucht Radbruchs Auseinandersetzung mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus und die Entstehung der Radbruchschen Formel. Kapitel 7 beleuchtet die Anwendung der Formel auf die Verurteilung von NS-Unrecht im Hinblick auf das Rückwirkungsverbot. Kapitel 8 analysiert die Anwendung der Formel in konkreten Rechtsfällen, wie z.B. der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 1968 und der Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Kapitel 9 widmet sich den Mauerschützenurteilen und den Strategien der deutschen Gerichte, um das Rückwirkungsverbot zu umgehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Rechtsphilosophie, Radbruchsche Formel, Rechtsidee, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Nationalsozialismus, DDR, Rückwirkungsverbot, Rechtsprechung, Mauerschützenurteile.
- Quote paper
- Sven Kusserow (Author), 2000, Die Radbruch-Formel und ihre Anwendung auf NS und DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25044