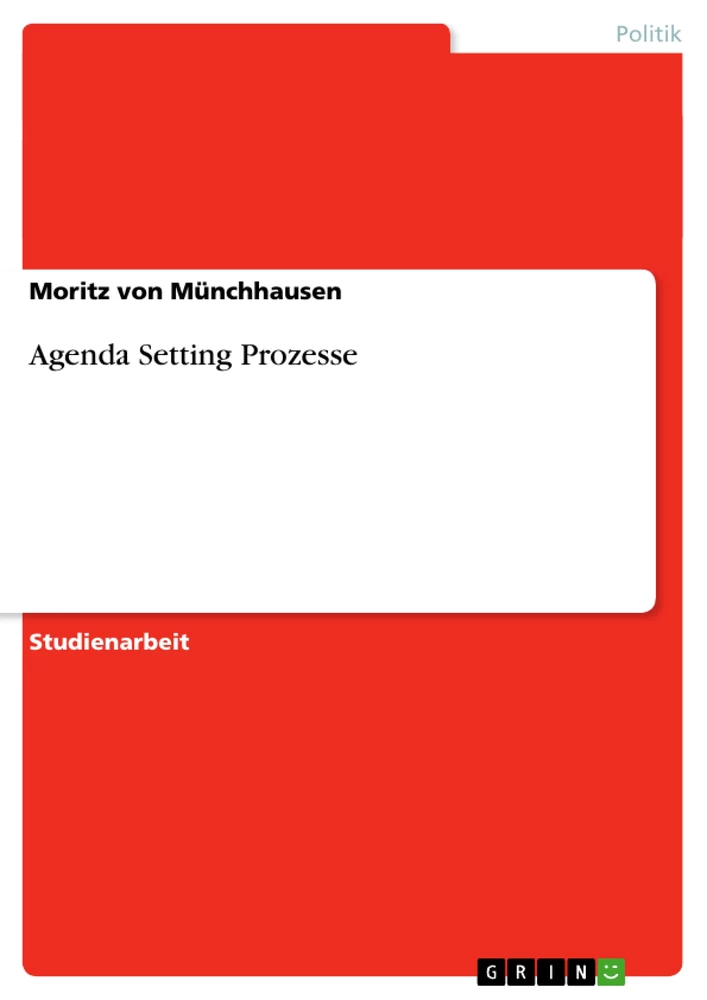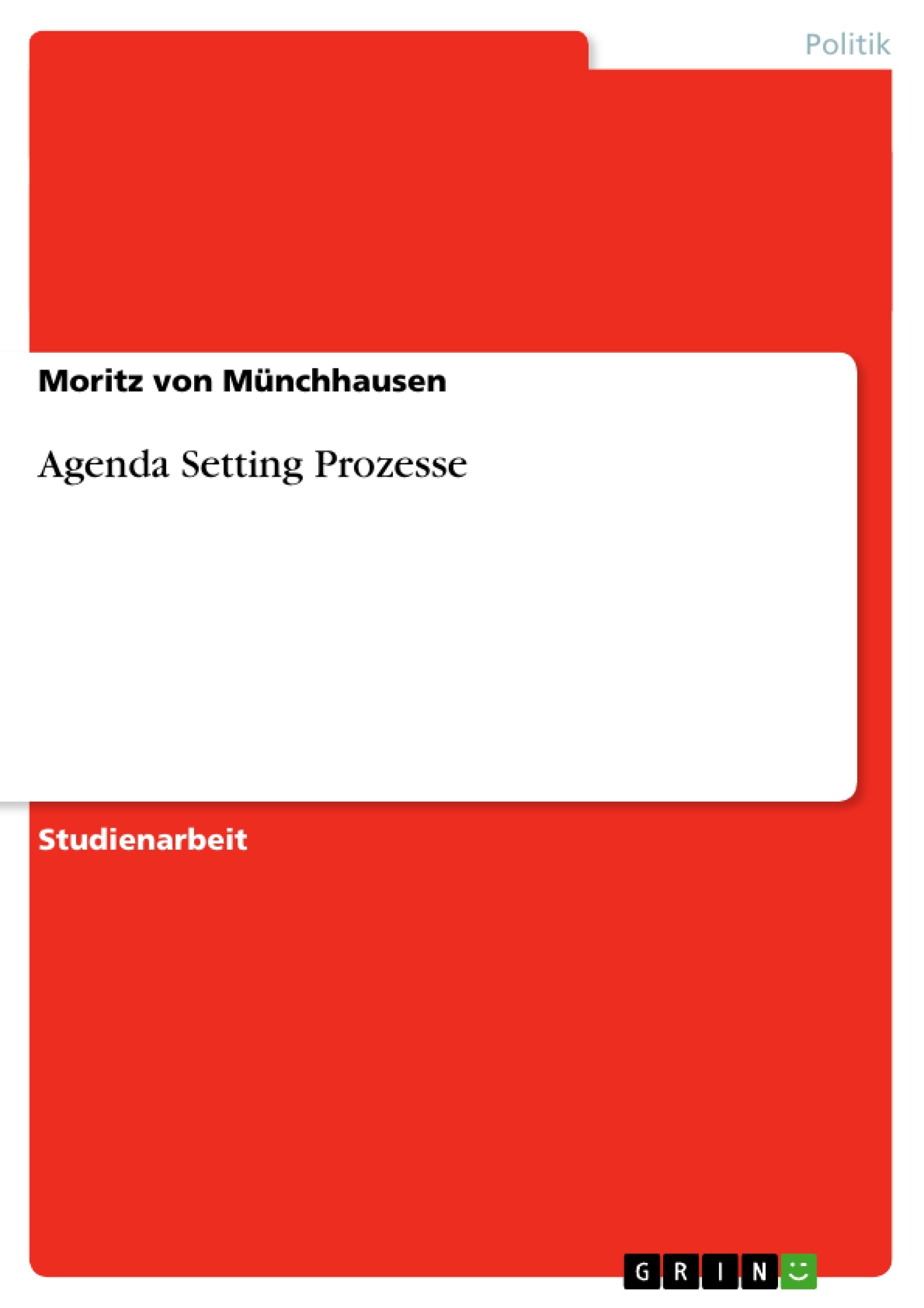In dem Seminar „Analyse der Bundestagswahl 2002“ im Wintersemester ´02/´03 unter der Leitung von Dr. Wolfgang G. Gibowski wurde auf Grundlage von Wahlforschungstheorien das Wählerverhalten der letzten Bundestagswahl untersucht. Besonders von Interesse war die Frage, wie die politischen Parteien ihre Inhalte und Ziele umsetzen konnten und welche Strategien dabei zum Einsatz kamen.
Gründe für das unterschiedliche Wählerverhalten bei dieser spektakulären Wahl, bei der sich vorzeitig der Kanzlerkandidat der CDU/CSU Edmund Stoiber schon als Sieger glaubte, waren neben dem Elbehochwasser, dem möglichen Irak-Krieg (zu dieser Zeit begannen massive Truppenverlegungen der USA in die Nah-Ost-Region die Debatte zu schüren) und den drei Kanzlerduellen im Fernsehen auch die Berichterstattung der Medien, die eine zentrale Rolle bei der Wahrnehmung von Ereignissen und Meinungsbildung der Öffentlichkeit einnehmen. Um diese Prozesse zwischen Medien, Öffentlichkeit und politischer Elite genauer zu betrachten, ist es notwendig, den Agenda–Setting–Ansatz zu erklären und an Beispielen zu verdeutlichen. Bei diesem Ansatz wird angenommen, dass die Medien durch ihre Berichterstattung einen Einfluss darauf ausüben, welche Themen die Rezipienten als wichtig wahrnehmen und welche als weniger wichtig einstufen.
Diese Hausarbeit soll verdeutlichen, was Agenda–Setting-Forschung ist, welches die historischen und theoretischen Hintergründe sind, welche Komponenten zu diesem Prozess gehören und wie es sich in den Begriff der Medienwirkungsforschung eingliedern lässt. Trotzdem kausale Beziehungen schwer aufzudecken sind, hat das Verständnis von Agenda–Building-Prozessen eine wichtige Bedeutung, nicht zuletzt um zu verstehen, wie Akteure (ob auf politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Ebene) ihre Programme öffentlichkeitswirksam durchsetzen.
Die Leitthese, die in dieser Arbeit vertreten wird, soll jedoch belegen, dass der gesamte Agenda-Setting-Ansatz bisher noch zu keiner vollständigen Theorie entwickelt wurde und die vorhandenen Ansätze noch unvollständig sind. Es gibt eine große Vielzahl an Ansätzen und Modellen, allerdings mangelt es noch immer an einer umfassenden und schlüssigen Theoriebildung. Des weiteren soll auch auf Mängel der Ansätze hingewiesen werden und auch, wie diese Mängel beseitigt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Grundlagen und Komponenten
- III. Historischer Hintergrund der Agenda-Setting-Forschung
- IV. Wirkungsmodelle und Theoriebildung
- IVa. Die Wirkungsmodelle
- IVb. Spezifikation: Intervenierende Variablen und Rezipientenfaktoren
- IVc. Priming
- V. Kritik
- VI. Exkurs
- VIa. Gatekeeper-Funktion
- VIb. Die Schweigespirale
- VII. Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Konzept des Agenda-Setting und dessen Bedeutung für die Medienwirkungsforschung. Sie untersucht die historischen und theoretischen Grundlagen dieses Ansatzes und analysiert die Komponenten, die zum Agenda-Setting-Prozess gehören. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Medien durch ihre Themenauswahl den Einfluss auf die Wahrnehmung und Meinungsbildung der Rezipienten ausüben.
- Historisches und theoretisches Fundament des Agenda-Setting
- Komponenten und Wirkungsmechanismen des Agenda-Setting-Prozesses
- Einfluss von Medien auf die Wahrnehmung und Meinungsbildung der Rezipienten
- Kritik an der Agenda-Setting-Theorie und bestehende Mängel
- Bedeutung des Agenda-Setting-Ansatzes für die Medienwirkungsforschung und politische Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und führt in die Thematik des Agenda-Setting ein. Kapitel II beleuchtet die Grundlagen und Komponenten des Ansatzes. Es erklärt den Begriff "Agenda-Setting" und analysiert, wie die Medien durch ihre Themenauswahl die Wahrnehmung ihrer Rezipienten beeinflussen. Kapitel III gibt einen Überblick über den historischen Hintergrund der Agenda-Setting-Forschung und schildert die wegweisende Studie von McCombs und Shaw. Kapitel IV widmet sich verschiedenen Wirkungsmodellen und der Theoriebildung im Bereich des Agenda-Setting. Hier werden unterschiedliche Einflussfaktoren und die Rolle von intervenierenden Variablen sowie Rezipientenfaktoren beleuchtet. Kapitel V befasst sich kritisch mit den Schwächen und Mängeln der Agenda-Setting-Theorie. Es diskutiert die Schwierigkeit, kausale Beziehungen aufzudecken und betrachtet alternative Erklärungsmöglichkeiten. Kapitel VI widmet sich im Exkurs zwei verwandten Konzepten: der Gatekeeper-Funktion und der Schweigespirale.
Schlüsselwörter
Agenda-Setting, Medienwirkungsforschung, Themensetzung, Medienagenda, Rezipienten, Wahrnehmung, Meinungsbildung, Gatekeeper-Funktion, Schweigespirale, politische Kommunikation, Wahlforschung
- Citar trabajo
- Dipl. Verwaltungswissenschaftler Moritz von Münchhausen (Autor), 2003, Agenda Setting Prozesse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25001