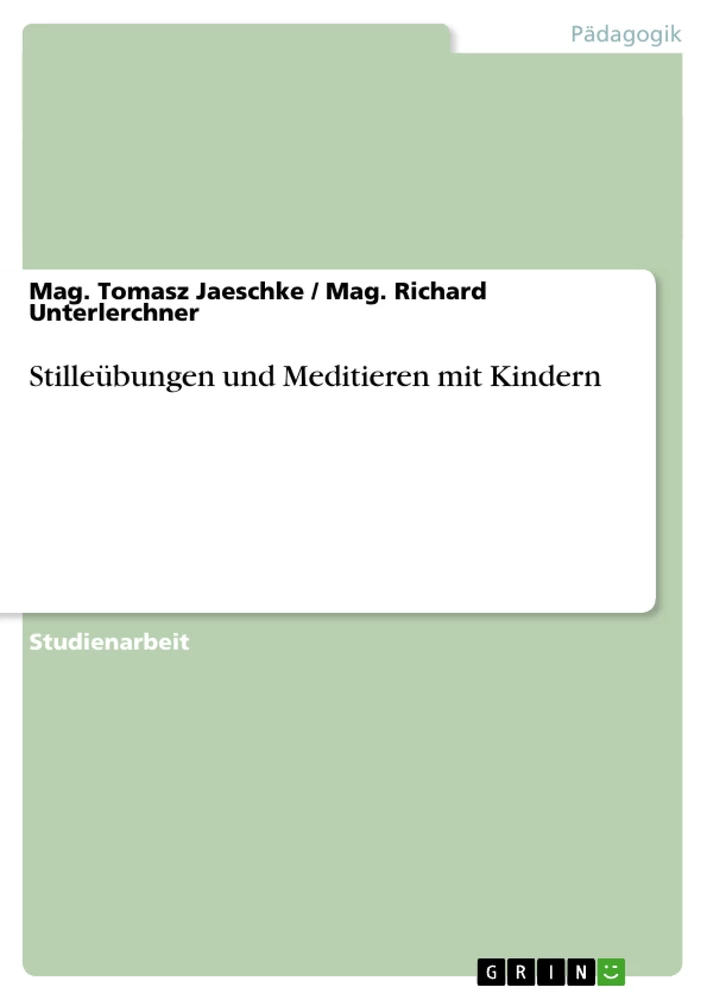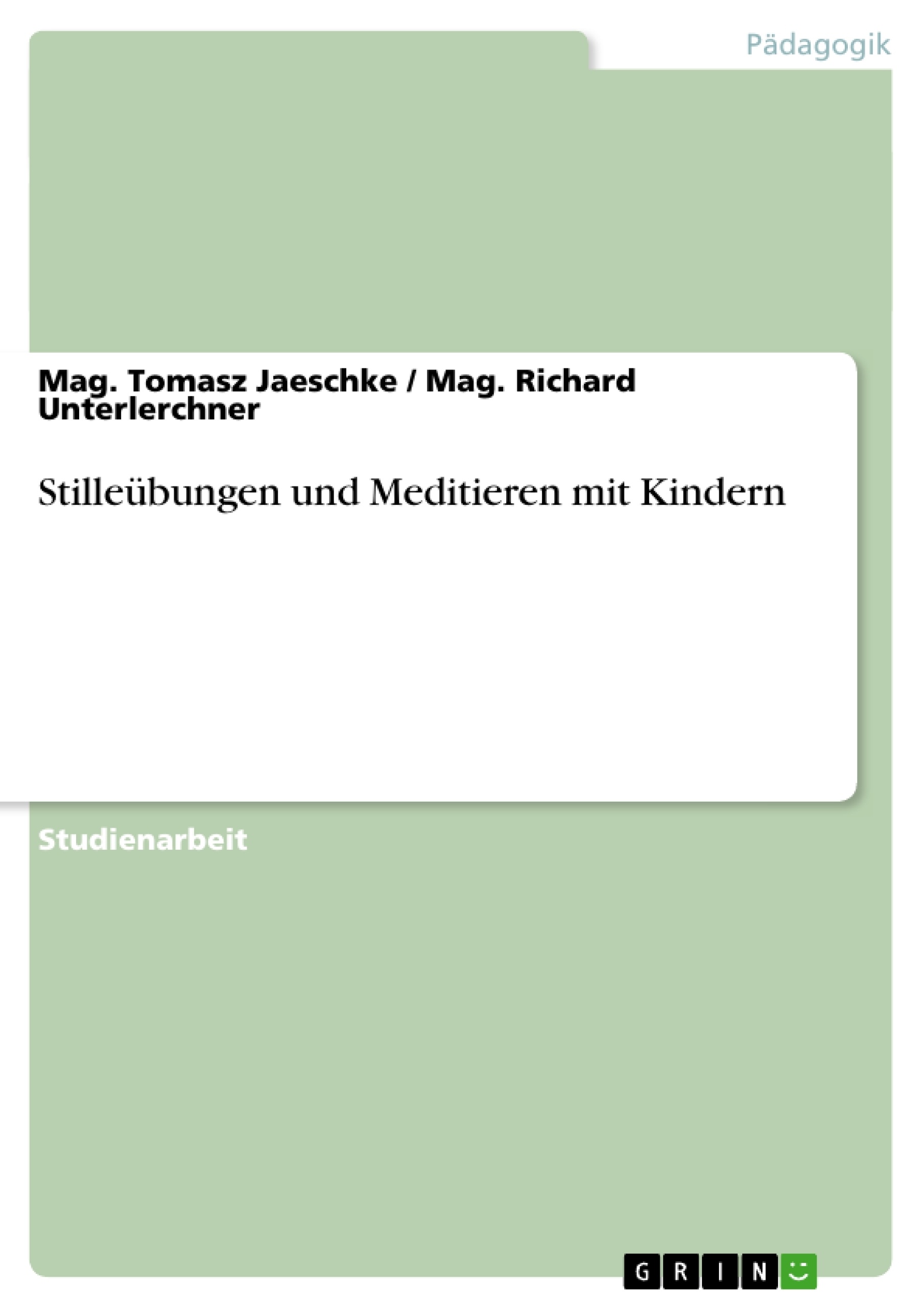Schon der Begriff „Stille“ (S) ist vielschichtig: „Nur in der Stille spricht Gott sein ewiges Wort in der Seele“ meinte Meister Eckehart. Nach Bussmann hingegen sei S. „kein bevorzugter Ort der Gotteserfahrung“. Ein anderer Widerspruch: Viele glauben, dass gerade in der lauten Welt von heute die Stille (S.) ein „knappes Gut“ geworden sei, das leicht als „Gegengewicht zur Beschleunigung“ vermarktet werde. Doch der bewusste Einsatz von S. u. „Schweigen“ hat in der Erziehung eine lange Tradition. Oblinger stellte vierzig Konzeptionen dar, die sich seit der Zeit der Naturvölker entwickelt hatten (Altertum, Orden, Pfadfinder etc). Darum lohnt es sich, den größeren pädagogischen Kontext ein wenig auszuleuchten. Im 1. Teil, einer „Didaktik der Stilleübungen“, versuchen wir drei Positionen darzustellen, die als Dreieck aufeinander bezogen sind: Piepers Werk „Muße und Kult“ erinnerte an ein altes umfassendes Konzept von „Bildung“ (1. 1.). Bollnow ergänzte, indem er die Brücke „Vom Geist des Übens“ zu rezeptiven (Fest-) Erfahrungen schlug (1. 2.). Montessori wiederum führte schon zuvor die beide didaktische Grunderfahrungen „Stille“ und „Üben“ in ihrem Konzept zusammen (1. 3.). Ihre Vorbildwirkung auf religionspädagogische Ansätze von Hubertus Halbfas, Gabriele Faust-Siehl ua war groß ( 1. 4.). Wie kann S. als „spiritueller Erfahrungsraum in der Schule“ eingeübt werden? Dieser Frage gehen wir in dem 2. Teil ( „Methodik des Meditierens mit Kindern“) nach...
Ein Buch, ein Input, eine Hilfestellung für all jene, die in Stillübungen und im Meditieren mit Kindern eine neue Perspektive, eine neue Dimension des pädagogischen Auftrages sehen und wahrnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Didaktik der Stilleübungen
- Josef Pieper: „Muße und Kult“
- Otto Friedrich Bollnow: „Vom Geist des Übens“
- Maria Montessori: „Die Polarisation der Aufmerksamkeit“
- Religionsdidaktik der Stilleübungen
- Methodik des Meditierens mit Kindern
- Praxisbeispiel „Baum“
- Vorüberlegungen
- Präsentation vom 8. 1. 2004
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die pädagogischen Grundlagen von Stilleübungen und Meditation im Kontext des Religionsunterrichts an Pflichtschulen aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Stille als spirituellen Erfahrungsraum und untersucht verschiedene methodische Ansätze, um Stilleübungen und Meditation mit Kindern zu gestalten.
- Didaktik der Stilleübungen: Bedeutung von Stille und Muße in der Bildung, verschiedene pädagogische Ansätze (Pieper, Bollnow, Montessori)
- Methodik des Meditierens mit Kindern: Praktische Anwendung und Gestaltung von Meditationseinheiten für Kinder
- Religionsdidaktik der Stilleübungen: Einbettung von Stilleübungen und Meditation in den Religionsunterricht
- Praxisbeispiel: „Baum“ - Eine konkrete Meditationseinheit für Kinder
- Pädagogische Bedeutung von Stilleübungen und Meditation: Auswirkungen auf die Entwicklung und das Lernen von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Vielschichtigkeit des Begriffs „Stille“ dar und beleuchtet den historischen und pädagogischen Kontext des bewussten Einsatzes von Stille und Schweigen in der Erziehung.
Das erste Kapitel widmet sich der „Didaktik der Stilleübungen“ und präsentiert drei zentrale Positionen: Josef Piepers Werk „Muße und Kult“ zeigt die Bedeutung der Muße für die Bildung auf und betont die Wichtigkeit des „einfachen Schaublicks“. Otto Friedrich Bollnow beschreibt in „Vom Geist des Übens“ die Rolle von Übung und Konzentration für die Entwicklung von Fähigkeiten. Maria Montessori schließlich verbindet die beiden didaktischen Grunderfahrungen „Stille“ und „Üben“ in ihrem Konzept.
Schlüsselwörter
Stille, Muße, Meditation, Übung, Konzentration, Religionsdidaktik, Kinder, Pädagogik, Spirituelle Erfahrungen, Praxisbeispiel „Baum“, Entwicklungsförderung
- Arbeit zitieren
- Mag. Tomasz Jaeschke (Autor:in), Mag. Richard Unterlerchner (Autor:in), 2004, Stilleübungen und Meditieren mit Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24985