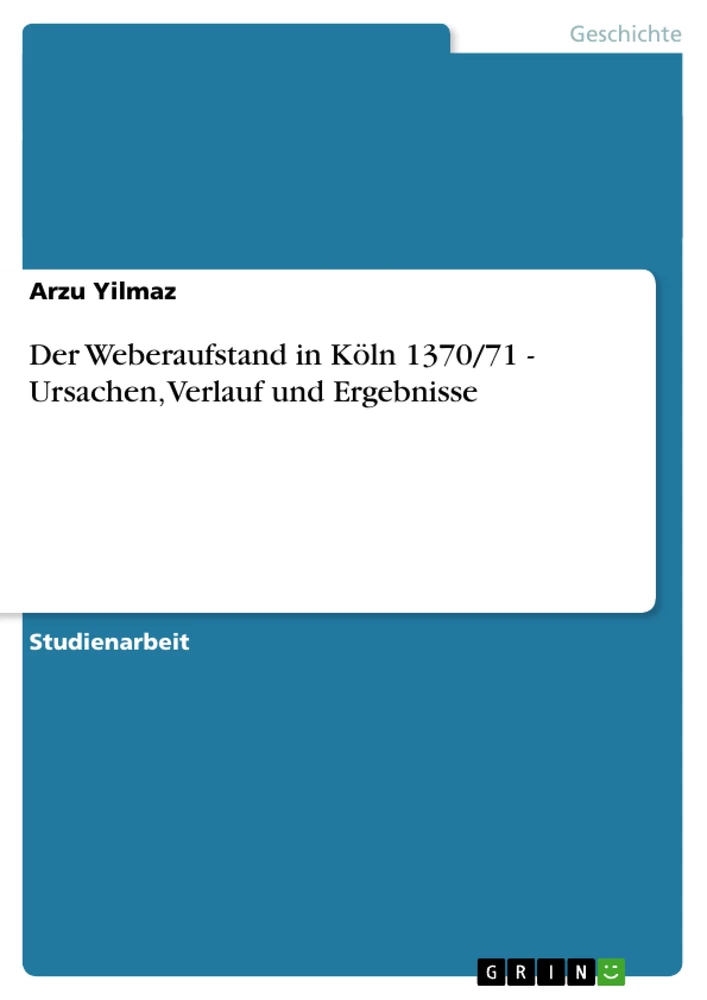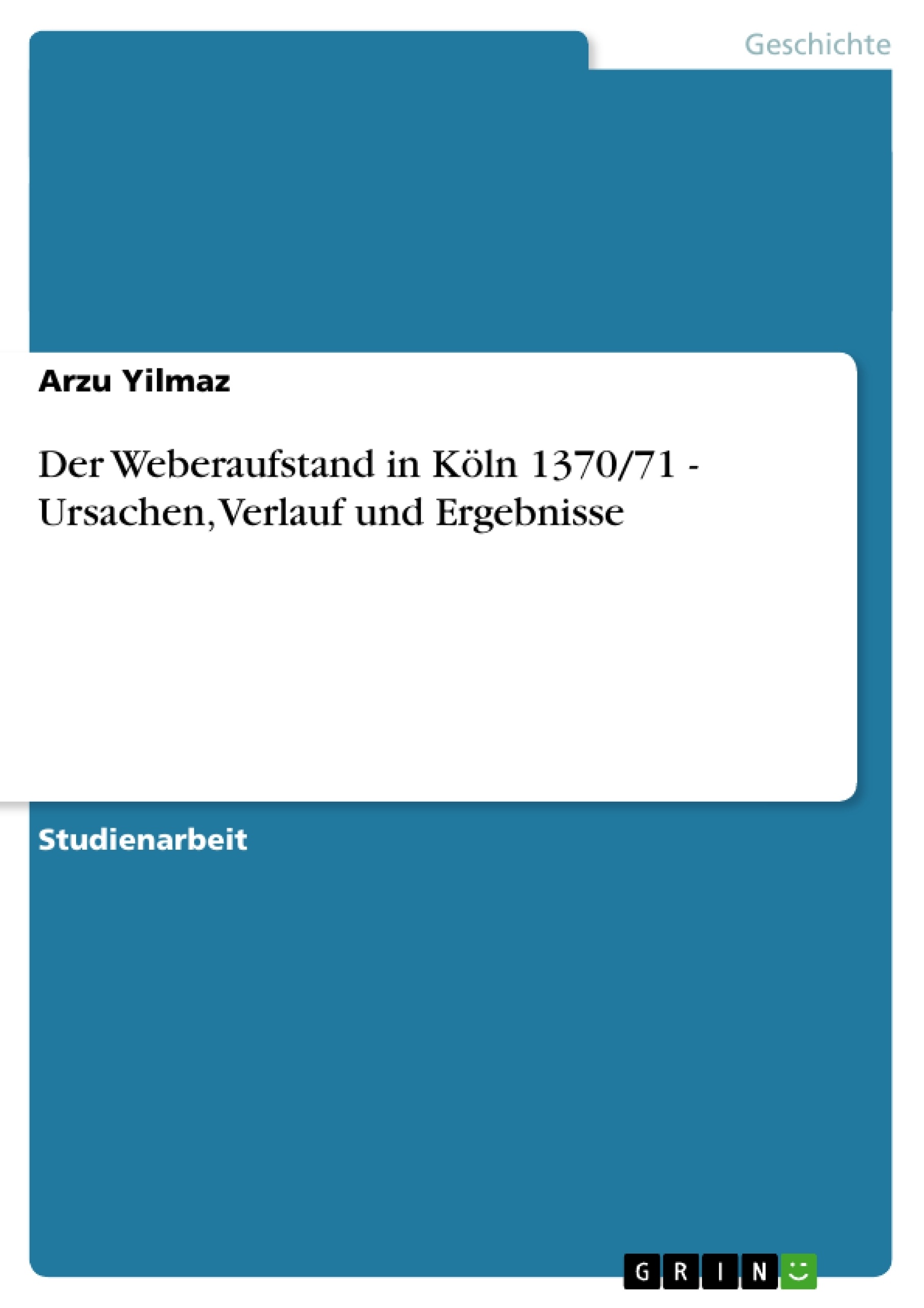[...] Dieser Abschnitt soll zeigen, aus welchem Grunde sich die Bürger gegen die Stadtherrschaft der Erzbischöfe auflehnten. Nach der erzbischöflichen Herrschaftsgeschichte (die leider sehr gerafft dargestellt werden muß) soll das Patriziat (3.2.-3.2.2) angeschnitten werden. Hierbei werde ich den folgenden Fragen nachgehen: 1. Welchen sozialen Status hatte diese Schicht? 2. Gab es Spannungen innerhalb dieser wohlhabenden Schicht? (3.2.1. Kampf der Geschlechter in Köln), und zuletzt, 3. Welche Position hatten sie in der Stadt Köln? Da das Patriziat in der spätmittelalterlichen Geschichte eine sehr große Rolle spielte, wird sich ihre Geschichte wie ein „roter Faden“ durch diese Arbeit ziehen. Die Sozialstruktur der Stadt Köln soll im 4. Punkt behandelt werden. Dabei werde ich erst über den Rat der Stadt schreiben und aufzeigen, wie er zusammengesetzt war, also welche Schichten in ihm vertreten waren. Die Funktionen des Rates werden hierbei nicht berücksichtigt, da das den Rahmen der Arbeit sprengen würde.2 In 4.2. werde ich auf die Bürgerschicht, aber auch nur die, die in der Stadt gelebt hat, und für dieses Thema relevant ist, eingehen. Dabei geht es mir darum zu zeigen, wie man den Status eines Bürgers erlangt, welche Pflichten er gegenüber der Stadt besaß und welche unterschiede es im städtischen Bürgertum gab und ob diese Unterschiede zu Spannungen führten. Hierauf folgt nun das Hauptthema meiner Arbeit, nämlich der Weberaufstand. In diesem Abschnitt sollen die Ursachen (5.1.), der Verlauf (5.2.) und das Ergebnis (5.3.) des Aufstandes behandelt werden. Im letzten Abschnitt (6) der Arbeit werde ich versuchen, den Weberaufstand zu Analysieren. Für diese Analyse erscheint es mir wichtig, die Fragen, wie die Weberherrschaft zu beurteilen war und warum diese nun gescheitert ist, zu beantworten. Zu dem Thema des Weberaufstandes werde ich das Gedicht „Die Weverslaicht“ und „Dit is dat boich van der stede Colne“ von Gotfrid Hagen und eine Kopie einer Quelle, die uns im Grundkurs übergeben wurde, verwenden. 3 Diese Quelle erschien in der „Chronik der niederrheinischen Städte“ 3. Band. 3 Leider ist aus der Kopie der Autor nicht ersichtlich. Anm. d. Verf. .
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Einführung in die Bürgerkämpfe des Spätmittelalters
- Das Herrschaftssystem der Stadt Köln
- Die erzbischöfliche Stadtherrschaft 925 - 1288
- Das Patriziat
- Kampf der Geschlechter in Köln
- Das Patriziat in den städtischen Gremien
- Die Sozialstruktur in Köln: Der Rat und Die bürgerliche Mittelschicht des Spätmittelalters
- Der Rat
- Die bürgerliche Mittelschicht des Spätmittelalters
- Der Weberaufstand von 1370/71
- Die Ursachen
- Die Weberschlacht / Der Verlauf der Ereignisse
- Das Ergebnis der Weberschlacht / Fortdauer und Lösung der Kölner Konflikte
- Analyse der Weberherrschaft / Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Weberaufstand in Köln im Jahr 1370/71. Sie beleuchtet die Ursachen, den Verlauf und die Ergebnisse des Aufstandes und analysiert die Weberherrschaft. Zudem werden die Bürgerkämpfe des Spätmittelalters im Allgemeinen, das Herrschaftssystem der Stadt Köln und die Sozialstruktur der Stadt im 14. Jahrhundert betrachtet.
- Die Bürgerkämpfe des Spätmittelalters
- Das Herrschaftssystem der Stadt Köln
- Die Sozialstruktur der Stadt Köln
- Der Weberaufstand in Köln 1370/71
- Die Weberherrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Weberaufstand in Köln 1370/71 als Gegenstand der Arbeit vor und erläutert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 gibt eine allgemeine Einführung in die Bürgerkämpfe des Spätmittelalters, wobei die Ursachen und Gründe für diese Konflikte sowie die Charakterisierung der Aufstände behandelt werden. Kapitel 3 befasst sich mit dem Herrschaftssystem der Stadt Köln, beginnend mit der erzbischöflichen Stadtherrschaft (3.1) und dem Patriziat (3.2) sowie dem Kampf der Geschlechter innerhalb dieser Schicht (3.2.1). Kapitel 4 behandelt die Sozialstruktur in Köln, wobei der Rat der Stadt (4.1) und die bürgerliche Mittelschicht (4.2) im Fokus stehen. Kapitel 5 widmet sich dem Weberaufstand von 1370/71, indem die Ursachen (5.1), der Verlauf (5.2) und das Ergebnis (5.3) des Aufstandes dargestellt werden. Das letzte Kapitel (6) analysiert die Weberherrschaft und versucht zu erklären, wie die Weberherrschaft zu beurteilen ist und warum sie gescheitert ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Bürgerkämpfe, Stadtgeschichte, Weberaufstand, Köln, Spätmittelalter, Patriziat, Sozialstruktur, Stadtherrschaft, Herrschaftssystem, Ursachen, Verlauf, Ergebnisse, Weberherrschaft.
- Quote paper
- Arzu Yilmaz (Author), 2003, Der Weberaufstand in Köln 1370/71 - Ursachen, Verlauf und Ergebnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24978