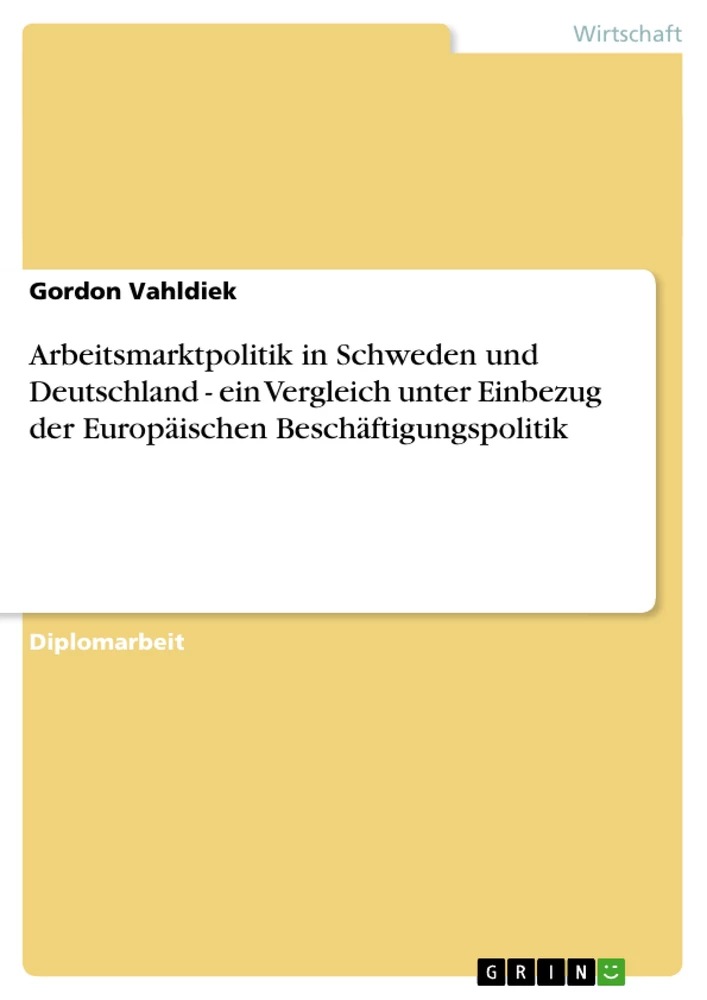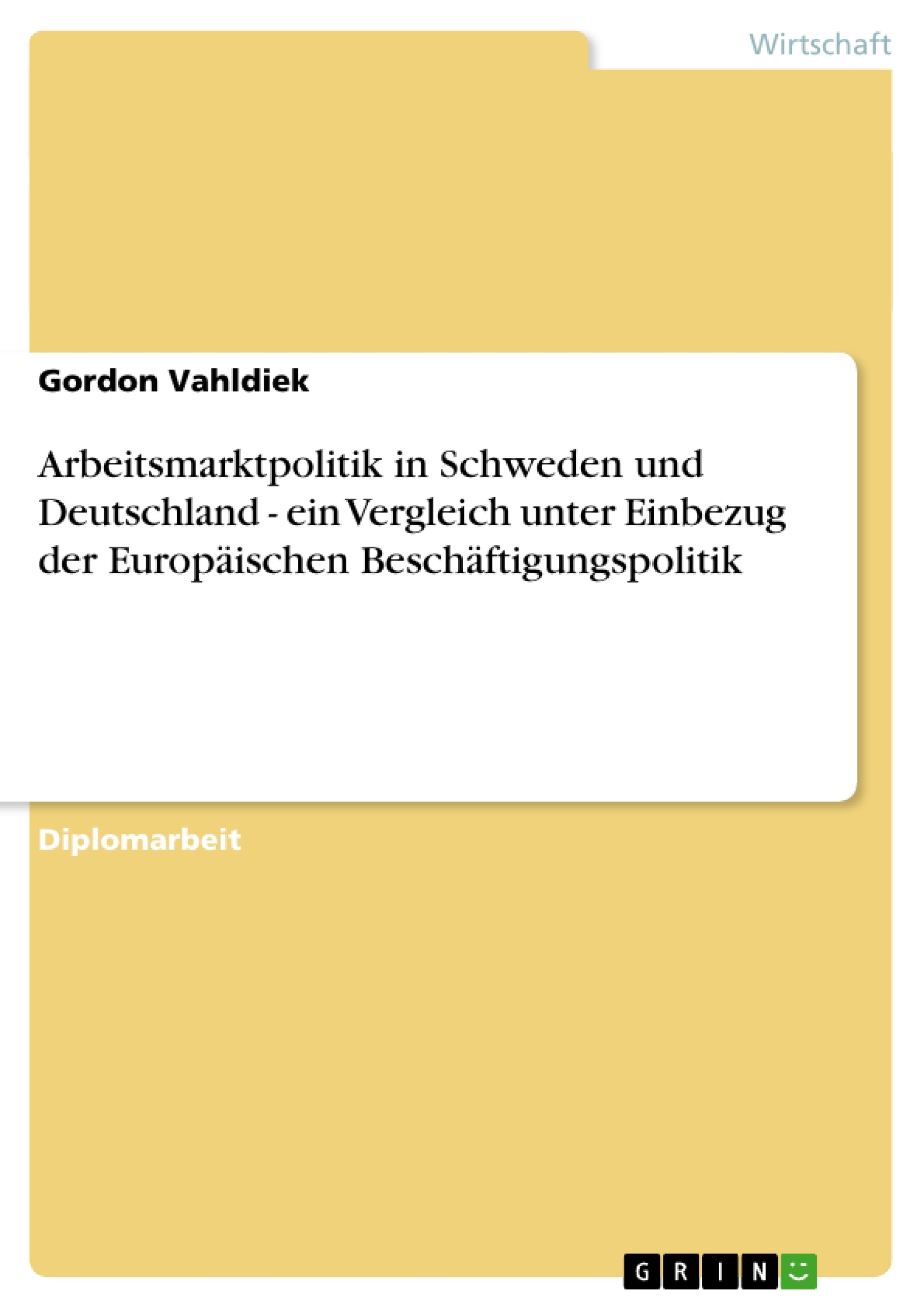Ähnlichkeiten aber auch Differenzen zwischen den schwedischen und deutschen Gesellschaftsmodellen sollen in einer komparativen Analyse herausgearbeitet werden, um mit deren Hilfe die gegensätzlichen Entwicklungen auf den nationalen Arbeitsmärkten zu überprüfen und zu begründen. Dies geschieht im Kontext der europäischen Beschäftigungspolitik, die prinzipiell ähnliche Ziele verfolgt. Am Ende der Darstellung soll die Frage beantwortet werden, ob sich die erfolgreichere schwedische Arbeitsmarktpolitik auf Deutschland übertragen lässt und ob dies als mögliches Vorgehen sinnvoll wäre. Im Kapitel 2 der vorliegen Arbeit werden die historisch-institutionellen Grundlagen der Gesellschaftsmodelle Deutschlands und Schwedens erläutert. Es wird auf historische, kulturelle, wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen eingegangen sowie Differenzen bzw. Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Besondere Bedeutung kommt der Definition des jeweiligen Wohlfahrtsmodells zu, da dies die Basis für die Sozialpolitik und damit auch die Beschäftigungspolitik des Landes bildet. In Kapitel 3 erfolgt der Schritt von der Sozialpolitik der untersuchten Länder zum enger gefassten Feld der Arbeitsmarktpolitik. Auch hierbei wird erneut auf Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der nationalen Arbeitsmärkte eingegangen. Besonders wird dabei auf die Akteure und Problemgruppen der jeweiligen nationalen Arbeitsmärkte eingegangen. In Kapitel 4 erfolgt die Reflektion der bisherigen nationalpolitischen Erkenntnisse auf die Ebene der europäische Beschäftigungspolitik. Dabei wird das wichtigste Instrument der europäischen Beschäftigungspolitik – die Europäische Beschäftigungsstrategie – vorgestellt. Anhand verschiedener Quellen wird der Versuch unternommen, den Einfluss der europäischen Beschäftigungspolitik auf die Nationalpolitik Schwedens und Deutschlands zu verifizieren. Das Kapitel 5 widmet sich der Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den vorhergehenden Abschnitten in Form eines Fazits. Es werden die Ergebnisse der Gegenüberstellung der verschiedenen Gesellschaftsebenen komprimiert und damit die Frage beantwortet, ob eine Übertragbarkeit schwedischer Beschäftigungspolitik auf Deutschland möglich und sinnvoll ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Erkenntnisziel
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Historisch-institutionelle Grundlagen
- 2.1 Politische, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen Schwedens
- 2.1.1 Geographie und Bevölkerung
- 2.1.2 Kulturelle und soziale Rahmenbedingungen
- 2.1.3 Wirtschaft
- 2.1.4 Politik
- 2.2 Politische, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen Deutschlands
- 2.2.1 Geographie und Bevölkerung
- 2.2.2 Kulturelle und Soziale Rahmenbedingungen
- 2.2.3 Wirtschaft
- 2.2.4 Politik
- 2.3 Charakterisierung der Wohlfahrtssysteme
- 2.3.1 Der liberale Wohlfahrtsstaat
- 2.3.2 Der korporatistische Wohlfahrtsstaat
- 2.3.3 Der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat
- 2.3.4 Ergänzung: Der rudimentäre Wohlfahrtsstaat
- 2.4 Das Schwedische Modell
- 2.4.1 Der geschichtliche Kontext des Schwedischen Modells
- 2.4.2 Das Rehn-Meidner-Modell
- 2.4.3 Stagnation und Krise des Schwedischen Modells
- 2.4.4 Ist das Schwedische Modell gescheitert?
- 2.5 Der Wohlfahrtsstaat Deutschland
- 2.5.1 Geschichtlicher Kontext des deutschen Wohlfahrtsstaats
- 2.5.2 Struktur des deutschen Wohlfahrtsystems
- 2.6 Zusammenfassung
- 2.1 Politische, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen Schwedens
- 3 Arbeitsmarktpolitik
- 3.1 Definitionen und Begriffserläuterungen
- 3.2 Akteure auf dem Arbeitsmarkt
- 3.2.1 Die Gewerkschaften
- 3.2.2 Die Organisationen der Arbeitsgeber
- 3.2.3 Der Staat als Akteur auf dem Arbeitsmarkt
- 3.3 Felder der Arbeitsmarktpolitik
- 3.4 Empirische Analyse der Arbeitsmärkte
- 3.4.1 Der deutsche Arbeitsmarkt und spezifische Formen der Arbeitslosigkeit
- 3.4.2 Der schwedische Arbeitsmarkt und spezifische Formen der Arbeitslosigkeit
- 4 Die Rolle der Europäischen Union in der Arbeitsmarktpolitik Deutschlands und Schwedens
- 4.1.1 Die Europäische Beschäftigungsstrategie
- 4.1.1.1 Die EBS nach Amsterdam und Luxemburg
- 4.1.1.2 Die Leitlinien der EBS von 1997 bis 2001
- 4.1.1.3 Fünf Jahre EBS: Eine Überprüfung und Bewertung
- 4.1.1.4 Die Neuausrichtung der EBS nach 2002
- 4.1.1.5 Kritische Betrachtung der neuen EBS 2003
- 4.1.2 Die Bedeutung der EBS aus deutscher Sicht
- 4.1.3 Die Bedeutung der EBS aus schwedischer Sicht
- 4.1.1 Die Europäische Beschäftigungsstrategie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland vergleichend zu analysieren und dabei die Rolle der Europäischen Beschäftigungspolitik zu berücksichtigen. Der Fokus liegt auf den historischen und institutionellen Grundlagen beider Systeme sowie deren empirischen Unterschiede.
- Vergleich der Wohlfahrtsstaaten Schweden und Deutschlands
- Analyse der jeweiligen Arbeitsmarktstrukturen
- Einfluss der Europäischen Beschäftigungsstrategie auf beide Länder
- Unterschiede in den Ansätzen der Arbeitsmarktpolitik
- Empirische Betrachtung der Arbeitsmärkte in Schweden und Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, erläutert das Erkenntnisziel – einen Vergleich der Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland unter Berücksichtigung der europäischen Beschäftigungspolitik – und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
2 Historisch-institutionelle Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Schweden und Deutschland, die die Entwicklung ihrer jeweiligen Arbeitsmarktpolitiken geprägt haben. Es charakterisiert die Wohlfahrtssysteme beider Länder, wobei das "Schwedische Modell" und seine Entwicklung, einschließlich seiner Krise, im Detail analysiert werden. Der geschichtliche Kontext und die Struktur des deutschen Wohlfahrtsstaates werden ebenfalls umfassend betrachtet, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme herauszustellen. Der Vergleich der Wohlfahrtsstaaten dient als Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Arbeitsmarktpolitiken.
3 Arbeitsmarktpolitik: Dieses Kapitel beginnt mit Definitionen und Begriffserklärungen relevanter Arbeitsmarktbegriffe. Es analysiert die wichtigsten Akteure auf dem Arbeitsmarkt (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Staat) und beschreibt verschiedene Felder der Arbeitsmarktpolitik. Der Schwerpunkt liegt auf einer empirischen Analyse der deutschen und schwedischen Arbeitsmärkte, inklusive spezifischer Formen der Arbeitslosigkeit. Diese empirischen Daten dienen als Grundlage für den späteren Vergleich und die Analyse des Einflusses der europäischen Politik.
Schlüsselwörter
Arbeitsmarktpolitik, Schweden, Deutschland, Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS), Wohlfahrtsstaat, Sozialdemokratie, Korporatismus, Liberaler Wohlfahrtsstaat, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Arbeitslosigkeit, empirische Analyse, Vergleichende Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vergleichende Analyse der Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland und untersucht dabei die Rolle der Europäischen Beschäftigungsstrategie. Der Fokus liegt auf den historischen und institutionellen Grundlagen beider Systeme sowie ihren empirischen Unterschieden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Historisch-institutionelle Grundlagen, Arbeitsmarktpolitik und Die Rolle der Europäischen Union in der Arbeitsmarktpolitik Deutschlands und Schwedens. Die Einleitung beschreibt das Erkenntnisziel und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Wohlfahrtssysteme beider Länder. Das dritte Kapitel analysiert die Akteure und Felder der Arbeitsmarktpolitik und präsentiert eine empirische Analyse der Arbeitsmärkte. Das vierte Kapitel untersucht den Einfluss der Europäischen Beschäftigungsstrategie.
Welche Länder werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Arbeitsmarktpolitik von Schweden und Deutschland.
Welche Rolle spielt die Europäische Union?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) auf die Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland. Die Analyse umfasst die Entwicklung der EBS, ihre Bedeutung für beide Länder und eine kritische Betrachtung.
Welche Aspekte der Wohlfahrtsstaaten werden betrachtet?
Die Arbeit charakterisiert die Wohlfahrtssysteme Schwedens und Deutschlands, insbesondere das "Schwedische Modell" mit seinen geschichtlichen Entwicklungen und Krisen. Der Vergleich der Wohlfahrtsstaaten dient als Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Arbeitsmarktpolitiken.
Welche empirischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Analyse der deutschen und schwedischen Arbeitsmärkte, einschließlich spezifischer Formen der Arbeitslosigkeit. Diese Daten dienen dem Vergleich und der Analyse des Einflusses der europäischen Politik.
Welche Akteure auf dem Arbeitsmarkt werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die wichtigsten Akteure auf dem Arbeitsmarkt: Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und den Staat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitsmarktpolitik, Schweden, Deutschland, Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS), Wohlfahrtsstaat, Sozialdemokratie, Korporatismus, Liberaler Wohlfahrtsstaat, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Arbeitslosigkeit, empirische Analyse, Vergleichende Politikwissenschaft.
Was ist das Erkenntnisziel der Arbeit?
Das Erkenntnisziel ist ein vergleichender Analyse der Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland unter Berücksichtigung der europäischen Beschäftigungspolitik.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einer logischen Struktur mit Einleitung, detaillierter Auseinandersetzung mit den historischen und institutionellen Grundlagen, Analyse der Arbeitsmarktpolitik und schließlich der Rolle der Europäischen Union.
- Quote paper
- Gordon Vahldiek (Author), 2004, Arbeitsmarktpolitik in Schweden und Deutschland - ein Vergleich unter Einbezug der Europäischen Beschäftigungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24971