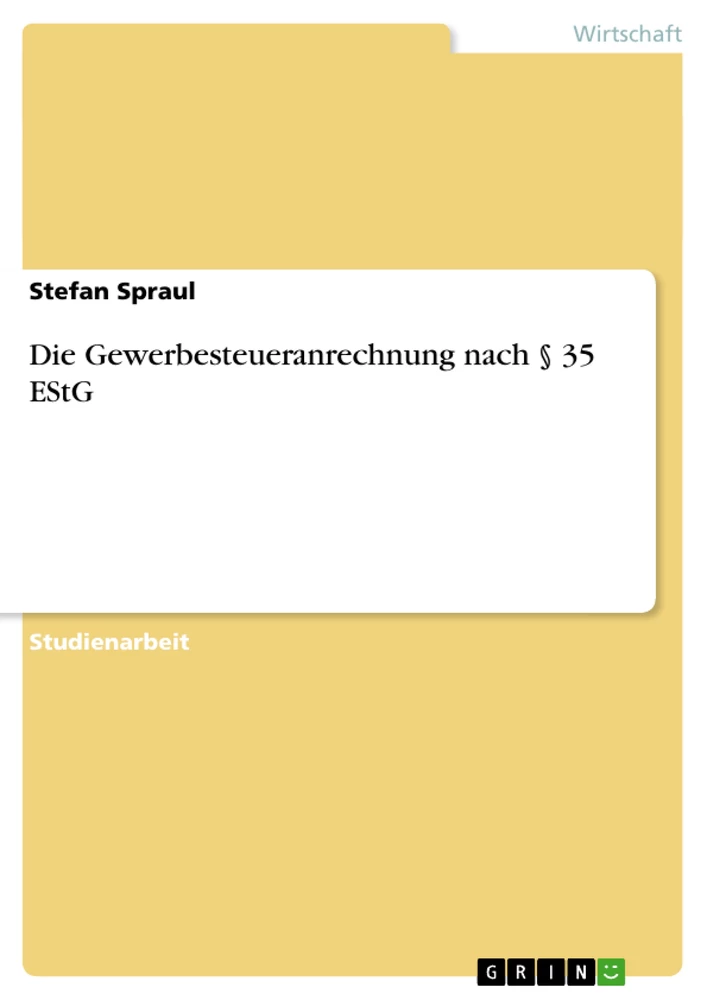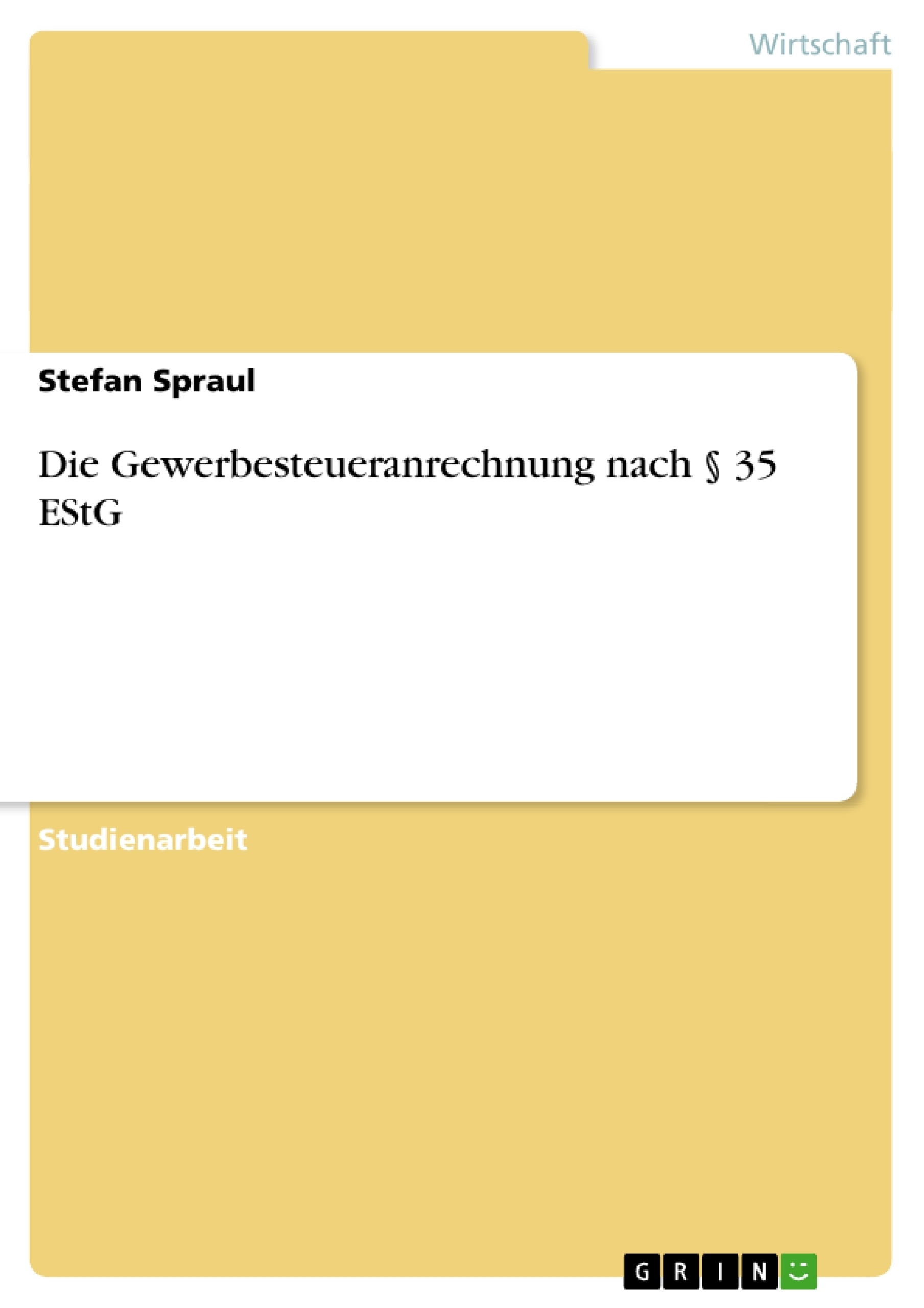Die Unternehmenssteuerreform 2001 hat sich zum Ziel gesetzt die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft zu stärken. Die Senkung der Steuerbelastung von Unternehmen soll
gleichzeitig in einer Weise vorgenommen werden, dass mehr Gerechtigkeit entsteht.
Gerechtigkeit ist zum einen an der Besteuerung einzelner Personen zu messen und zum
anderen an vergleichbarer Belastung unterschiedlicher Rechtsformen. Ein wesentlicher
Bestandteil des zum 01.01.2001 in Kraft getretenen Steuersenkungsgesetzes ist die Starke
Absenkung des Körperschaftsteuersatzes auf 25 %, sowohl für ausgeschüttete Gewinne als
auch für thesaurierte Gewinne im Zusammenhang mit der Einführung des
Halbeinkünfteverfahrens.1
Obwohl neben dieser Absenkung auch die Einkommensteuerspitzensätze auf 48,5 % ab dem
VZ 2001 über 45,0 % ab dem VZ 20042 auf letztendlich 42,0 % ab dem VZ 2005 gesenkt
worden sind, handelt sich der Gesetzgeber das Problem der Steuerspreizung ein. Hinzu kam,
dass die mit dem StandOG eingeführte Tarifkappung des § 32c EStG (gültig ab VZ 1994) auf
Dauer nicht mehr haltbar gewesen ist, da der BFH in seinem Urteil vom 24.02.1999 (BStBl. II
1999, S. 450) hierin einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1
GG) gesehen hat, was zu einer weiteren Benachteiligung von Personenunternehmen
gegenüber den Kapitalgesellschaften geführt hätte. Aus diesen Gründen sind die
Überlegungen des Gesetzgebers dahin gegangen, neben den o.g. Änderungen - durch eine
Kombination von Körperschaftssteuer und einer nicht anrechenbarer Gewerbesteuer einerseits
und andererseits einer Einkommensteuer unter Anrechnung der Gewerbesteuer - eine
annähernde Gleichbelastung von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften zu
erreichen. Ein weiterer Grund für diese Überlegungen ist die seit längerem kritisierte
Doppelbelastung der gewerblichen Einkünfte mit Gewerbesteuer und Einkommensteuer im
Vergleich zu anderen Einkünften, wie beispielsweise die aus selbständiger Arbeit gewesen.3
Ursprünglich ist die Belastung der gewerblichen Einkünfte mit Gewerbesteuer damit
begründet worden, dass Gewerbebetriebe in besonderem Umfang die von den Gemeinden zur
Verfügung gestellte Infrastruktur in Anspruch nehmen. [...]
1 Vgl. StSenkG vom 23.10.2000, BGBl. I 2000, S. 1433.
2 Vgl. StÄndG 2003 vom 13.12.2003, BGBl. I 2003, S. 2645.
3 Vgl. Wendt, FR 2000, S. 1173.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gewerbesteueranrechnungsverfahren
- Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich
- Zeitlicher Anwendungsbereich
- Ermittlung der Steuerermäßigung
- Das Anrechnungsvolumen
- Der Ermäßigungshöchstbetrag
- Der absolute Ermäßigungshöchstbetrag
- Der relative Ermäßigungshöchstbetrag
- Der Anrechnungsüberhang
- Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften
- Aufteilung des Gewerbesteuer-Messbetrags auf die Mitunternehmer
- Anteiliger Gewerbesteuer-Messbetrag eines mittelbar beteiligten Mitunternehmers
- Besonderheiten bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien
- Besonderheiten bei unterjährigem Gesellschafterwechsel
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Betriebsverlegung in Gewerbesteueroasen
- Gewerbesteuerliche Modifikationen
- Verhinderung von Anrechnungsüberhängen
- Wahl der getrennten Veranlagung
- Probleme bei Mitunternehmerschaften
- Verminderung von Anrechnungsüberhängen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gewerbesteueranrechnung nach § 35 EStG und deren Gestaltungsmöglichkeiten. Sie beleuchtet das Anrechnungsverfahren, die Ermittlung der Steuerermäßigung und Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften. Der Fokus liegt auf der Analyse der Möglichkeiten zur Optimierung der Steuerbelastung für Unternehmen.
- Gewerbesteueranrechnungsverfahren nach § 35 EStG
- Ermittlung der Steuerermäßigung und Höchstbeträge
- Besonderheiten bei verschiedenen Unternehmensformen (z.B. Mitunternehmerschaften)
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Steueroptimierung
- Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteueranrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Unternehmenssteuerreform 2001 und deren Zielsetzung, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken und mehr Gerechtigkeit im Steuersystem zu schaffen. Sie erläutert die Senkung des Körperschaftsteuersatzes und die damit verbundenen Herausforderungen, wie die Steuerspreizung und die Problematik der Doppelbelastung gewerblicher Einkünfte. Die Einleitung führt in die Thematik der Gewerbesteueranrechnung ein und begründet die Notwendigkeit einer näherungsweisen Gleichbelastung von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften.
Das Gewerbesteueranrechnungsverfahren: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Verfahren der Gewerbesteueranrechnung. Es beleuchtet den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich, definiert die relevanten Parameter und erklärt den zeitlichen Rahmen der Anrechnung. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung des Verfahrens und der Klärung der rechtlichen Grundlagen.
Ermittlung der Steuerermäßigung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Berechnung der Steuerermäßigung. Es erklärt das Anrechnungsvolumen, den Ermäßigungshöchstbetrag (sowohl absolut als auch relativ) und den Anrechnungsüberhang. Die Ausführungen liefern detaillierte Einblicke in die komplexen Berechnungsmethoden und deren Anwendung in der Praxis. Die verschiedenen Szenarien und deren Auswirkungen auf die Steuerlast werden sorgfältig analysiert.
Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften: Dieses Kapitel behandelt die spezifischen Herausforderungen der Gewerbesteueranrechnung bei Mitunternehmerschaften. Es beschreibt die Aufteilung des Gewerbesteuer-Messbetrags auf die Mitunternehmer, die Besonderheiten bei mittelbar beteiligten Mitunternehmern und die Komplexität bei Kommanditgesellschaften auf Aktien sowie bei unterjährigen Gesellschafterwechseln. Die Kapitel erörtert die rechtlichen und praktischen Implikationen dieser Besonderheiten.
Gestaltungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten, die Steuerbelastung durch geschickte Gestaltung der Unternehmensstruktur und -aktivitäten zu optimieren. Es analysiert verschiedene Strategien wie Betriebsverlegungen, gewerbesteuerliche Modifikationen und die Vermeidung von Anrechnungsüberhängen. Die Wahl der getrennten Veranlagung und die Herausforderungen bei Mitunternehmerschaften werden ebenfalls eingehend betrachtet. Die Kapitel zeigt sowohl Chancen als auch Risiken der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Schlüsselwörter
Gewerbesteueranrechnung, § 35 EStG, Steuerermäßigung, Anrechnungsvolumen, Ermäßigungshöchstbetrag, Anrechnungsüberhang, Mitunternehmerschaft, Gestaltungsmöglichkeiten, Steueroptimierung, Unternehmenssteuerreform.
FAQ: Gewerbesteueranrechnung nach § 35 EStG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gewerbesteueranrechnung nach § 35 EStG und deren Gestaltungsmöglichkeiten. Sie untersucht das Anrechnungsverfahren, die Ermittlung der Steuerermäßigung und Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften, mit Fokus auf die Optimierung der Steuerbelastung für Unternehmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themen: Gewerbesteueranrechnungsverfahren nach § 35 EStG, Ermittlung der Steuerermäßigung und Höchstbeträge, Besonderheiten bei verschiedenen Unternehmensformen (z.B. Mitunternehmerschaften), Gestaltungsmöglichkeiten zur Steueroptimierung und Probleme und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteueranrechnung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Gewerbesteueranrechnungsverfahren, der Ermittlung der Steuerermäßigung, Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie endet mit einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt die Unternehmenssteuerreform 2001, deren Zielsetzung (Wettbewerbsfähigkeit stärken, mehr Gerechtigkeit), die Senkung des Körperschaftsteuersatzes, die Steuerspreizung, die Problematik der Doppelbelastung gewerblicher Einkünfte und die Notwendigkeit einer näherungsweisen Gleichbelastung von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften.
Was beinhaltet das Kapitel zum Gewerbesteueranrechnungsverfahren?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Verfahren der Gewerbesteueranrechnung, inklusive persönlichem und sachlichem Anwendungsbereich, relevanten Parametern und dem zeitlichen Rahmen der Anrechnung.
Worum geht es im Kapitel zur Ermittlung der Steuerermäßigung?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Berechnung der Steuerermäßigung, erklärt das Anrechnungsvolumen, den Ermäßigungshöchstbetrag (absolut und relativ) und den Anrechnungsüberhang, inklusive detaillierter Berechnungsmethoden und deren Anwendung in der Praxis.
Welche Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften werden behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Aufteilung des Gewerbesteuer-Messbetrags, Besonderheiten bei mittelbar beteiligten Mitunternehmern, Kommanditgesellschaften auf Aktien und unterjährigen Gesellschafterwechseln, inklusive rechtlicher und praktischer Implikationen.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten werden analysiert?
Dieses Kapitel analysiert Strategien zur Steueroptimierung wie Betriebsverlegungen, gewerbesteuerliche Modifikationen, Vermeidung von Anrechnungsüberhängen, Wahl der getrennten Veranlagung und Herausforderungen bei Mitunternehmerschaften, inklusive Chancen und Risiken.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Gewerbesteueranrechnung, § 35 EStG, Steuerermäßigung, Anrechnungsvolumen, Ermäßigungshöchstbetrag, Anrechnungsüberhang, Mitunternehmerschaft, Gestaltungsmöglichkeiten, Steueroptimierung, Unternehmenssteuerreform.
- Quote paper
- Stefan Spraul (Author), 2004, Die Gewerbesteueranrechnung nach § 35 EStG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24807