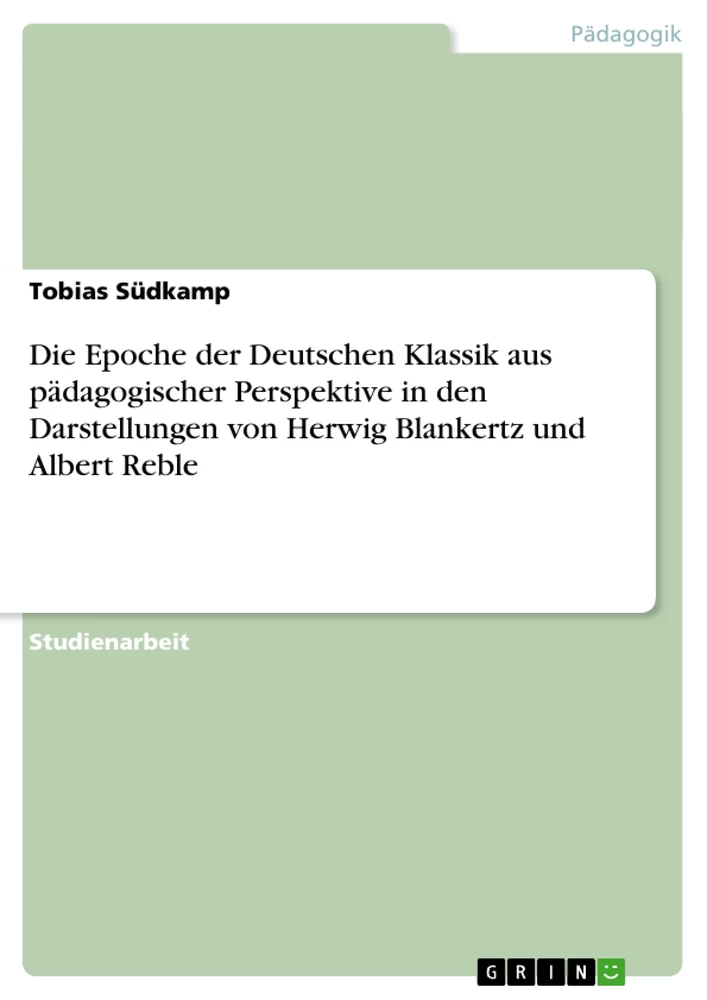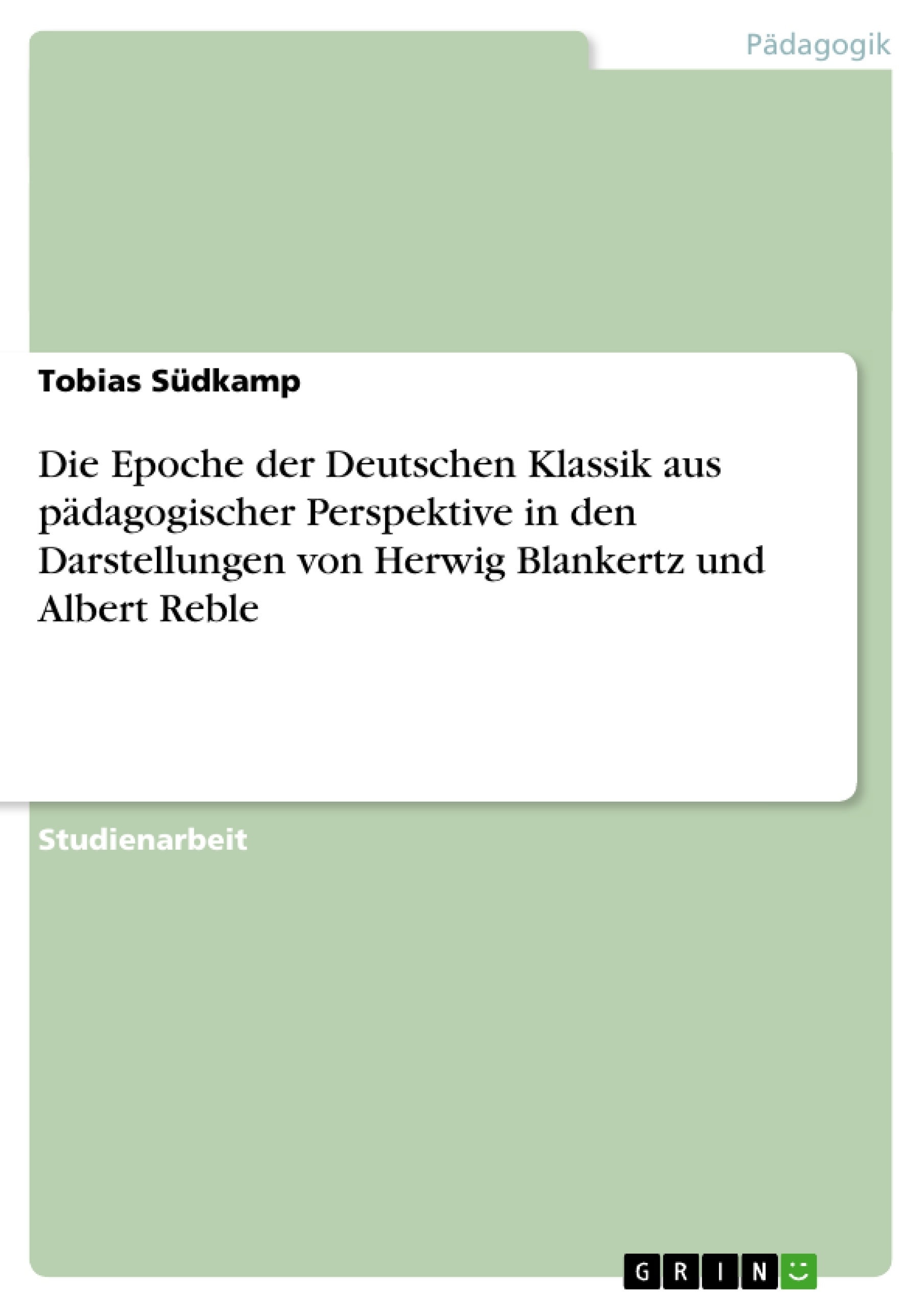[...] So ist denn auch der Aufbau seines Werkes so zu verstehen, dass keine Reduktion auf das für die Schulpraxis relevante Wissen erfolgt. Dadurch grenzt er sich wesentlich von den meisten Geschichtsdarstellungen ab. Reble will anhand seiner Geschichte der Pädagogik keine Formeln und Skizzen zur Abstraktion pädagogischer Erziehungssysteme vorangegangener Zeiten entwerfen, sondern sein Hauptaugenmerk auf die Verkettung der Epochen richten, sowie ihr Zusammenwirken als Konsequenz für die heutige Zeit verdeutlichen. Reble entwirft demnach mit seinem Werk eine mit der Epoche der Antike beginnende Zusammenschau der Geschichte der Pädagogik und ihrer zeittypischen Besonderheiten, die ohne scharfe zeitliche Trennlinien auskommt. Blankertz hingegen verfolgt mit seiner erstmals 1982 erschienen Geschichte der Pädagogik2 ein anderes Konzept. Sein Werk ist auf dem Boden einer Studienbriefreihe für die Fernuniversität Hagen erwachsen. Dieser Studienbriefreihe hatte Blankertz zum Ziel gesetzt, eine Übersicht zwischen der Geschichte pädagogischer Theorien, der Schule, der Bildung und des sozialen Systems der Erziehung zu sein. Diese Maxime legt Blankertz auch der später erscheinenden Überarbeitung und Ergänzung der Studienbriefreihe zur Publikation in Buchform an. Die Triebfeder dieser Arbeit besteht darin, dass die Epoche der deutschen Klassik unter Betonung ihrer pädagogischen Gesichtspunkte durch den Leser resp. die Leserin in eine kulturell-pädagogische Gesamtschau eingegliedert werden kann. Zudem soll der Blick auf die Epoche der deutschen Klassik durch die Brille zweier unterschiedlicher Geschichtsdarstellungen das Herauswachsen verschiedenster pädagogischer Bereiche aus der Vergangenheit verdeutlichen. 2 Blankertz, H. –Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart - Büchse der
Pandora, Wetzlar 1982.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Hauptteil
- Einteilung und Darstellung der Epoche der deutschen Klassik nach Reble
- Hauptpersonen der klassisch-idealistischen Epoche in Rebles Darstellung (HUMANISTEN & IDEALISTEN)
- Die Deutsche Klassik in der Darstellung von Herwig Blankertz
- Zusammenfassung - Schluss
- Literaturverzeichnis
- Primärtexte
- Weitere, zur Hilfe herangezogene Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Epoche der deutschen Klassik aus pädagogischer Perspektive, indem sie die Darstellungen von Albert Reble und Herwig Blankertz vergleicht. Ziel ist es, die Epoche in eine umfassendere kulturell-pädagogische Sichtweise einzubinden und die unterschiedlichen Perspektiven beider Autoren herauszuarbeiten.
- Pädagogische Aspekte der deutschen Klassik
- Vergleich der Darstellungen von Reble und Blankertz
- Einfluss der Aufklärung auf die deutsche Klassik
- Die Rolle von Dichtung und Philosophie in der deutschen Klassik
- Entwicklung des pädagogischen Denkens in der Klassik
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit analysiert die Epoche der deutschen Klassik aus pädagogischer Sicht, indem sie die Werke von Albert Reble und Herwig Blankertz vergleicht. Rebles Werk dient als Ausgangspunkt, während Blankertz' Ansatz einen anderen Fokus auf die Verknüpfung von pädagogischen Theorien, Schule, Bildung und sozialem System setzt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Klassik in eine umfassende kulturell-pädagogische Perspektive zu integrieren und die Unterschiede in der Darstellung beider Autoren aufzuzeigen.
Einteilung und Darstellung der Epoche der deutschen Klassik nach Reble: Rebles Kapitel zur klassisch-idealistischen Epoche zeichnet ein Bild, das den "Sinn für das Irrationale" als Grundtendenz dieser Epoche beschreibt. Er identifiziert zwei Strömungen um 1770-1800: die Weiterführung aufklärerischer Ideale und eine Gegenbewegung, die sich in der deutschen Klassik manifestiert. Die Klassik verdrängt die rationalistische Betonung der Aufklärung und betont stattdessen ein Lebensgefühl von Freiheit und Irrationalität, besonders sichtbar in der deutschen Dichtung und Philosophie, die zu dieser Zeit einen "unerhörten Reichtum" aufwiesen. Reble betont den Zusammenhang von Gesamtleben, Erziehungswirklichkeit und pädagogischem Denken und vermeidet eine Reduktion auf schulpraktisches Wissen.
Schlüsselwörter
Deutsche Klassik, Pädagogik, Albert Reble, Herwig Blankertz, Aufklärung, Irrationalität, Dichtung, Philosophie, kulturell-pädagogische Gesamtschau, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Deutschen Klassik nach Reble und Blankertz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Epoche der deutschen Klassik aus einer pädagogischen Perspektive. Sie vergleicht die Darstellungen dieser Epoche durch Albert Reble und Herwig Blankertz, um ein umfassenderes kulturell-pädagogisches Verständnis zu entwickeln und die unterschiedlichen Perspektiven beider Autoren herauszuarbeiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht pädagogische Aspekte der deutschen Klassik, vergleicht die Darstellungen von Reble und Blankertz, beleuchtet den Einfluss der Aufklärung, analysiert die Rolle von Dichtung und Philosophie und erforscht die Entwicklung des pädagogischen Denkens in der Klassik. Ein besonderer Fokus liegt auf der Gegenüberstellung rationalistischer und irrationaler Strömungen innerhalb der Epoche.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, einen Hauptteil mit Analysen der Darstellungen von Reble und Blankertz (inkl. einer detaillierten Betrachtung von Rebles Einteilung der Epoche), eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis. Der Hauptteil beinhaltet eine detaillierte Auseinandersetzung mit Rebles Beschreibung der Klassisch-idealistischen Epoche und ihren Hauptpersonen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel ist es, die deutsche Klassik in einen umfassenderen kulturell-pädagogischen Kontext einzubetten und die unterschiedlichen Perspektiven von Reble und Blankertz aufzuzeigen. Rebles Werk dient als Ausgangspunkt, wobei Blankertz' Ansatz einen anderen Fokus auf die Verknüpfung von pädagogischen Theorien, Schule, Bildung und sozialem System legt.
Wie beschreibt Reble die Epoche der deutschen Klassik?
Reble beschreibt die klassisch-idealistische Epoche als gekennzeichnet durch einen "Sinn für das Irrationale". Er identifiziert zwei Strömungen: die Fortführung aufklärerischer Ideale und eine Gegenbewegung, die sich in der deutschen Klassik manifestiert. Diese Gegenbewegung betont ein Lebensgefühl von Freiheit und Irrationalität, besonders in der Dichtung und Philosophie. Reble betont den Zusammenhang von Gesamtleben, Erziehungswirklichkeit und pädagogischem Denken.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Klassik, Pädagogik, Albert Reble, Herwig Blankertz, Aufklärung, Irrationalität, Dichtung, Philosophie, kulturell-pädagogische Gesamtschau, Vergleichende Analyse.
- Quote paper
- Tobias Südkamp (Author), 2002, Die Epoche der Deutschen Klassik aus pädagogischer Perspektive in den Darstellungen von Herwig Blankertz und Albert Reble, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24788