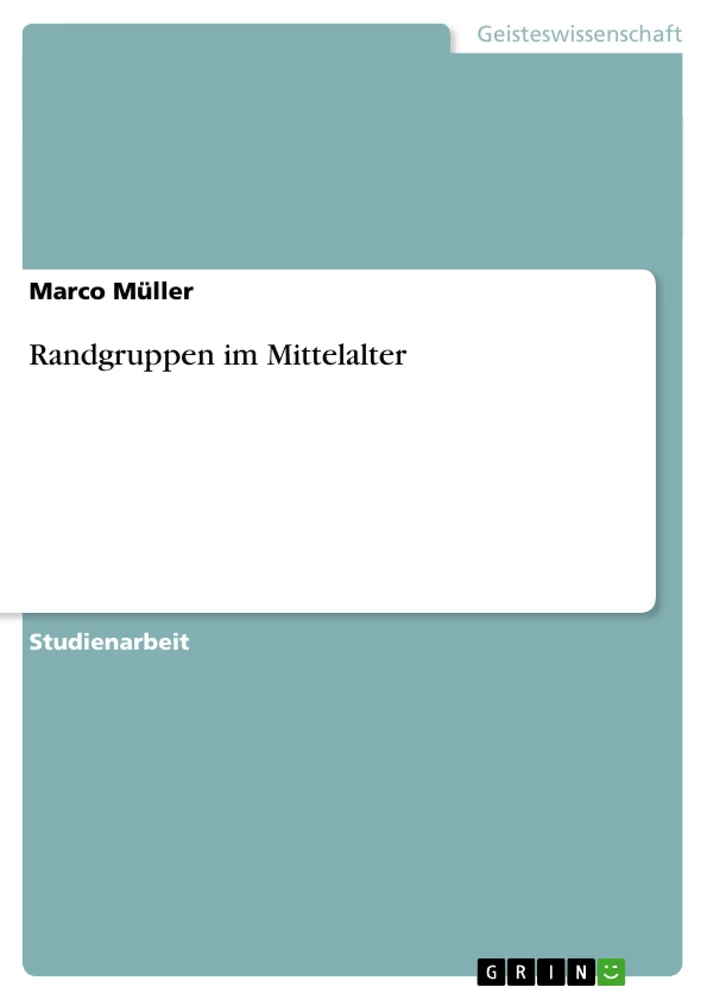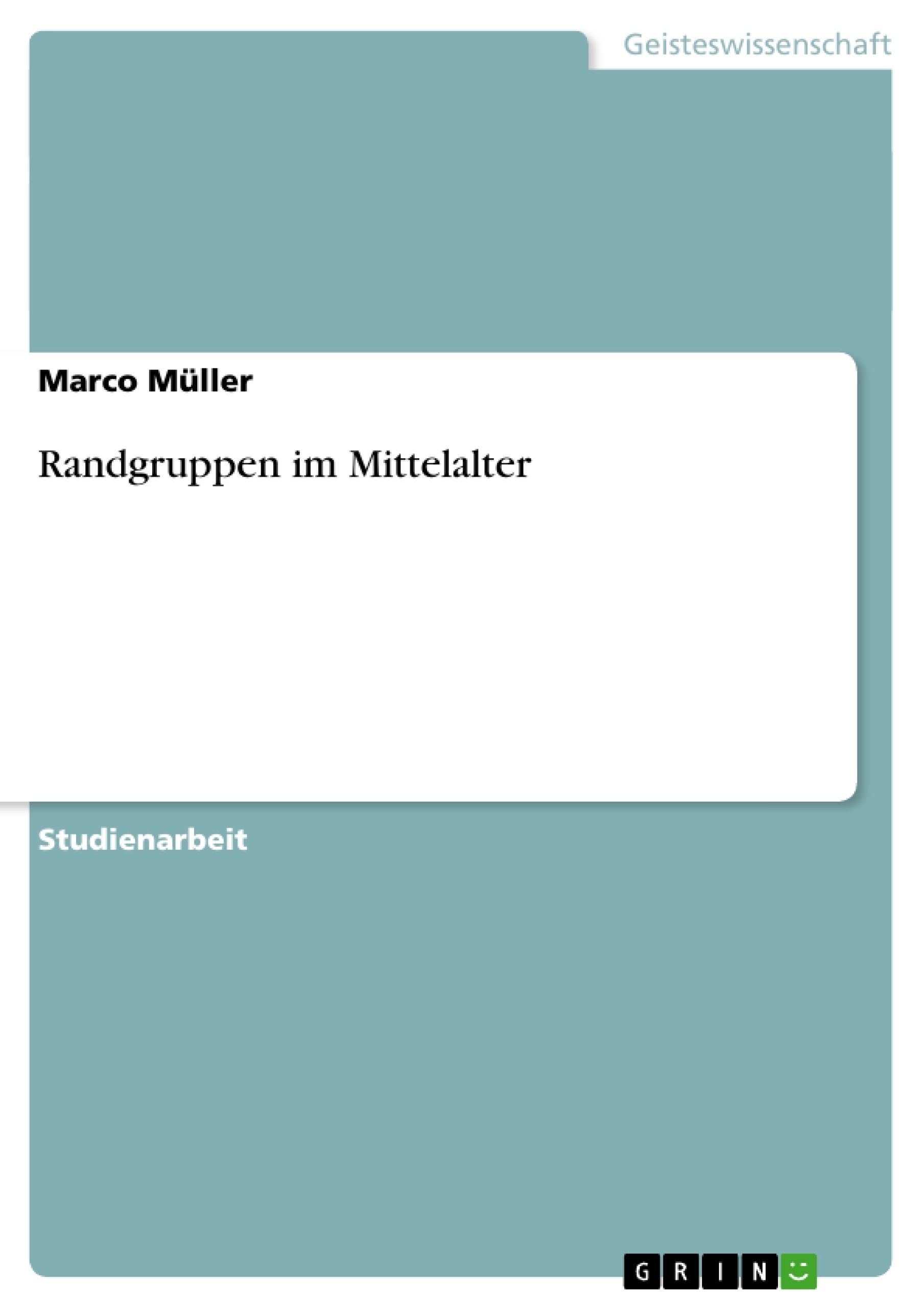Die vorliegende Arbeit untersucht die verschiedenen Randgruppen mittelalterlicher
Gesellschaften unter soziologischen Gesichtspunkten. Der dieser Arbeit zugrunde
liegende Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom Beginn des 11. Jahrhunderts bis etwa
zum Ende des 16. Jahrhunderts, also auf das Spätmittelalter.
Im Zentrum der Betrachtung stehen städtische mittelalterliche Gesellschaften, die das
deutsche Reichsgebiet umfassten, wenngleich an einigen Stellen auch ein Vergleich zu
anderen Ländern Europas angestrebt wird.
Aufgrund der zahlreichen und teils sehr unterschiedlichen Auffassungen, die zum Thema
Randgruppen schriftlich überliefert sind, ist eine exakte Definition und Differenzierung
sicherlich nicht immer leicht zu treffen, wenn nicht an manchen Stellen sogar unmöglich.
Daher soll im ersten Teil der Arbeit herausgestellt werden, inwiefern sich der Begriff
‚Randgruppe’ überhaupt definieren und differenzieren lässt. In weiteren Verlauf soll
erörtert werden, welche Personengruppen anhand welcher Kriterien als Außenseiter
bezeichnet werden können. Dabei spielen vor allem die Art und Weise einerseits sowie
Gründe und Ursachen der Marginalisierung andererseits eine wichtige Rolle.
Im Anschluss an die Einzelbetrachtungen der verschiedenen Randgruppen soll
zusammenfassend herausgestellt werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im
Bezug auf das soziale Leben und die gesellschaftliche Stellung der Randgruppen
bestanden. Des weiteren soll aufgezeigt werden, welche Gründe für die Stigmatisierung,
also das buchstäbliche Sichtbarmachen sowie für die Marginalisierung der Betreffenden
Personenkreise verantwortlich waren.
Es wird der Versuch unternommen anhand verschiedener Indikatoren wie allgemeine
Akzeptanz, Kleidung, Religionszugehörigkeit, Aussehen, Gruppenstruktur,
Gruppenghettoisierung, obrigkeitliche Stigmatisierung und weiteren Indikatoren
gesellschaftlicher Integration he rauszustellen, wo die Ursachen der Stigmatisierung und
Marginalisierung der zu betrachtenden Personenkreise zu finden sind.
Im Laufe der Vorstellung jener Gruppen soll sich vor allem herausstellen, worauf sich die
Ablehnung der damaligen Gesellschaft den Außenseitern gegenüber begründet und
welche Parallelen, aber welche auch Unterschiede sich zwischen den einzelnen Gruppen
in Bezug auf die spätmittelalterliche Gesellschaft ziehen lassen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Der Versuch einer Definition des Randgruppenbegriffs
- II. Die verschiedenen Randgruppen im Mittelalter
- 1. Unehrliche Berufe
- 1.1. Bettler
- 1.2. Henker
- 1.3. Prostituierte
- 1.4. Gaukler und Spielleute
- 2. Körperlich und geistig Signifikante
- 2.1. Lepra als gesellschaftliches Todesurteil
- 2.2. Geistig und körperlich Behinderte
- 3. Ethnisch-religiös Verschiedene
- 3.1. Juden
- 3.2. Zigeuner
- 4. Hexen und Sodomiter
- 4.1. Hexen
- 4.2. Sodomiter
- III. Das Phänomen der Stigmatisierung und Marginalisierung
- 1. Vorurteile und Zuschreibungsprozesse
- 2. Der Prozess der Marginalisierung
- 3. Die sozialregulative Notwendigkeit (der Konstruktion) von Randgruppen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht städtische Randgruppen des Spätmittelalters (11. bis 16. Jahrhundert) unter soziologischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, die Definition und Differenzierung des Begriffs "Randgruppe" zu klären und verschiedene Gruppen anhand ihrer Marginalisierung zu analysieren. Dabei werden die Gründe und Ursachen der gesellschaftlichen Ausgrenzung betrachtet.
- Definition und Differenzierung des Begriffs "Randgruppe" im Mittelalter
- Identifizierung verschiedener städtischer Randgruppen im Spätmittelalter
- Analyse der Prozesse der Stigmatisierung und Marginalisierung
- Untersuchung der Ursachen für die gesellschaftliche Ausgrenzung
- Vergleich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Randgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf städtische Randgruppen des Spätmittelalters im deutschen Reichsgebiet, unter Einbezug europäischer Vergleiche. Sie hebt die Schwierigkeit einer exakten Definition von "Randgruppe" hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit: Definition des Begriffs, Analyse verschiedener Randgruppen, Untersuchung der Stigmatisierung und Marginalisierung und schließlich die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Gruppen. Die Arbeit konzentriert sich auf die zahlenmäßig größten Randgruppen und betont den synchronen Ansatz der Betrachtung, mit nur seltenen Rückblicken in die Vergangenheit. Der subjektive Charakter der Randgruppenkategorisierung wird bereits hier angesprochen.
I. Der Versuch einer Definition des Randgruppenbegriffs: Dieses Kapitel differenziert zwischen Unterschichten und Randgruppen, wobei letztere als soziale, nicht ökonomische Kategorie definiert werden, die durch Entehrung und Abweichung von sozialen Normen gekennzeichnet ist. Es wird diskutiert, dass Randgruppen nicht existieren, sondern konstruiert werden, wobei die Konstruktion nicht primär auf Kriminalität oder Defiziten der Betroffenen beruht, sondern auf dem Zuschreibungswillen der Entscheidungsträger. Die Subjektivität und Willkürlichkeit dieser Konstruktion wird betont, was die Schwierigkeiten einer allgemeingültigen Definition verdeutlicht. Die Bedeutung von "abweichenden Körpermerkmalen" und "abweichendem Verhalten" für den Zuschreibungsprozess wird hervorgehoben.
II. Die verschiedenen Randgruppen im Mittelalter: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Übersicht über verschiedene Randgruppen, die durch unehrliche Berufe, körperliche/geistige Defizite oder ethnisch-religiöse Unterschiede definiert werden. Es analysiert die jeweilige Situation von Bettlern, Henkern, Prostituierten, Gauklern, Leprakranken, Behinderten, Juden, Zigeunern, Hexen und Sodomiten, umfassend ihre gesellschaftliche Stellung und die Gründe für ihre Ausgrenzung im Spätmittelalter. Die Zusammenfassung dieses Kapitels würde eine detaillierte Beschreibung der spezifischen Herausforderungen und Erfahrungen jeder dieser Gruppen umfassen, dabei aber die individuellen Abschnitte zu einer kohärenten Darstellung des breiten Spektrums mittelalterlicher Randgruppen vereinen.
III. Das Phänomen der Stigmatisierung und Marginalisierung: Dieses Kapitel fokussiert die Prozesse der Stigmatisierung und Marginalisierung von Randgruppen. Es untersucht Vorurteile und Zuschreibungsprozesse, den Prozess der Marginalisierung selbst, und die sozialregulative Funktion der Konstruktion von Randgruppen. Die Analyse beinhaltet die Untersuchung von Indikatoren wie Akzeptanz, Kleidung, Religion, Aussehen, Gruppenstruktur, Ghettoisierung und obrigkeitlicher Stigmatisierung, um die Ursachen der Ausgrenzung zu beleuchten. Die Bedeutung der sozialen Konstruktion von Randgruppen und deren Funktion für die Aufrechterhaltung sozialer Ordnung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Randgruppen, Spätmittelalter, Städtische Gesellschaft, Stigmatisierung, Marginalisierung, Soziale Ausgrenzung, Unehrliche Berufe, Körperliche und Geistige Behinderung, Ethnische und Religiöse Minderheiten, Juden, Zigeuner, Hexen, Sodomiter, soziale Normen, Zuschreibungsprozesse, gesellschaftliche Konstruktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Städtische Randgruppen im Spätmittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht städtische Randgruppen des Spätmittelalters (11. bis 16. Jahrhundert) in Deutschland, unter Einbezug europäischer Vergleiche, aus soziologischer Perspektive. Der Fokus liegt auf der Definition und Differenzierung des Begriffs "Randgruppe", der Analyse verschiedener Gruppen anhand ihrer Marginalisierung und der Untersuchung der Gründe und Ursachen der gesellschaftlichen Ausgrenzung.
Welche Randgruppen werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Gruppen, die durch unehrliche Berufe (Bettler, Henker, Prostituierte, Gaukler), körperliche und geistige Defizite (Leprakranke, Behinderte), oder ethnisch-religiöse Unterschiede (Juden, Zigeuner) sowie durch die Zuschreibung als Hexen oder Sodomiter definiert wurden. Die Arbeit konzentriert sich auf die zahlenmäßig größten Randgruppen.
Wie wird der Begriff "Randgruppe" definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen Unterschichten und Randgruppen. Randgruppen werden als soziale, nicht ökonomische Kategorie definiert, die durch Entehrung und Abweichung von sozialen Normen gekennzeichnet ist. Es wird betont, dass Randgruppen nicht objektiv existieren, sondern sozial konstruiert werden, wobei die Konstruktion nicht primär auf Kriminalität oder Defiziten der Betroffenen beruht, sondern auf dem Zuschreibungswillen der Entscheidungsträger.
Welche Prozesse der Ausgrenzung werden analysiert?
Die Arbeit untersucht die Prozesse der Stigmatisierung und Marginalisierung. Dazu gehören die Analyse von Vorurteilen und Zuschreibungsprozessen, der Prozess der Marginalisierung selbst und die sozialregulative Funktion der Konstruktion von Randgruppen. Untersucht werden Indikatoren wie Akzeptanz, Kleidung, Religion, Aussehen, Gruppenstruktur, Ghettoisierung und obrigkeitlicher Stigmatisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Schlusswort. Kapitel I befasst sich mit der Definition von Randgruppen. Kapitel II präsentiert eine Übersicht verschiedener Randgruppen im Mittelalter. Kapitel III analysiert die Prozesse der Stigmatisierung und Marginalisierung. Die Einleitung und das Schlusswort rahmen die Analyse ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Randgruppen, Spätmittelalter, Städtische Gesellschaft, Stigmatisierung, Marginalisierung, Soziale Ausgrenzung, Unehrliche Berufe, Körperliche und Geistige Behinderung, Ethnische und Religiöse Minderheiten, Juden, Zigeuner, Hexen, Sodomiter, soziale Normen, Zuschreibungsprozesse, gesellschaftliche Konstruktion.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Definition und Differenzierung des Begriffs "Randgruppe" zu klären und verschiedene Gruppen anhand ihrer Marginalisierung zu analysieren. Dabei werden die Gründe und Ursachen der gesellschaftlichen Ausgrenzung betrachtet und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Randgruppen verglichen.
- Quote paper
- Marco Müller (Author), 2003, Randgruppen im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24763