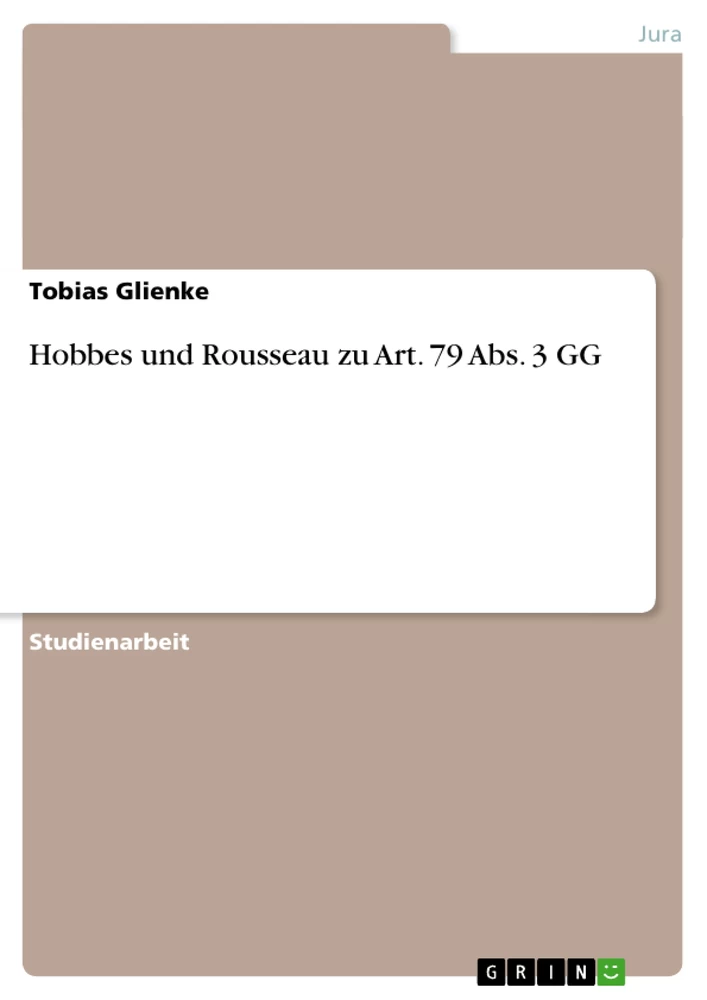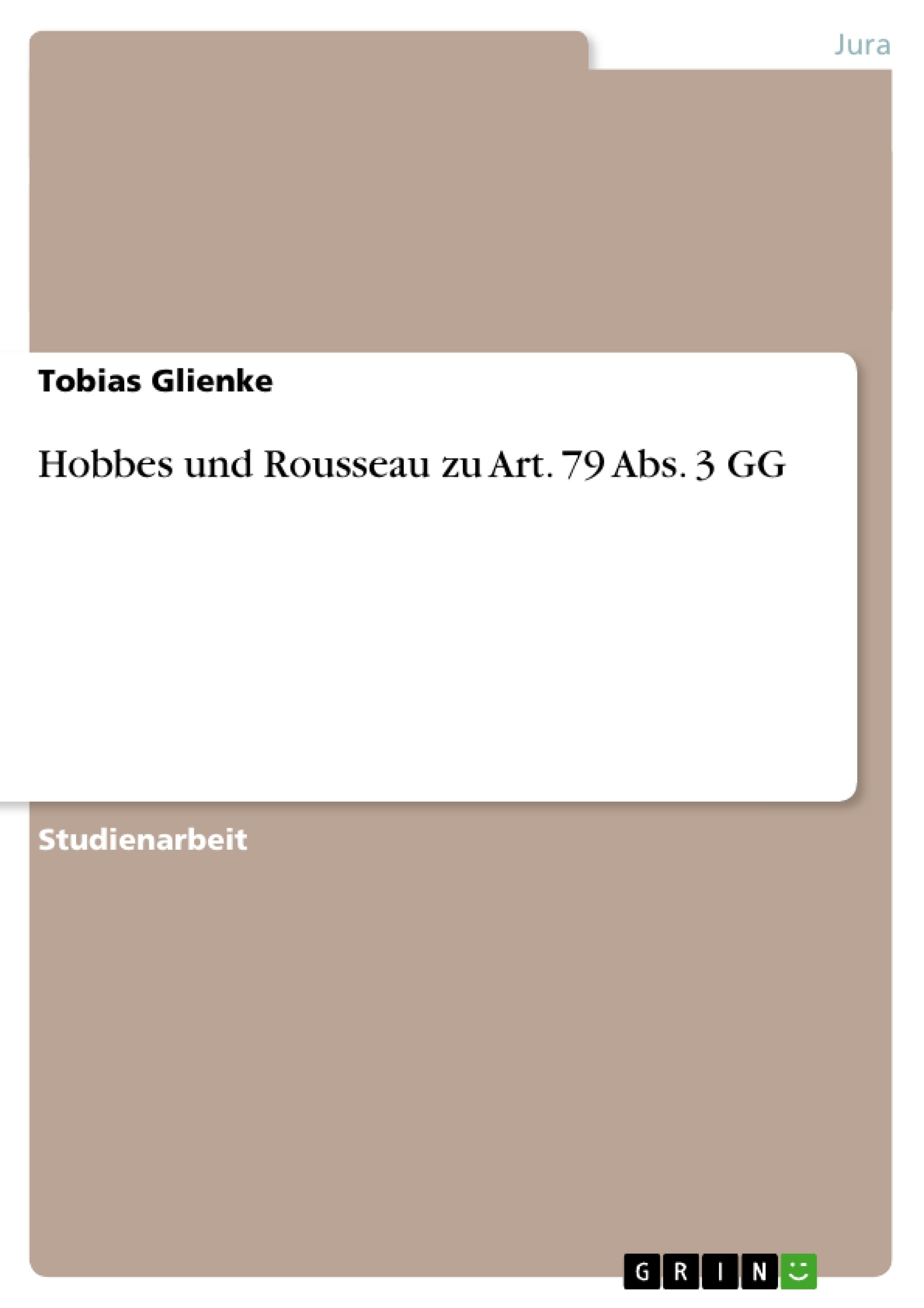Thomas Hobbes kam 1588 in der Grafschaft Wiltshire, England zur Welt, mit
14 studierte er an der Universität Oxford, nach seinem Abschluss wurde er Tutor
einer adligen Familie und schließlich Sekretär von Francis Bacon. Hobbes ging
es vor allem um die Ausbildung eines philosophischen Systems, das frei von
metaphysischen Annahmen ist, er lehnt Spekulationen ab und definiert die Philosophie,
also auch den hier betrachteten Teil, die Staatsphilosophie, als Erkenntnis
der Wirkungen aus Ursachen. Er war befreundet mit Galileo Galilei
und sah ihn als Vorbild, so war er der erste Philosoph, der die neue mechanistische
Erklärungsweise auf alle Gebiete der Philosophie anwandte.1 Um den drohenden
Bürgerkrieg in seiner Heimat zu verhindern und die Position des Königs
zu stärken verfasste er 1640 Abhandlungen über Politik und Staat, weswegen er
alsbald vor dem aufgebrachten Unterhaus nach Frankreich fliehen musste. In
seinem bedeutendsten Werk, dem „Leviathan“, beschreibt er 1651 – in diesem
Jahr kehrte er nach England zurück - wie er sich den Aufbau eines absolutistischen
Staates vorstellt, immer von einem drohenden Bürgerkrieg ausgehend.
Sein weiteres Leben verbrachte er größtenteils auf einem englischen Landgut,
wo er 1679 starb. J.-J. Rousseau wurde 1712 in Genf geboren, entlief mit 16 der Lehre und kam
bei einer wesentlich älteren Frau unter, die für ihn Geliebte und Mutter in einer
Person wurde. Nach seinem ersten literarischen Erfolg, der „Abhandlung über
die Wissenschaften und Künste“ von 1750, lebte er, immer von reichen, adligen
Freunden unterstützt, in Paris und anderen Orten Frankreichs, erwarb das Bürgerrecht
in Genf, lebte in England bei David Hume, dann wieder in Frankreich,
wo er 1778 starb. Seine Bedrohung durch Verfolger übersteigerte sich im Laufe
seines Lebens zu einem Verfolgungswahn, er war unglücklich und psychopatisch.
2 Jedes seiner Kinder brachte er unmittelbar nach der Geburt in ein Waisenhaus,
in sozialer Hinsicht war er unmöglich. Das staatsphilosophische
Hauptwerk Rousseaus, der „contrat social“, erschien 1762 und enthält alle Thesen
und Entwürfe seiner, auf Freiheit als wichtigstem Prinzip basierender
Staatskonzeption.3
1 Störig, Weltgeschichte, S. 394; Kersting, Hobbes S. 38 ff.; Münkler, Hobbes S. 11 f.
2 Störig, Weltgeschichte, S. 425 f.
3 Lieber, Theorien, S. 219 ff.
Inhaltsverzeichnis
- I. Zur Person
- 1. Thomas Hobbes
- 2. Jean-Jacques Rousseau
- II. Politische Theorien der beiden Philosophen
- 1. Naturzustand und Naturrecht
- a) Thomas Hobbes
- b) Jean-Jacques Rousseau
- 2. Gesellschaftsvertrag und Legitimation staatlicher Herrschaft
- a) Thomas Hobbes
- b) Jean-Jacques Rousseau
- 1. Naturzustand und Naturrecht
- III. „Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 Abs. 3 GG
- IV. Meinung von Hobbes und Rousseau zu einer Ewigkeitsklausel
- 1. Thomas Hobbes
- 2. Jean-Jacques Rousseau
- V. Was müsste ewig gestellt werden?
- 1. Thomas Hobbes
- 2. Jean-Jacques Rousseau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Positionen von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau bezüglich der „Ewigkeitsklausel“ in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes. Die Arbeit analysiert, wie sich die beiden Denker zu der Begründung und Zulässigkeit solcher unveränderlichen Grundsatze geäußert hätten, ausgehend von ihren Theorien zum Naturzustand, Gesellschaftsvertrag und staatlicher Herrschaft.
- Der Naturzustand bei Hobbes und Rousseau
- Der Gesellschaftsvertrag als Grundlage staatlicher Legitimität
- Die Konzeption von Grundrechten bei beiden Denkern
- Die Frage nach unveränderlichen Grenzen staatlicher Herrschaft
- Die Anwendbarkeit der Theorien auf die Ewigkeitsklausel des GG
Zusammenfassung der Kapitel
I. Zur Person: Dieses Kapitel bietet kurze biografische Skizzen von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Es skizziert die Lebensumstände beider Denker, ihre wichtigsten Werke und den Kontext, in dem ihre politischen Philosophien entstanden sind. Die Beschreibung von Hobbes betont seinen mechanistischen Ansatz und seine Reaktion auf den englischen Bürgerkrieg, während die Darstellung Rousseaus auf dessen Fokus auf Freiheit und seine soziale Unangepasstheit eingeht. Der Abschnitt dient als Einführung in die Persönlichkeiten und den Kontext, in dem die politischen Theorien der beiden Autoren entstanden sind und verstanden werden müssen.
II. Politische Theorien der beiden Philosophen: Dieses Kapitel analysiert die politischen Theorien von Hobbes und Rousseau, konzentrierend sich auf den Naturzustand und den Gesellschaftsvertrag. Es vergleicht und kontrastiert die unterschiedlichen Vorstellungen beider Denker vom Menschen im Naturzustand und wie sie den Übergang in den Gesellschaftszustand und die Begründung staatlicher Legitimität konzipieren. Die Kapitelteile zu Hobbes und Rousseau beleuchten die jeweilige Argumentation im Detail und stellen die zentralen Unterschiede in ihren Ansätzen heraus.
III. „Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 Abs. 3 GG: Dieses Kapitel (wahrscheinlich kurz) beschreibt die „Ewigkeitsklausel“ in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Wie würden Hobbes und Rousseau diese Klausel bewerten?
IV. Meinung von Hobbes und Rousseau zu einer Ewigkeitsklausel: Dieses Kapitel analysiert, wie Hobbes und Rousseau sich vermutlich zu einer Ewigkeitsklausel geäußert hätten. Es wird ihre jeweiligen politischen Philosophien auf die Frage anwenden, welche Prinzipien für sie unveränderlich wären und welche nicht. Die Argumentation wird sich auf die vorherigen Kapitel stützen und die unterschiedlichen Schlussfolgerungen der beiden Denker herausarbeiten.
V. Was müsste ewig gestellt werden?: Dieses Kapitel wird die Schlussfolgerungen der Arbeit zusammenfassen und diskutieren, welche Prinzipien nach Hobbes und Rousseau als unveränderlich betrachtet werden müssten und warum. Die Argumentation wird die vorherigen Kapitel zusammenführen und die Implikationen für das Verständnis von Grundrechten und staatlicher Legitimität hervorheben.
Schlüsselwörter
Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Staatsphilosophie, Ewigkeitsklausel, Artikel 79 Abs. 3 GG, Grundrechte, Legitimität, absolutistischer Staat, Freiheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Positionen von Hobbes und Rousseau zur Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Positionen von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau bezüglich der „Ewigkeitsklausel“ in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes (GG). Sie untersucht, wie beide Denker diese Klausel bewerten würden, basierend auf ihren Theorien zum Naturzustand, Gesellschaftsvertrag und staatlicher Herrschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunkte: Biografische Skizzen von Hobbes und Rousseau; Vergleich ihrer Theorien zum Naturzustand und Naturrecht; Analyse ihrer Konzepte des Gesellschaftsvertrags und der Legitimation staatlicher Herrschaft; Beschreibung der Ewigkeitsklausel in Art. 79 Abs. 3 GG; Anwendung der politischen Philosophien von Hobbes und Rousseau auf die Ewigkeitsklausel; Diskussion darüber, welche Prinzipien nach Hobbes und Rousseau als unveränderlich betrachtet werden müssten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I bietet biografische Informationen zu Hobbes und Rousseau. Kapitel II vergleicht und kontrastiert die politischen Theorien beider Denker, insbesondere ihre Ansichten zum Naturzustand und Gesellschaftsvertrag. Kapitel III beschreibt die Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG. Kapitel IV analysiert die hypothetische Position von Hobbes und Rousseau zur Ewigkeitsklausel. Kapitel V fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert, welche Prinzipien nach Hobbes und Rousseau als unveränderlich gelten sollten.
Welche Schlüsselkonzepte werden untersucht?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Naturzustand, Naturrecht, Gesellschaftsvertrag, Staatsphilosophie, Ewigkeitsklausel, Artikel 79 Abs. 3 GG, Grundrechte, Legitimität, absolutistischer Staat, Freiheit.
Wie werden die Theorien von Hobbes und Rousseau verglichen?
Die Arbeit vergleicht und kontrastiert die Ansichten von Hobbes und Rousseau zum Naturzustand, Gesellschaftsvertrag und der Legitimation staatlicher Herrschaft, um ihre unterschiedlichen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Ewigkeitsklausel aufzuzeigen. Die Unterschiede in ihren Ansätzen und Argumentationen werden detailliert beleuchtet.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie würden Hobbes und Rousseau die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes bewerten?
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Frage, welche Prinzipien nach Hobbes und Rousseau als unveränderlich betrachtet werden müssten und welche Implikationen dies für das Verständnis von Grundrechten und staatlicher Legitimität hat. Diese Schlussfolgerungen werden auf der Grundlage der Analyse der politischen Philosophien beider Denker gezogen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich für politische Philosophie, die Werke von Hobbes und Rousseau, und die Interpretation des Grundgesetzes interessieren. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke konzipiert.
- Quote paper
- Tobias Glienke (Author), 2003, Hobbes und Rousseau zu Art. 79 Abs. 3 GG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24742