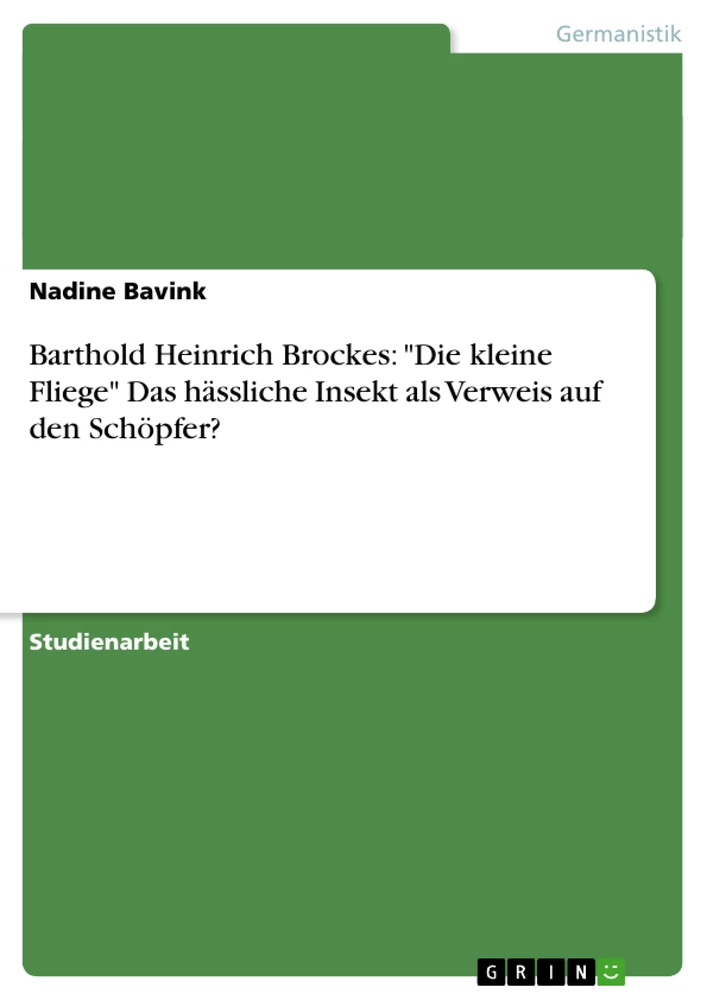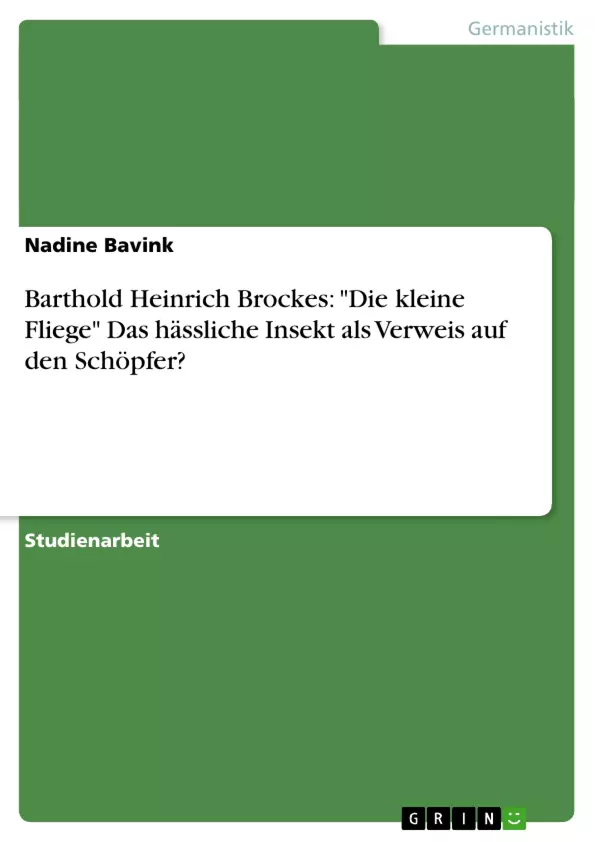Naturlyrik im 18. Jahrhundert
„Nahm in der Literatur des 17. Jahrhunderts die Natur schon eine wichtige Stelle als Inhaltselement ein, so wächst ihr Anteil im 18. Jahrhundert ganz beträchtlich. Alles für das Gefühlsleben Bedeutsame wird nun in landschaftliche Umgebung eingebettet.“1 Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) läutete das 18. Jahrhundert ein mit seiner neunbändigen Gedichtsammlung „Irdisches Vergnügen in Gott“ (1721-1748). Das neue an der Dichtung Brockes war, dass er, im Gegensatz zur älteren Gartendichtung, die sich kaum ohne christliche und antike Topoi mitteilen konnte, Naturdinge und Naturphänomene mit ihren genauen Namen benannte und diese sinnlich wahrnahm. 2 Der Wandel der Naturlyrik vom 17. zum 18. Jahrhundert soll neben der Erarbeitung des Gedichtes „Die kleine Fliege“ Gegenstand der Betrachtung dieser Arbeit sein. Hierbei soll das Gedicht „Abend“ von Andreas Gryphius als Exemplum für die Barocklyrik dienen. Der Umbruch der Naturlyrik vollzog sich nicht einfach durch einen neuen Glauben, „sondern der alte sah sich vom Gang der Zeit genötigt, die Natur als immer gewaltiger sich aufdrängende Wirklichkeit weit genauer wahrzunehmen und in seine Weltdeutung einzubeziehen, als das bisher geschehen war.“3 Die Dichtung der früheren Aufklärung, die hier durch das zu erarbeitende Gedicht „Die kleine Fliege“4 exemplarisch dargestellt wird, repräsentiert „eine sinnlich erfahrbare Naturentdeckung und -beschreibung, die als Ausdruck des Selbstgefühls dem aufklärerischen Prinzip der Selbstbestimmung und des Vernunftgebrauches entspricht.“5 Welche Naturentdeckung in dem Gedicht „Die kleine Fliege“ gemacht wird und ob diese sinnlich erfahren wird, soll nun erarbeitet werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Naturlyrik im 18. Jahrhundert
- „Die kleine Fliege“
- Das Vergnügen
- Vorgehensweise der Interpretation
- Lehrgedicht oder deskriptives Gedicht?
- Konstituierung des Subjektes zum Objekt
- Das hässliche Insekt?
- Die Verfahrensweise
- Form und Farbe des Objektes
- Farbe versus Glanz
- Beschreibung des Objektes
- Edelsteinmetaphorik
- Schöpfung als Spiegel Gottes
- Gotteslob
- Reflexion
- Rationaler Diskurs
- Die Sonne und ihr Licht
- Das Wunder
- Konklusion
- Aufbau des Gedichtes
- Die Komplexität des Gedichtes
- Reimschema
- „Die kleine Fliege“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Barthold Heinrich Brockes' Gedicht „Die kleine Fliege“ im Kontext der Naturlyrik des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert den Wandel der Naturlyrik vom Barock zur Aufklärung und belegt, wie Brockes' Werk diesen Wandel repräsentiert. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Interpretation des Gedichts und der Untersuchung seiner poetischen Mittel im Hinblick auf die Darstellung der Natur und die Verknüpfung von irdischer Beobachtung mit theologischer Interpretation.
- Wandel der Naturlyrik vom Barock zur Aufklärung
- Analyse der poetischen Mittel in Brockes' Gedicht „Die kleine Fliege“
- Verknüpfung von Naturbeschreibung und theologischer Deutung
- Das Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Gedichtinterpretation
- Die Rolle des "Vergnügens" in Brockes' Naturlyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Naturlyrik im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der Naturlyrik vom 17. zum 18. Jahrhundert. Es hebt den zunehmenden Stellenwert der Natur als Inhaltselement hervor und vergleicht die Naturlyrik Brockes' mit der älteren Gartendichtung. Der Fokus liegt auf der sinnlichen Wahrnehmung und der genauen Benennung von Naturdingen und -phänomenen bei Brockes im Gegensatz zur älteren Tradition. Andreas Gryphius' "Abend" dient als Beispiel für die Barocklyrik, um den Kontrast herauszuarbeiten. Die Arbeit argumentiert, dass der Wandel nicht nur auf einen neuen Glauben zurückzuführen ist, sondern auch auf eine veränderte, genauere Wahrnehmung der Natur und deren Einbeziehung in die Weltdeutung.
„Die kleine Fliege“: Dieses Kapitel führt in das Gedicht „Die kleine Fliege“ ein, das aus Brockes' umfangreicher Gedichtsammlung „Irdisches Vergnügen in Gott“ stammt. Es wird der Titel der Sammlung analysiert, der den Optimismus und die Verbindung von irdischem Vergnügen und göttlicher Ordnung aufzeigt. Der Gegensatz zur Barocklyrik, die sich mit der Vergänglichkeit des Menschen auseinandersetzte, wird hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des "Vergnügens" als zentralen Aspekt von Brockes' Naturlyrik und verbindet dies mit den Entwicklungen in der Naturwissenschaft der Zeit, insbesondere der Physikotheologie.
Vorgehensweise der Interpretation: Das Kapitel beschreibt die Herangehensweise an die Interpretation des Gedichts „Die kleine Fliege“. Es wird die Form des Gedichts, der lockere Stil und der Gegensatz zur barocken Lyrik erläutert. Die Frage nach der Einordnung des Gedichts als Lehrgedicht oder deskriptives Gedicht wird diskutiert, wobei die Autorin auf die mögliche Kombination beider Aspekte hinweist und die Suche nach allgemeinen Wahrheiten oder Lehrsätzen innerhalb des Textes ankündigt.
Konstituierung des Subjektes zum Objekt: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung des Insekts im Gedicht und der Frage, ob es als „hässlich“ zu betrachten ist. Die interpretatorische Methode wird erläutert. Es wird die Beziehung zwischen dem lyrischen Subjekt (dem Beobachter) und dem Objekt (der Fliege) untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Insekts und dessen Eigenschaften.
Form und Farbe des Objektes: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Beschreibung der Form und Farbe der Fliege, wobei der Kontrast zwischen Farbe und Glanz besondere Aufmerksamkeit erhält. Es werden die poetischen Mittel analysiert, die Brockes zur Beschreibung der Fliege verwendet.
Beschreibung des Objektes: Dieses Kapitel analysiert die Beschreibung der Fliege im Detail. Es werden die verwendeten Metaphern, insbesondere die Edelsteinmetaphorik, und die Interpretation der Schöpfung als Spiegel Gottes untersucht. Die Verbindung zwischen der irdischen Beobachtung und der theologischen Deutung wird hier im Mittelpunkt der Analyse stehen.
Gotteslob: Dieses Kapitel befasst sich mit der theologischen Dimension des Gedichts und untersucht, wie Brockes Gotteslob in die Naturbeschreibung integriert. Es wird die Funktion des Gotteslobs im Kontext des gesamten Gedichts erörtert.
Reflexion: Dieses Kapitel bietet eine Reflexion über die behandelten Themen und die Interpretation des Gedichts. Es fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und ordnet sie in den größeren Kontext der Aufklärung ein.
Rationaler Diskurs: Dieses Kapitel beleuchtet den rationalen Aspekt der Naturbeschreibung in Brockes' Gedicht und untersucht die Einbettung des Wunderbaren in den Rahmen einer naturwissenschaftlichen Betrachtung. Die Analyse konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Sonne, Licht und dem „Wunder“ der Fliege.
Schlüsselwörter
Barthold Heinrich Brockes, „Die kleine Fliege“, Naturlyrik, Aufklärung, Barocklyrik, Physikotheologie, Gottesbeweis, Sinnenwahrnehmung, Beschreibung, Metaphorik, Lehrgedicht, deskriptives Gedicht.
Häufig gestellte Fragen zu Barthold Heinrich Brockes' "Die kleine Fliege"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Barthold Heinrich Brockes' Gedicht "Die kleine Fliege" im Kontext der Naturlyrik des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht den Wandel der Naturlyrik vom Barock zur Aufklärung und zeigt, wie Brockes' Werk diesen Wandel repräsentiert. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Gedichts und der Analyse seiner poetischen Mittel in Bezug auf die Darstellung der Natur und die Verbindung von irdischer Beobachtung mit theologischer Interpretation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Wandel der Naturlyrik vom Barock zur Aufklärung, die Analyse der poetischen Mittel in Brockes' Gedicht, die Verknüpfung von Naturbeschreibung und theologischer Deutung, das Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Gedichtinterpretation und die Rolle des "Vergnügens" in Brockes' Naturlyrik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit verschiedenen Aspekten des Gedichts befassen: Naturlyrik im 18. Jahrhundert (einschließlich Vergleich mit Andreas Gryphius), Einleitung in "Die kleine Fliege" und Analyse des Titels der Gedichtsammlung "Irdisches Vergnügen in Gott", die Vorgehensweise der Interpretation, die Konstituierung des Subjekts zum Objekt, Form und Farbe der Fliege, detaillierte Beschreibung der Fliege (inkl. Metaphorik), Gotteslob, Reflexion, rationaler Diskurs (Sonne, Licht, Wunder) und der Aufbau des Gedichts (Komplexität, Reimschema).
Welche Interpretationsmethode wird angewendet?
Die Arbeit wendet eine detaillierte literaturwissenschaftliche Interpretationsmethode an, die formale Aspekte (Reimschema, Aufbau), sprachliche Mittel (Metaphorik), den Kontext (Naturlyrik des 18. Jahrhunderts, Aufklärung, Barocklyrik) und die theologische Dimension des Gedichts berücksichtigt. Die Beziehung zwischen dem lyrischen Subjekt (Beobachter) und dem Objekt (Fliege) wird ebenso untersucht wie die Frage nach der Einordnung des Gedichts als Lehrgedicht oder deskriptives Gedicht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Barthold Heinrich Brockes, "Die kleine Fliege", Naturlyrik, Aufklärung, Barocklyrik, Physikotheologie, Gottesbeweis, Sinnenwahrnehmung, Beschreibung, Metaphorik, Lehrgedicht, deskriptives Gedicht.
Wie wird der Wandel der Naturlyrik dargestellt?
Der Wandel der Naturlyrik wird durch den Vergleich von Brockes' Werk mit der älteren Gartendichtung und der Barocklyrik (z.B. Andreas Gryphius' "Abend") gezeigt. Es wird hervorgehoben, wie Brockes die Natur sinnlich wahrnimmt und detailliert beschreibt, im Gegensatz zur älteren Tradition. Der Fokus verschiebt sich von der Vergänglichkeit des Menschen (Barock) hin zu einer genaueren Wahrnehmung der Natur und deren Integration in die Weltdeutung.
Welche Rolle spielt die Theologie im Gedicht?
Die Theologie spielt eine zentrale Rolle. Das Gedicht verbindet irdische Beobachtung mit theologischer Interpretation. Das Gotteslob ist in die Naturbeschreibung integriert, und die Schöpfung wird als Spiegel Gottes gedeutet. Die Arbeit untersucht, wie Brockes Gottesbeweise in seine Naturbeschreibung einbindet.
Wie wird die Fliege im Gedicht dargestellt?
Die Fliege wird detailliert beschrieben, wobei ihre Form, Farbe und ihr Glanz im Mittelpunkt stehen. Es werden Metaphern verwendet (z.B. Edelsteinmetaphorik), um die Schönheit und das Wunder der Schöpfung hervorzuheben. Die Frage, ob die Fliege als "hässlich" zu betrachten ist, wird diskutiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Insekts und dessen Eigenschaften.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und ordnet sie in den größeren Kontext der Aufklärung ein. Sie zeigt, wie Brockes' "Die kleine Fliege" den Wandel der Naturlyrik vom Barock zur Aufklärung repräsentiert und wie er irdische Beobachtung und theologische Interpretation verbindet.
- Quote paper
- Nadine Bavink (Author), 2002, Barthold Heinrich Brockes: "Die kleine Fliege" Das hässliche Insekt als Verweis auf den Schöpfer?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24679