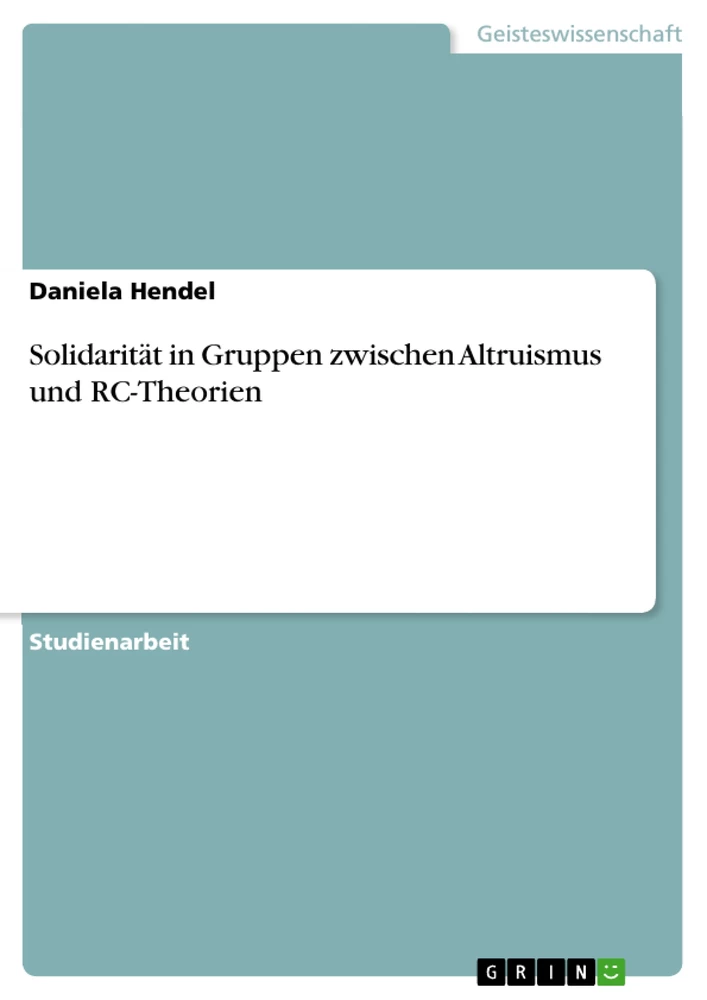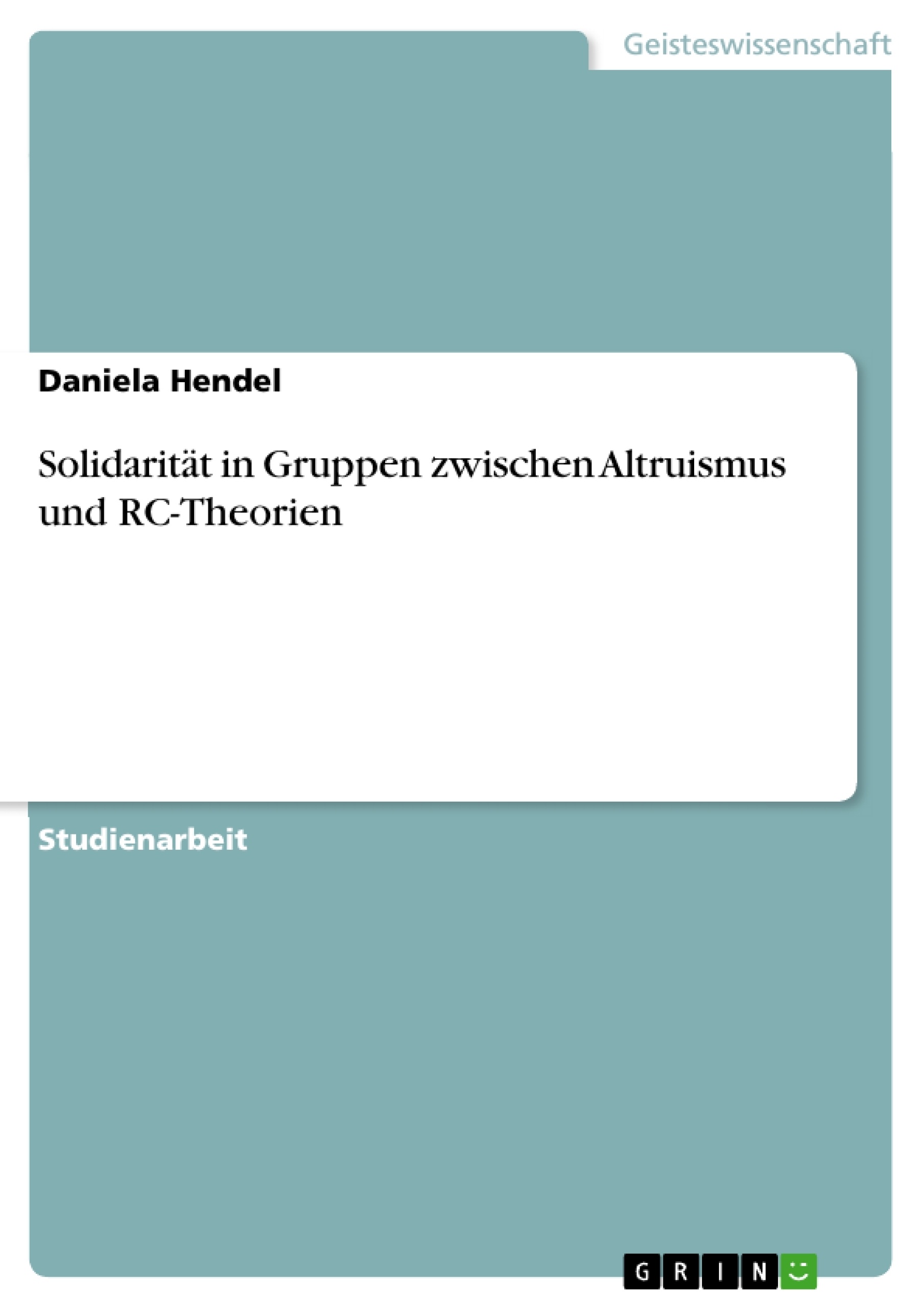Wenn wir von Solidarität reden, geht es meist um einen politischen Kampfbegriff. Die Rede
ist von der Solidargemeinschaft, vom Solidaritätszuschlag, vom Solidarpakt, von der
Klassensolidarität oder von „Solidarität als Wert und als Instrument politischer Steuerung“.
Es ist also ein Begriff, der auf den ersten Blick sehr viel unterschiedliche Inhalte
annehmen kann. Dabei werden weder dieselben Interessengruppen angesprochen noch wird
geklärt aus welchem Grund wir in einer bestimmten Situation solidarisch handeln –falls wir es
tun-. „Diese Annahmen lassen sich in ihrer allgemeinen Tendenz so zusammenfassen, dass sie
dem Begriff der >Solidarität< zu schnell und zu einseitig eine normative und insbesondere
eine politische und dabei teils instrumentelle, teils speziell auf den Staat bezogene Bedeutung
zuschreiben.“ (2) Wildt fehlt die „affektiv-moralische Bedeutung“ des Wortes.(3)
Trotzdem ist diesen Schlagwörtern eines gemeinsam: Solidarität bedeutet
Zusammengehörigkeitsgefühl bzw. Gemeinsinn. Duden Fremdwörterbuch Wer gehört jedoch
zu wem? Hondrich und Koch-Arzberger, definieren die Solidarität als „eine freie Art der
sozialen Bindung“ (4) die durch „latente Reziprozität“ (5) gekennzeichnet ist. Es wird also
freiwillig gehandelt und mit der Erwartung der Solidarität von der anderen Seite in ähnlicher
Situation gerechnet. „Solidarität erweist sich so, in der Praxis, als ein überaus
voraussetzungsvoller, eng umgrenzter Begriff: als Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen
Personen, die, trotz Differenzen, ihre Interessenlage und Ziele als gleich verstehen, aber
ungleich beeinträchtigt sehen, woraus der Anspruch bzw. die freiwillige Verpflichtung
einseitiger Unterstützung erwächst, gekoppelt mit dem Anspruch auf bzw. der Verpflichtung
zur Unterstützung von der anderen Seite, sofern die Situation sich verkehrt.“ (6)
Über den historischen Ursprung des Wortes und wann es eine politische Bedeutung annahm,
herrscht Uneinigkeit. Wildt weist darauf hin, dass Solidarité zunächst die „römisch-rechtliche
Bedeutung der Haftungspflicht für Mitschuldige (>Solidarobligation<)“ (7) beinhaltete im
Gegensatz zu der verbreiteten Meinung, dass Solidarität aus dem Brüderlichkeitsideal der
Französischen Revolution hervorgegangen sei. [...]
(1) Hondrich, Koch-Arzberger, 9
(2) Wildt, 202
(3) ebd.
(4) Honrich, Koch-Arzberger, 15
(5) ebd., 14
(6) ebd.
(7) Wildt, 203
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einführung
- 1. Altruismus
- 1.1. Was bedeutet Altruismus?
- 1.2. Wann handeln wir altruistisch?
- 1.3. Schlussfolgerungen
- 2. Rational Choice - Theorien (RC-Theorien)
- 2.1. „Die Evolution der Kooperation“ (Axelrod)
- 2.2. Hechters, Colemans und Turners Ansatz
- Die Grenzen der RC-Theorien
- 3. Das solidarische Verhalten in Gruppen - Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Solidarität, indem sie zunächst den Altruismus als mögliche Grundlage beleuchtet und diesen mit egoistischen Ansätzen, repräsentiert durch Rational-Choice-Theorien, vergleicht. Ziel ist es, die Bedingungen zu ergründen, unter denen Menschen solidarisch handeln, unabhängig von politischen oder institutionellen Faktoren. Die Arbeit sucht nach einer Erklärung jenseits von rein politischer Motivation.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Solidarität"
- Analyse des Altruismus als möglicher Basis für solidarisches Handeln
- Gegenüberstellung von altruistischen und egoistischen Handlungsmotiven (Rational-Choice-Theorien)
- Bedingungen für solidarisches Verhalten in Gruppen
- Suche nach Erklärungen für solidarisches Handeln jenseits von politischer Instrumentierung
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einführung: Die Einleitung beleuchtet die vielschichtigen Bedeutungen des Begriffs „Solidarität“, von politischen Kampfbegriffen bis hin zu affektiv-moralischen Dimensionen. Sie kritisiert einseitige, normativ-politische Interpretationen und betont die Bedeutung des Zusammengehörigkeitsgefühls und des Gemeinsinns. Die Autorin kündigt an, die Entwicklung solidarischen Verhaltens von der Institutionalisierung im Wohlfahrtsstaat und politischer Motivation abzukoppeln, um sich dem allgemeinen Phänomen zu nähern. Die Arbeit verwendet die Definition von Hondrich und Koch-Arzberger als Arbeitsgrundlage, die Solidarität als eine freiwillige soziale Bindung mit latenter Reziprozität definiert, obwohl diese Definition als lückenhaft erkannt wird. Die Autorin kündigt an, das Problem von verschiedenen Seiten zu beleuchten, insbesondere unter Einbezug von Altruismus und Rational-Choice-Theorien.
1. Altruismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Existenz und dem Wesen des Altruismus. Es werden verschiedene Definitionen und Auffassungen diskutiert, inklusive der Frage, ob Altruismus tatsächlich ohne jeglichen Eigennutz existiert oder ob es immer auch versteckte egoistische Motive gibt. Das Kapitel untersucht empirische Belege für altruistisches Verhalten und diskutiert die Rolle des Altruismus im gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Autorin stellt die These auf, dass eine altruistische Persönlichkeit einen großen Einfluss auf das Verhalten in der Gruppe und Gesellschaft hat und möglicherweise die Lücken in der Solidaritätsdefinition schließen könnte.
2. Rational Choice - Theorien (RC-Theorien): Das Kapitel präsentiert die Rational-Choice-Theorien als Gegenpol zum Altruismus, indem es den Ansatz von Axelrod ("Die Evolution der Kooperation") und die Ansätze von Hechter, Coleman und Turner erläutert. Es untersucht die Grenzen und die Anwendbarkeit dieser Theorien auf die Erklärung solidarischen Verhaltens. Das Kapitel stellt die Frage nach der Übereinstimmung von Kooperation und Solidarität in den Raum, wobei diese Frage bis zum späteren Kapitel offen bleibt. Die Untersuchung der Rational-Choice-Theorien dient dazu, die komplexen Motive hinter menschlichem Handeln besser zu verstehen und die Grenzen egoistischer Erklärungen für solidarisches Verhalten aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Solidarität, Altruismus, Rational-Choice-Theorien, Kooperation, Gemeinsinn, Zusammengehörigkeitsgefühl, prosoziales Verhalten, egoistisches Handeln, soziale Bindung, Reziprozität, Gemeinschaftsleben, moralische Verpflichtung.
FAQ: Solidarität - Altruismus und Rational-Choice-Theorien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Solidarität. Sie beleuchtet den Altruismus als mögliche Grundlage und vergleicht diesen mit egoistischen Ansätzen, repräsentiert durch Rational-Choice-Theorien. Das Ziel ist es, die Bedingungen für solidarische Handlungen unabhängig von politischen oder institutionellen Faktoren zu ergründen – eine Erklärung jenseits rein politischer Motivation wird gesucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von „Solidarität“, analysiert den Altruismus als mögliche Basis für solidarisches Handeln, vergleicht altruistische und egoistische Handlungsmotive (Rational-Choice-Theorien), untersucht die Bedingungen für solidarisches Verhalten in Gruppen und sucht nach Erklärungen für solidarisches Handeln jenseits politischer Instrumentierung.
Wie wird der Altruismus in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zum Altruismus diskutiert dessen Definition und Existenz, die Frage nach reinem Altruismus ohne Eigennutz und untersucht empirische Belege. Die These wird aufgestellt, dass eine altruistische Persönlichkeit einen großen Einfluss auf das Verhalten in der Gruppe und Gesellschaft hat und möglicherweise Lücken in der Solidaritätsdefinition schließen könnte.
Wie werden Rational-Choice-Theorien in die Untersuchung einbezogen?
Rational-Choice-Theorien werden als Gegenpol zum Altruismus präsentiert. Die Ansätze von Axelrod ("Die Evolution der Kooperation") und Hechter, Coleman und Turner werden erläutert, ihre Grenzen und Anwendbarkeit auf solidarisches Verhalten untersucht. Die Übereinstimmung von Kooperation und Solidarität wird hinterfragt. Die Untersuchung dient dazu, komplexe Motive menschlichen Handelns zu verstehen und die Grenzen egoistischer Erklärungen für solidarisches Verhalten aufzuzeigen.
Welche Definition von Solidarität wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Definition von Hondrich und Koch-Arzberger als Arbeitsgrundlage: Solidarität als freiwillige soziale Bindung mit latenter Reziprozität. Diese Definition wird jedoch als lückenhaft erkannt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Solidarität, Altruismus, Rational-Choice-Theorien, Kooperation, Gemeinsinn, Zusammengehörigkeitsgefühl, prosoziales Verhalten, egoistisches Handeln, soziale Bindung, Reziprozität, Gemeinschaftsleben und moralische Verpflichtung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einführung, ein Kapitel über Altruismus, ein Kapitel über Rational-Choice-Theorien und ein zusammenfassendes Kapitel über solidarisches Verhalten in Gruppen.
Was ist das Fazit der Einführung?
Die Einführung beleuchtet die vielschichtigen Bedeutungen von „Solidarität“ und kritisiert einseitige, normativ-politische Interpretationen. Sie betont die Bedeutung des Zusammengehörigkeitsgefühls und des Gemeinsinns und kündigt an, die Entwicklung solidarischen Verhaltens von Institutionalisierung und politischer Motivation abzukoppeln, um sich dem allgemeinen Phänomen zu nähern.
- Quote paper
- Daniela Hendel (Author), 2000, Solidarität in Gruppen zwischen Altruismus und RC-Theorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24469