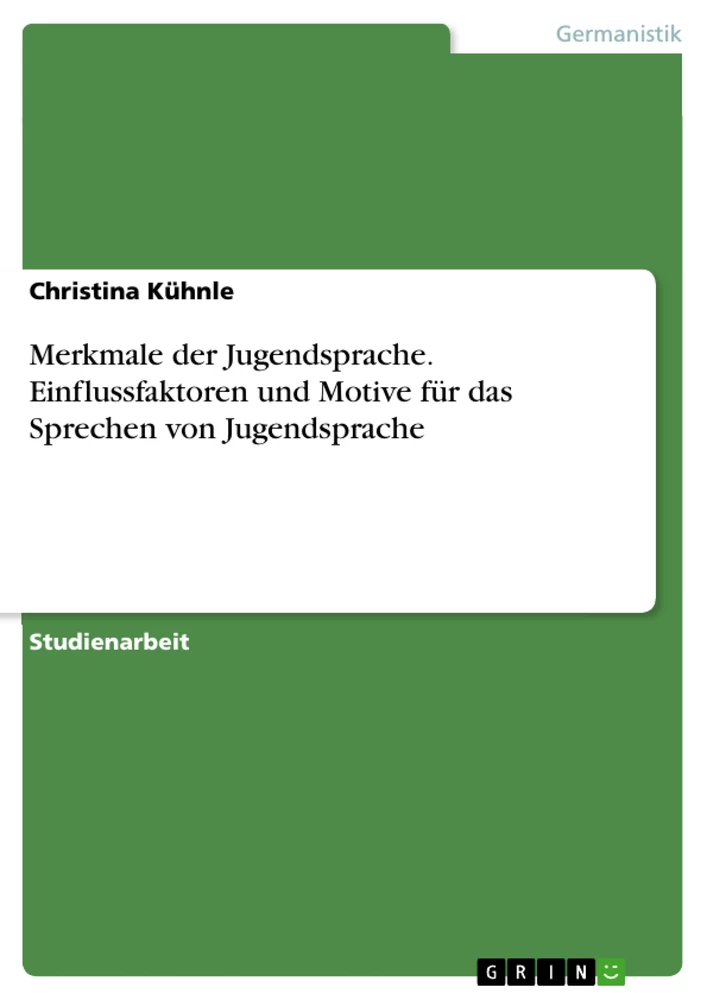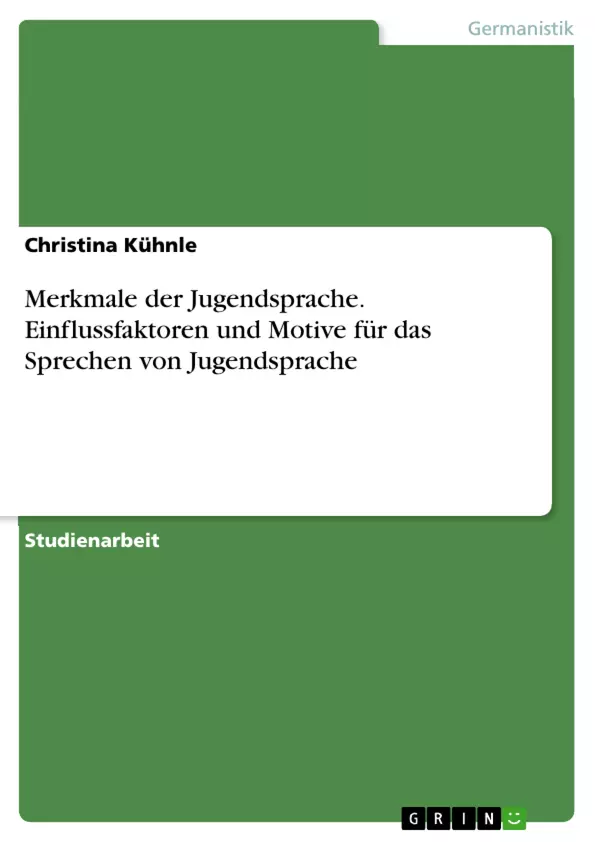Die Jugend sind zunächst einmal Mitglieder mehrerer Kommunikationsgruppen.
Es gibt eine breite Vielfalt von Definitionsmöglichkeiten (aus Sicht der Juristen, Humanbiologen, des sozialen Alters).
Es wird der Übergang vom Kindsein zum Erwachsenenalter damit bezeichnet.
Ein Jugendlicher befindet sich zwischen der Pubertät (11-14 Jahre) und dem Beginn der Postadoleszenz. Auch der Begriff „Berufsjugendliche“ soll geklärt werden.
Diese gelten nicht im entwicklungspsychologischen Sinne als Jugendliche, sondern fühlen sich nur jung, kleiden sich und sprechen so, was aber nicht als Jugendsprache gilt. Jugendsprache ist keine gruppenspezifische Sprache und damit keine eigenständige Sprache.
Es ist keine homogene Varietät des Deutschen, sondern ein spielerisches Sekundärgefüge mit bestimmten Merkmalen, häufig wird Jugendsprache auf bestimmte Ausdrücke reduziert, da dieser Teil am Auffälligsten ist. Zum Beispiel die Wörter "geil“ oder „abgefahren“ heben sich von den Wörtern des erwachsenen Beobachters ab. Wörter wie „schön“ oder „spannend“ würden nicht auffallen, da Beobachter sie selbst verwenden. Dies ist auf die selektive Wahrnehmung zurückzuführen. Jugendliche, die nicht diese Ausdrücke verwenden, die als jugendsprachlich angesehen werden, werden einfach nicht beachtet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Begriffserklärung
- 1.1 Jugend
- 1.2 Jugendsprache
- 2. Geschichte der Jugendsprache
- 3. Motive für das Sprechen von Jugendsprache
- 3.1 Abgrenzung
- 3.2 Protest
- 3.3 Unsicherheit
- 3.4 Bessere Verständigung
- 3.5 Innovation des Spiels, Aggressionsabbau
- 4. Äußere Einflussfaktoren
- 4.1 Medien/Werbung
- 4.2 Fach- und Sondersprachen
- 4.3 Fremdsprachen
- 4.4 Dialekte
- 5. Merkmale und Beispiele der Jugendsprache
- 5.1 Phonologische Merkmale
- 5.2 morphologische Merkmale
- 5.3 syntaktische Merkmale
- 5.4 lexikalische Merkmale
- 6. Grundtendenzen im allgemein sprachlichen Verhalten
- 6.1 Nord-Süd-Diskrepanz
- 6.2 West-Ost-Diskrepanz
- 6.3 Stadt-Land-Diskrepanz
- 7. Probleme
- 8. Behandlung im Unterricht
- 8.1 Unter- und Mittelstufe
- 8.2 höhere Jahrgangsstufen
- 8.3 Problem
- 8.4 Quiz
- 9. Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Jugendsprache und untersucht deren Entstehung, Merkmale, Motive und Probleme. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Besonderheiten dieser Sprachvarietät zu entwickeln und ihre Rolle in der gesellschaftlichen Kommunikation zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Jugendsprache
- Historisches Entstehen und Entwicklung
- Motivationen für die Verwendung von Jugendsprache
- Merkmale und Beispiele der Jugendsprache
- Probleme und Herausforderungen im Umgang mit Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Jugendsprache vor und führt in das Thema ein. Das erste Kapitel definiert Jugendsprache und grenzt sie von anderen Sprachvarietäten ab. Das zweite Kapitel behandelt die historische Entwicklung der Jugendsprache, wobei die Entstehung in den verschiedenen Sprachschichten des 19. Jahrhunderts und die starke Prägung durch die britische und amerikanische Popkultur nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgehoben werden. Das dritte Kapitel untersucht die Motive für das Sprechen von Jugendsprache, wobei Abgrenzung, Protest, Unsicherheit und bessere Verständigung als wichtige Faktoren dargestellt werden. Das vierte Kapitel beleuchtet äußere Einflussfaktoren auf die Jugendsprache wie Medien, Fachsprachen, Fremdsprachen und Dialekte. Das fünfte Kapitel geht auf die Merkmale und Beispiele der Jugendsprache ein und betrachtet phonologische, morphologische, syntaktische und lexikalische Besonderheiten. Das sechste Kapitel behandelt die Grundtendenzen im allgemein sprachlichen Verhalten, wobei die Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland, West- und Ostdeutschland sowie Stadt und Land beleuchtet werden. Das siebte Kapitel befasst sich mit Problemen, die durch die Verwendung von Jugendsprache auftreten können.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachentwicklung, Sprachwandel, Sprachvariation, soziolinguistische Varietät, Sprachsoziologie, Identitätsbildung, Jugendkultur, Mediensprache, Dialekt, Soziolekt, Kommunikation.
- Quote paper
- Christina Kühnle (Author), 2004, Merkmale der Jugendsprache. Einflussfaktoren und Motive für das Sprechen von Jugendsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24158