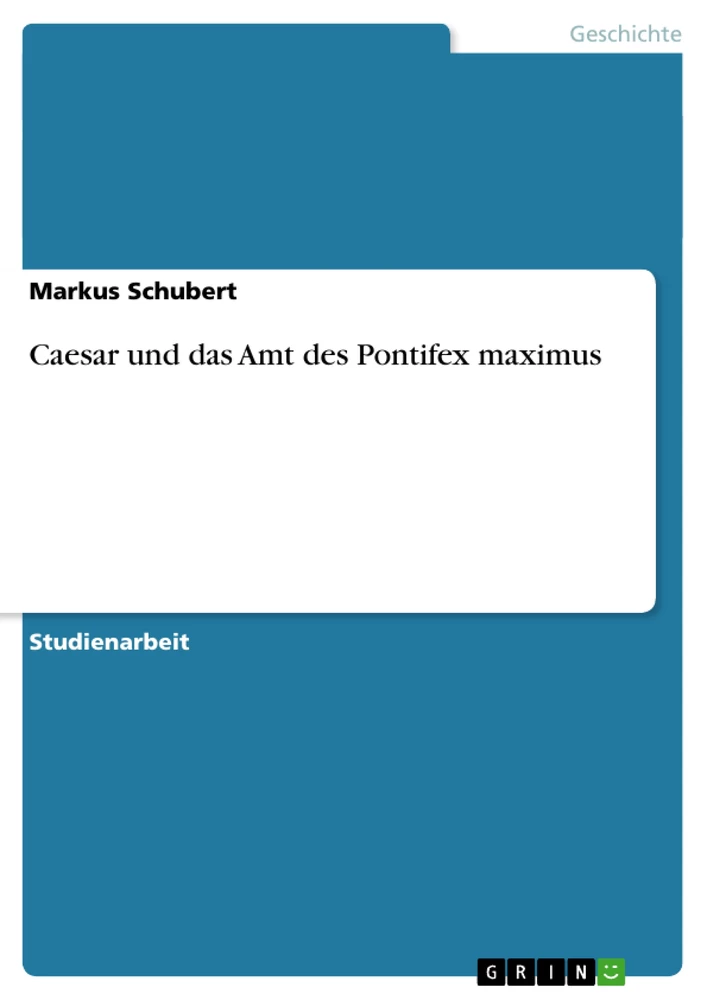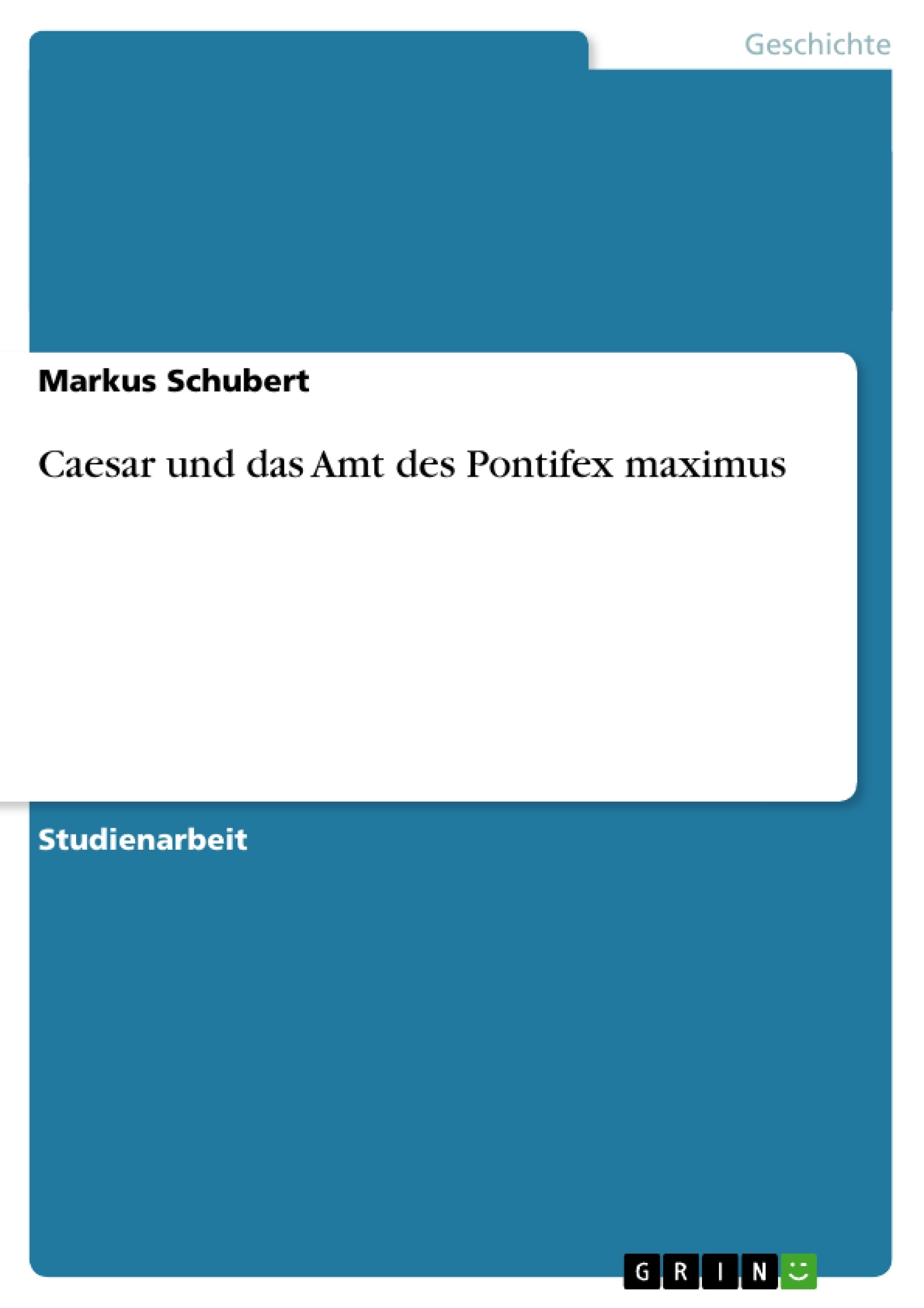Was waren die Hauptmerkmale der römischen Religion?
Die Religion war neben der alltäglichen Ausübung vor allem präsent im politischen Bereich.
Der Senat z. B. tagte in einem sakral definierten Raum, einem templum. Senatssitzungen
wurden durch Weihrauchopfer der eintretenden Senatoren eröffnet. Diese Rituale wurden erst
nach einem langen Christianisierungsprozess der Oberschicht durch Bischof Ambrosius von
Mailand im Streit um den Viktoriaaltar beendet.1 Die römische Religion war eine
Opferreligion: So führten die hohen Magistrate in Rom, die Verwaltungsspitzen in den
Provinzen und die Feldherrn im Krieg ständig Opfer durch. Größere Aktivitäten wurden
durch Opfer sowie Anfragen an die Götter (Auspizien in Form der Vogelschau) eingeleitet
und durch diesen Rat abgesichert. „Vor wichtigeren Angelegenheiten, Auszug in einen Krieg,
Beginn einer Schlacht, wurde selbstverständlich geopfert und der Wille der Götter erfragt.“2
Daneben waren die verschiedenen Vereinigungen einer Stadt als Kultvereine organisiert. „So
konstituierte sich etwa ein Verein aller Bäcker oder Lederarbeiter, um den Kult einer
bestimmten Gottheit - im ersten Fall etwa Vesta - zu pflegen, deren Festtag dann gemeinsam
begangen wurde.“3 Religion bestimmte damit weite gesellschaftliche Bereiche mit.
Welche Bereiche umfasste der römische Kultus?
Die Religion der Römer umfasste die sacra publica, die öffentlichen Kulte, sowie den bereich
der sacra privata, der wiederum aufgeteilt war in Kulte für einzelne Haushalte (familiae), und
der Gentes. Als Sacra bezeichnete man die den Göttern geschuldeten Rituale. Für die privaten
Kulthandlungen handelte der pater familias als Priester.4 Die sacra publica unterschieden sich
von den anderen Kultakten vor allem durch ihre Finanzierung. Die Kosten für die
„öffentlichen Kulte“ nämlich trug die politische Gemeinschaft. Die Einkünfte stammten aus
Steuern und Abgaben sowie aus Kriegsbeute. Heiligtümer und Tempelanlagen für sacra
publica wurden auf öffentlichem Grund errichtet und dann durch einen Akt der Konsekration
in einen locus sacer überführt, in ein Grundstück, das einer Gottheit als Eigentum gehörte.
Außerdem wurde jedem Kult ein Stück Land zur Unterhaltung zugewiesen. 5 [...]
1 Vgl.: Rüpke: Die Religion der Römer, S. 13.
2 Rüpke: S. 13.
3 ebd.
4 Vgl.: Muth: Einführung in die griechische und römische Religion, S. 289.
5 Vgl. zu diesem Abschnitt: Rüpke: S. 27f..
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Häuslicher Kult und Priestertum in Rom
- Der häusliche Kult in der römischen Religion
- Das Priestertum in Rom
- Die Veränderungen nach dem Sturz des Königtums
- Die Kompetenzen und Pflichten des Oberpontifex
- Caesar und die Wahl zum Oberpontifex 63. v. Chr.
- Caesars Motive für die Kandidatur
- Caesar und seine Wahlkonkurrenten
- Die Wahl Caesars und deren Vorbedingungen
- Die politischen Folgen der Wahl
- Persönliche Folgen der Wahl für Caesar
- Die julianische Kalenderreform
- Caesar als Astronom
- Die Kalenderreform Caesars
- Die Durchführung der Kalenderreform und deren Folgen
- Die Einordnung der Kalenderreform des Julius Caesar
- Vom altrömischen Pontifex maximus zum Ehrenprädikat der Päpste
- Das Amt des Pontifex maximus als Bestandteil des Kaisertitels
- Gratian und die Trennung von Heidentum und Staat
- Theodosius und die Unterdrückung des Heidentums
- Die Päpste und der Titel des Pontifex
- Schlussfolgerungen und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung des Amtes des Pontifex maximus im römischen Reich und beleuchtet insbesondere die Rolle Julius Caesars in diesem Zusammenhang. Die Arbeit analysiert Caesars Motive für die Kandidatur zum Oberpontifex, die politischen und persönlichen Folgen seiner Wahl sowie die Auswirkungen der julianischen Kalenderreform. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Amtes des Pontifex maximus vom altrömischen Oberpriester zum Ehrenprädikat der Päpste beleuchtet.
- Die Rolle des Pontifex maximus im römischen Kultus und Politik
- Die politische Bedeutung der Kandidatur und Wahl Caesars zum Oberpontifex
- Die julianische Kalenderreform als ein Beispiel für Caesars Einfluss auf das römische Leben
- Die Transformation des Amtes des Pontifex maximus im spätantiken Reich
- Die Verbindung zwischen dem Amt des Pontifex maximus und der Entwicklung des Christentums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der römischen Religion und den Einfluss des politischen Bereichs auf den Kultus. Das erste Kapitel befasst sich mit dem häuslichen Kult und dem Priestertum in Rom, wobei die Veränderungen nach dem Sturz des Königtums sowie die Kompetenzen und Pflichten des Oberpontifex im Fokus stehen. Das zweite Kapitel untersucht Caesars Kandidatur zum Oberpontifex und die politischen Folgen seiner Wahl. Die julianische Kalenderreform wird im dritten Kapitel analysiert, wobei Caesars Rolle als Astronom und die Auswirkungen der Reform auf das römische Kalenderwesen beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Römische Religion, Pontifex maximus, Oberpontifikat, Julius Caesar, Kalenderreform, Heidentum, Christentum, Kaisertitel, Spätantike, Päpste.
- Quote paper
- Markus Schubert (Author), 2004, Caesar und das Amt des Pontifex maximus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24151