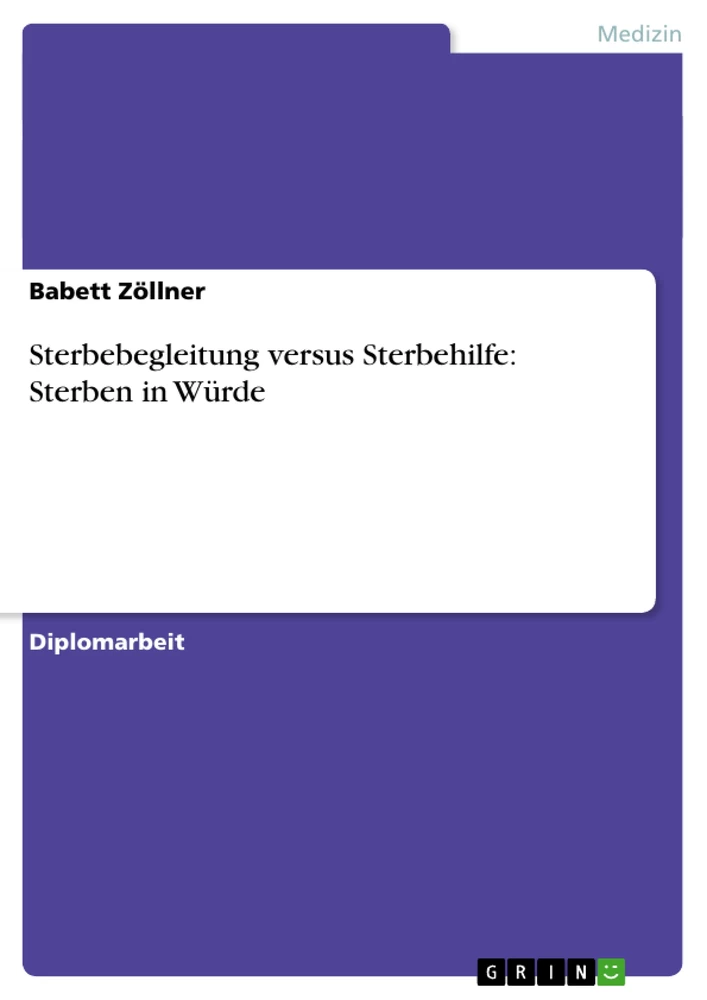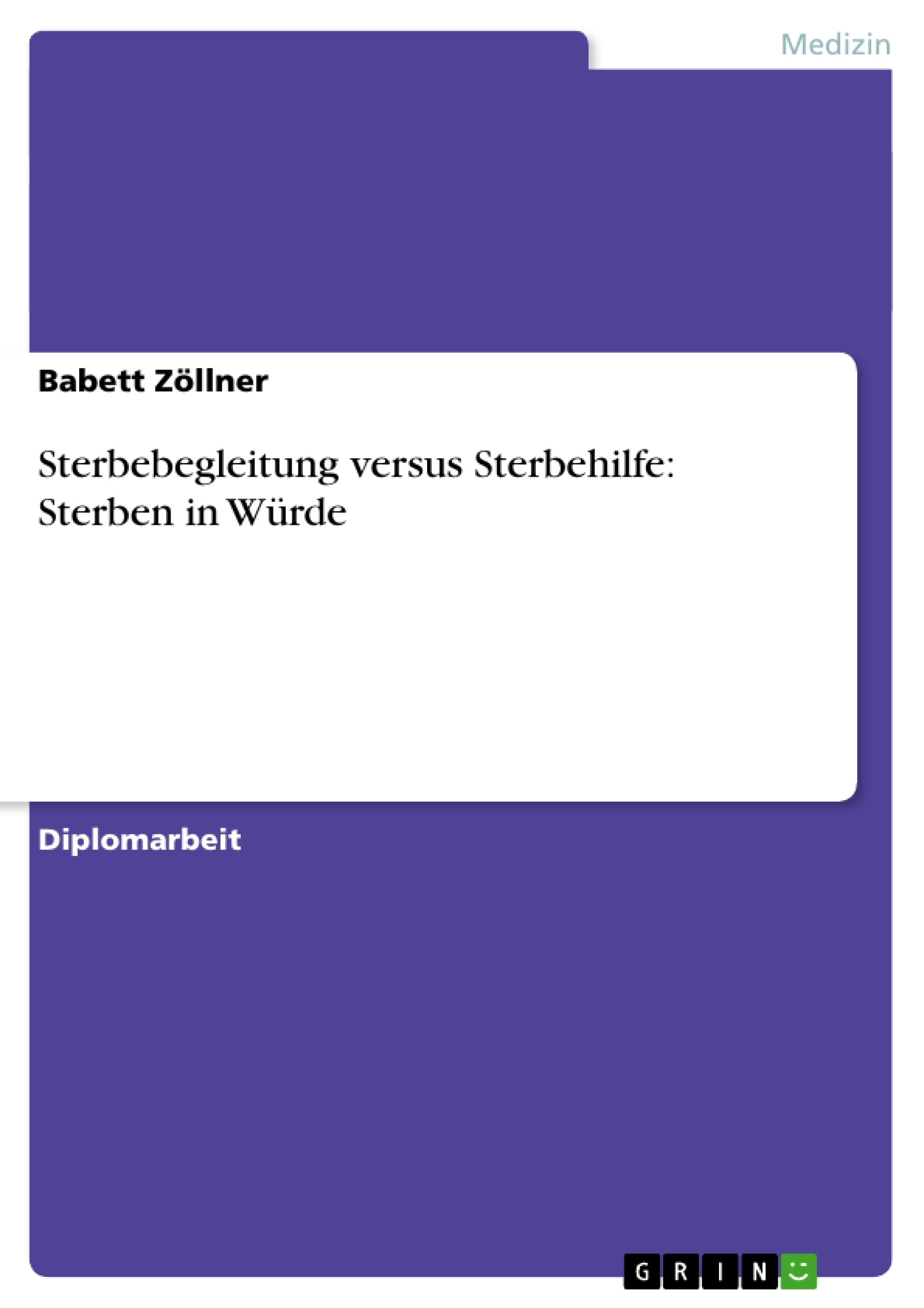"Die Würde des Menschen ist unantastbar." So heißt es in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes der BRD. Die Wichtigkeit und Richtigkeit dieses in unserer Verfassung festgehaltenen Menschenrechts wird niemand ernsthaft in Frage stellen wollen. Doch nicht selten gerät aus dem Blickfeld, daß dieser Grundsatz gerade auch für schwersterkrankte und sterbende Menschen zutreffen sollte. Die Achtung ihrer Würde und ihr Selbstbestimmungsrecht als Grundlage jeglicher Pflege, Versorgung, Unterstützung und Begleitung ist in der heutigen Zeit leider viel zu oft nicht gegeben. Da gerade diese Bevölkerungsgruppe aber über keine Lobby verfügt, und selbst kaum in der Lage ist, auf die sie betreffenden Missstände aufmerksam zu machen, gab es in den letzten Jahren nur selten öffentliche Diskussionen zum Themenbereich der Sterbebegleitung und Sterbehilfe. Erst die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden im April 2001 führte hier in der BRD zu einer kurzzeitigen Belebung der Auseinandersetzung mit dieser Problematik, welche jedoch rasch wieder abflaute. In den teilweise hitzig geführten Diskussionen zu dieser Thematik ging es dabei hauptsächlich um die Frage, was Menschenwürde in Fällen irreversibler Erkrankungen und im Sterbeprozess eigentlich bedeutet. Für die einen, wie zum Beispiel die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben e.V., bedeutet es durchaus, das Leiden durch Euthanasie abzukürzen. Andere wiederum, wie die Hospizverbände und Kirchen, verwehren sich gegen diese Auffassung und vertreten den Standpunkt eines humanen Sterbens, was zum einen die palliativmedizinische Versorgung, zum anderen die persönliche Begleitung sowohl durch Fachkräfte wie auch durch Angehörige und Freunde beinhaltet. So unterschiedlich wie bereits die Würde des Menschen im Sterben beurteilt wird, so verschieden sind die Meinungen dazu, wann die Würde eines Menschen eigentlich erlischt: bereits bei Bewusstlosigkeit oder im Koma, erst bei diagnostiziertem Hirntod oder gar erst bei der Beerdigung.
Aufgrund persönlicher Erfahrungen in der Pflege und Betreuung sterbender Menschen und einer daraus resultierenden intensiven Beschäftigung mit der Problematik habe ich mich dazu entschlossen, meine Diplomarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich dem allgemeinen Trend der Tabuisierung und Verdrängung von Sterben und Tod etwas entgegensetzen und die Diskussion um Sterbebegleitung und Sterbehilfe evtl. neu beleben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sterben und Tod im Wandel
- Sterben und Tod in der Vergangenheit
- Sterben und Tod in der Gegenwart
- Sterben und Tod in der Zukunft
- Die Problemlagen sterbender Menschen
- Körperliche Probleme
- Seelische Probleme
- Sterbemodelle
- Ängste
- Trauer
- Soziale Probleme
- Spirituelle Probleme
- Die Hospizbewegung
- Die Geschichte der Hospizbewegung
- Die Grundsätze der Hospizbewegung
- Formen der Hospizarbeit
- Ambulanter Hospizdienst
- Tageshospiz
- Stationäres Hospiz
- Die Praxis der Sterbebegleitung
- Persönliches Resümee
- Sterbebegleitung - Ein neues Tätigkeitsfeld für Sozialpädagogen
- Euthanasie
- Definition des Begriffes Euthanasie
- Formen der Sterbehilfe
- Sterbebegleitung
- Indirekte Sterbehilfe
- Passive Sterbehilfe
- Aktive Sterbehilfe
- Juristische Betrachtung der Sterbehilfe
- Ethisch -philosophische Betrachtung der Sterbehilfe
- Theologische Betrachtung der Sterbehilfe
- Die katholische Kirche
- Die evangelische Kirche
- Julius Hackethal und der Meineid des Hippokrates
- Die Praxis in den Niederlanden
- Das Sterbehilfe - Gesetz in Belgien
- Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.
- Persönliches Resümee
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die kontroversen Bereiche der Sterbebegleitung und Sterbehilfe, wobei der Fokus auf dem ethischen und gesellschaftlichen Umgang mit dem Sterben in Würde liegt. Ziel ist es, beide Perspektiven umfassend darzustellen und zu vergleichen, ohne vorschnelle Wertungen abzugeben.
- Der Wandel des Verständnisses von Sterben und Tod im gesellschaftlichen Kontext
- Die Problemlagen sterbender Menschen auf körperlicher, seelischer, sozialer und spiritueller Ebene
- Die Rolle der Hospizbewegung in der Sterbebegleitung
- Die verschiedenen Formen der Sterbehilfe und ihre ethisch-rechtlichen Implikationen
- Der Vergleich verschiedener nationaler Ansätze im Umgang mit Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit setzt sich mit der Problematik der Sterbebegleitung und Sterbehilfe auseinander und hinterfragt den Umgang mit der Würde sterbender Menschen. Angestoßen durch persönliche Erfahrungen und die zunehmende gesellschaftliche Tabuisierung des Themas, zielt die Arbeit darauf ab, die Diskussion wiederzubeleben und verschiedene Perspektiven zu beleuchten, insbesondere die gegensätzlichen Ansätze der Hospizbewegung und der aktiven Sterbehilfe.
Sterben und Tod im Wandel: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod, beginnend mit früheren, oft religiös geprägten Vorstellungen, über die Veränderungen durch die Modernisierung der Medizin bis hin zu aktuellen Debatten und Zukunftsperspektiven. Es beleuchtet den Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung und die damit einhergehenden Herausforderungen für die Sterbebegleitung.
Die Problemlagen sterbender Menschen: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit den vielfältigen Herausforderungen, denen sterbende Menschen gegenüberstehen. Er unterteilt die Problemlagen in körperliche, seelische (inklusive Sterbemodellen, Ängsten und Trauer), soziale und spirituelle Aspekte. Durch die detaillierte Betrachtung dieser Facetten wird die Komplexität der Situation sterbender Menschen deutlich und die Notwendigkeit einer umfassenden Begleitung hervorgehoben.
Die Hospizbewegung: Das Kapitel beschreibt die Geschichte, Prinzipien und verschiedenen Formen der Hospizarbeit (ambulant, Tageshospiz, stationär). Es beleuchtet die Praxis der Sterbebegleitung innerhalb der Hospizbewegung und deren Bedeutung für den Umgang mit sterbenden Menschen. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Betreuung und der Gewährleistung von Würde und Selbstbestimmung.
Euthanasie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Euthanasie und differenziert zwischen verschiedenen Formen der Sterbehilfe (indirekt, passiv, aktiv). Es analysiert die juristischen, ethisch-philosophischen und theologischen Aspekte der Sterbehilfe, unter Einbezug unterschiedlicher religiöser Positionen und nationaler Rechtslagen (Niederlande, Belgien). Besondere Aufmerksamkeit erhält die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben und deren Position.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Sterbebegleitung und Sterbehilfe
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die kontroversen Bereiche der Sterbebegleitung und Sterbehilfe. Der Fokus liegt auf dem ethischen und gesellschaftlichen Umgang mit dem Sterben in Würde. Ziel ist ein umfassender Vergleich beider Perspektiven, ohne vorschnelle Wertungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Verständnisses von Sterben und Tod, die Problemlagen sterbender Menschen (körperlich, seelisch, sozial, spirituell), die Rolle der Hospizbewegung, verschiedene Formen der Sterbehilfe und deren ethisch-rechtliche Implikationen sowie einen Vergleich nationaler Ansätze im Umgang mit Sterbehilfe (Niederlande, Belgien).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Sterben und Tod im Wandel, den Problemlagen sterbender Menschen, der Hospizbewegung, Euthanasie und einem Schlusswort. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, die die jeweiligen Themen umfassend beleuchten.
Welche Aspekte des Sterbens werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des Umgangs mit Sterben und Tod, verschiedene Sterbemodelle, Ängste und Trauerprozesse, die Prinzipien und Praktiken der Hospizarbeit (ambulante, Tages- und stationäre Hospize), unterschiedliche Formen der Sterbehilfe (indirekt, passiv, aktiv), juristische, ethisch-philosophische und theologische Betrachtungen der Sterbehilfe sowie die Positionen verschiedener religiöser Gemeinschaften (katholisch, evangelisch).
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e.V., die Rechtslage in den Niederlanden und Belgien und diskutiert die Positionen der katholischen und evangelischen Kirche zur Sterbehilfe. Julius Hackethal und der Meineid des Hippokrates werden ebenfalls erwähnt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Perspektiven zur Sterbebegleitung und Sterbehilfe aufzuzeigen und zu vergleichen, ohne eine eindeutige Wertung vorzunehmen. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die zentralen Ergebnisse jeder Sektion.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an Leser, die sich akademisch mit den Themen Sterbebegleitung und Sterbehilfe auseinandersetzen möchten. Sie ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und alle Interessierten, die ein tiefes Verständnis der ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen im Umgang mit dem Sterben erlangen wollen.
Wo finde ich die vollständigen Kapitelzusammenfassungen?
Die vollständigen Kapitelzusammenfassungen befinden sich im HTML-Dokument, das die Struktur und den Inhalt der Diplomarbeit detailliert darstellt.
- Quote paper
- Babett Zöllner (Author), 2002, Sterbebegleitung versus Sterbehilfe: Sterben in Würde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24071