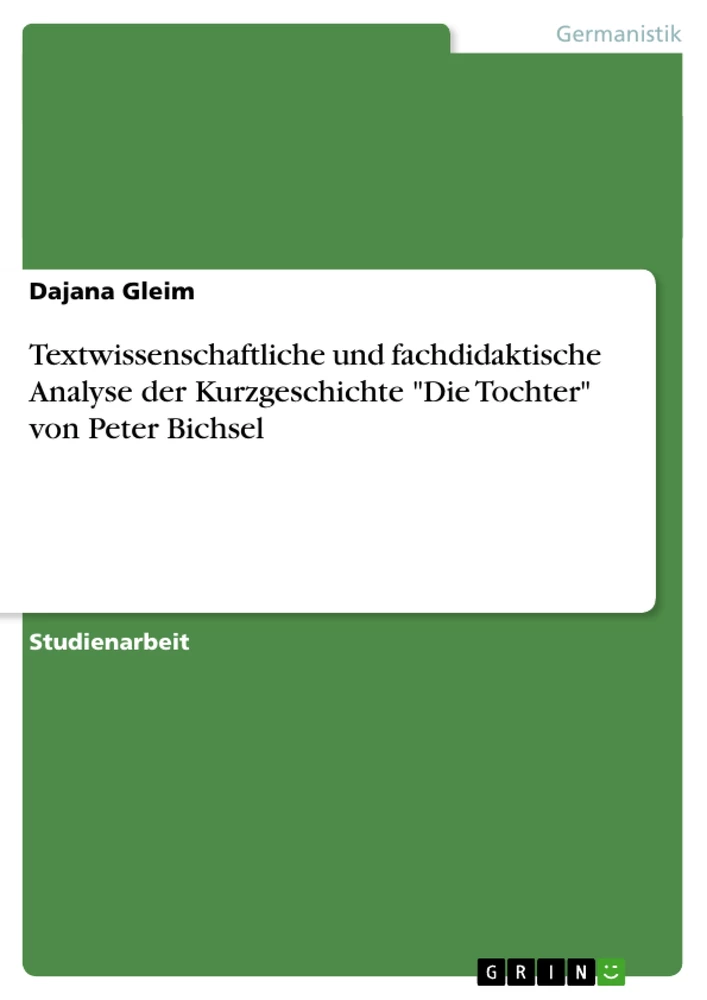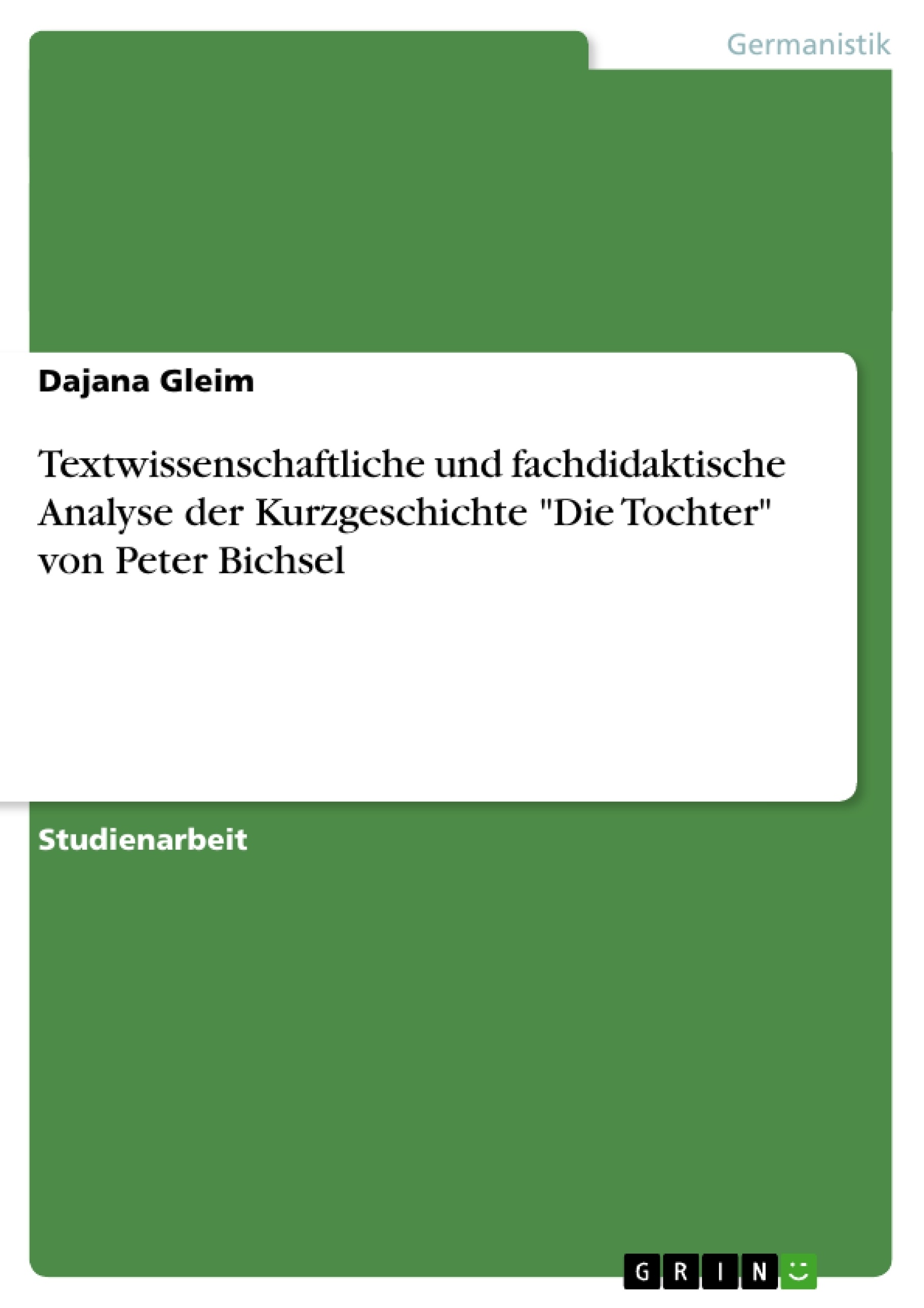In der deutschen Literatur taucht der Begriff „Kurzgeschichte“ zum erstenmal im Laufe der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf. Wortbedeutung und Gebrauch sind allerdings in dieser Phase keineswegs klar definiert. Eine Kurzgeschichte ist demnach zwar eine relativ kurze Geschichte, aber nicht jede Geschichte ist auch eine Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte zählt zum „unaufgeklärtesten „Typus“ literarischen Ausdrucks“ und ist die poetologisch umstrittenste Gattung. Doderer führt dies u.a. auf die Entstehungsgeschichte und das geringe Alter des Begriffes zurück, sowie auf vernachlässigte Formuntersuchungen in der deutschen Literaturwissenschaft. Seine Arbeiten gehen davon aus, dass die Kurzgeschichte sich als selbständige Gattung neben anderen epischen Kurzformen herausgebildet hat. Als Vorläufer können hier die Anekdote, die Novelle und die short story genannt werden. Nach Kilchenmann vollzieht sich der eigentliche Durchbruch der Kurzgeschichte, als eigene Form, erst unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg, weil sie „mit ihrer Möglichkeit der dokumentarischen Zeugenaussage über menschliche Wirklichkeit (...) dem Lebensgefühl (...) der Trümmerwelt von 1945 am besten entsprach“. Der Mensch steht „mit seiner Not, mit seinem Anliegen im Mittelpunkt“. Die jungen Schriftsteller versuchten eine neue Form zu finden, „der es möglich ist, sich der rapide veränderten Welt anzupassen und quecksilberhaft, chamäleonartig und lebendig jeder unerwarteten Situation gerecht zu werden“. Die Kurzgeschichte drückt damit die ständige Veränderung der Gegenwart aus und darf deshalb, nach Kilchenmann, „keine feste Form aufweisen“. Folglich ist die Form von besonderer Wichtigkeit, sie ist Teil des Inhalts. Die beiden wichtigsten Versuche zu einer Typologie der Kurzgeschichte stammen von Doderer (1953) und Höllerer (1967). Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass keiner der beiden Typologisierungsversuche als zufriedenstellend angesehen werden kann, „weil keiner die Variabilität des Phänomens Kurzgeschichte in seiner chamäleonartigen Differenzierung abzudecken vermag“. Es gibt also nicht die Kurzgeschichte, sondern nur Kurzgeschichten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fachwissenschaftliche Analyse
- Textbeschreibung
- Handlung, Gliederung und Aufbau
- Figurenkonstellation
- Der Titel
- Erzählsituation
- Sprache
- Struktur und Textsorte
- Textinterpretation
- Textbeschreibung
- Fachdidaktische Analyse
- Der didaktische Wert der Kurzgeschichte
- Die Kurzgeschichte „Die Tochter“
- Allgemeine Lernziele
- Handlung, Gliederung, Aufbau
- Erzählsituation
- Titel
- Sprache
- Figuren
- Struktur und Textsorte
- Textinterpretation
- Bezug zum Bildungsplan
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Kurzgeschichte „Die Tochter“ von Peter Bichsel aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Perspektive zu analysieren. Dabei wird der Text zunächst im Hinblick auf seine Handlung, Figuren, Sprache, Struktur und Textsorte untersucht, bevor die möglichen didaktischen Einsatzmöglichkeiten und Lernziele für den Schulunterricht im Detail erörtert werden.
- Analyse der formalen und inhaltlichen Merkmale der Kurzgeschichte „Die Tochter“
- Interpretation der Geschichte im Kontext von Peter Bichsels Werk und literarischen Strömungen
- Evaluierung des didaktischen Wertes der Kurzgeschichte für den Deutschunterricht
- Entwicklung von Lernzielen und -methoden zur didaktischen Erschließung der Kurzgeschichte
- Bezugnahme auf den Bildungsplan und aktuelle didaktische Diskurse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den Entstehungskontext der Kurzgeschichte als literarische Gattung und thematisiert die Schwierigkeiten, sie eindeutig zu definieren. Die Autorin skizziert die Entwicklung der Kurzgeschichte im 20. Jahrhundert und ihre charakteristischen Merkmale wie Kürze, Offenheit, Alltäglichkeit und Symbolhaftigkeit.
Fachwissenschaftliche Analyse
Textbeschreibung
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Handlung, der Gliederung und dem Aufbau der Kurzgeschichte. Dabei wird die Erzählperspektive und Sprache analysiert, die Figuren vorgestellt und die Textsorte eingeordnet.
Textinterpretation
Im nächsten Kapitel wird die Kurzgeschichte im Hinblick auf ihre literarische Bedeutung interpretiert. Hierbei werden die einzelnen Elemente der Geschichte, wie zum Beispiel die Figuren, die Handlung und die Sprache, in Beziehung zueinander gesetzt, um die Botschaft der Geschichte zu entschlüsseln.
Fachdidaktische Analyse
Der didaktische Wert der Kurzgeschichte
In diesem Abschnitt wird der Wert der Kurzgeschichte als Unterrichtsmaterial für den Deutschunterricht erörtert. Hierbei werden die möglichen Lernziele und die Relevanz der Geschichte für die Entwicklung von Lesekompetenz und Sprachbewusstsein beleuchtet.
Die Kurzgeschichte „Die Tochter“
Dieser Teil widmet sich der konkreten Analyse der Kurzgeschichte „Die Tochter“ im Hinblick auf ihren didaktischen Einsatz. Es werden spezifische Lernziele für den Einsatz der Geschichte im Unterricht formuliert und Möglichkeiten zur Bearbeitung im Unterricht aufgezeigt.
Allgemeine Lernziele
In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Lernziele für die Arbeit mit Kurzgeschichten im Unterricht zusammengefasst. Die Autorin beschreibt die didaktischen Möglichkeiten, die sich durch die Auseinandersetzung mit der Kurzgeschichte im Hinblick auf verschiedene Kompetenzbereiche, wie z.B. Textverständnis, Sprachreflexion und Interpretation, ergeben.
Bezug zum Bildungsplan
Dieser Abschnitt legt den Bezug zum Bildungsplan dar. Die Autorin stellt den Zusammenhang zwischen den Lernzielen und den Inhalten der Kurzgeschichte mit den Vorgaben des Bildungsplans für den Deutschunterricht her.
Schlüsselwörter
Kurzgeschichte, Peter Bichsel, „Die Tochter“, Fachdidaktik, Textanalyse, Textinterpretation, Didaktischer Wert, Lernziele, Bildungsplan, Erzählperspektive, Sprache, Figurenkonstellation, Struktur, Textsorte.
- Quote paper
- Dajana Gleim (Author), 2004, Textwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse der Kurzgeschichte "Die Tochter" von Peter Bichsel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24033