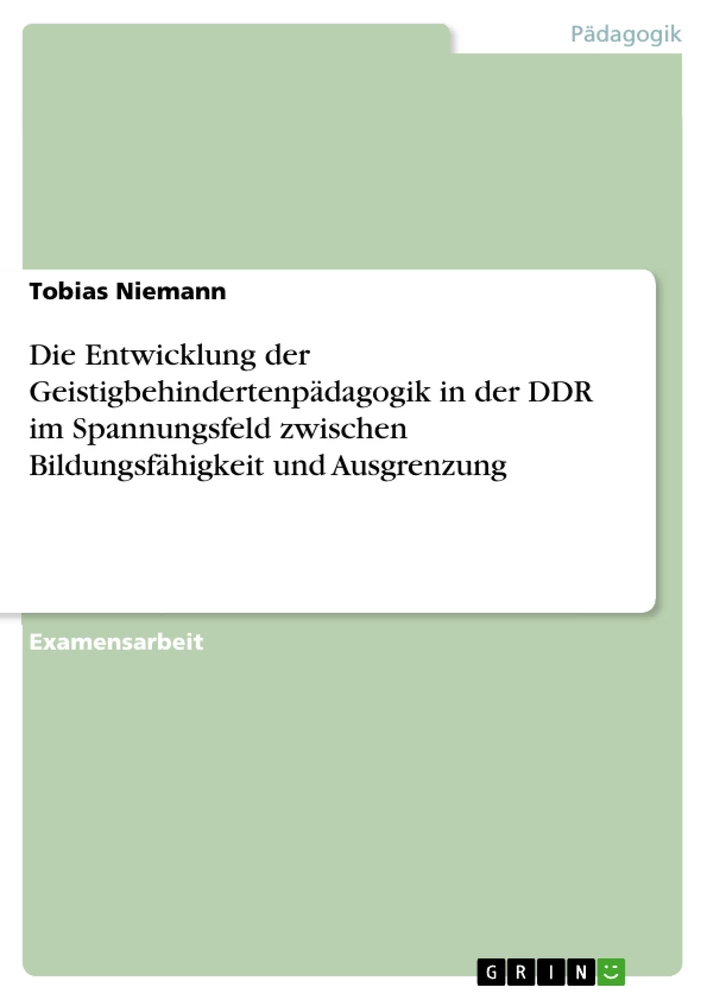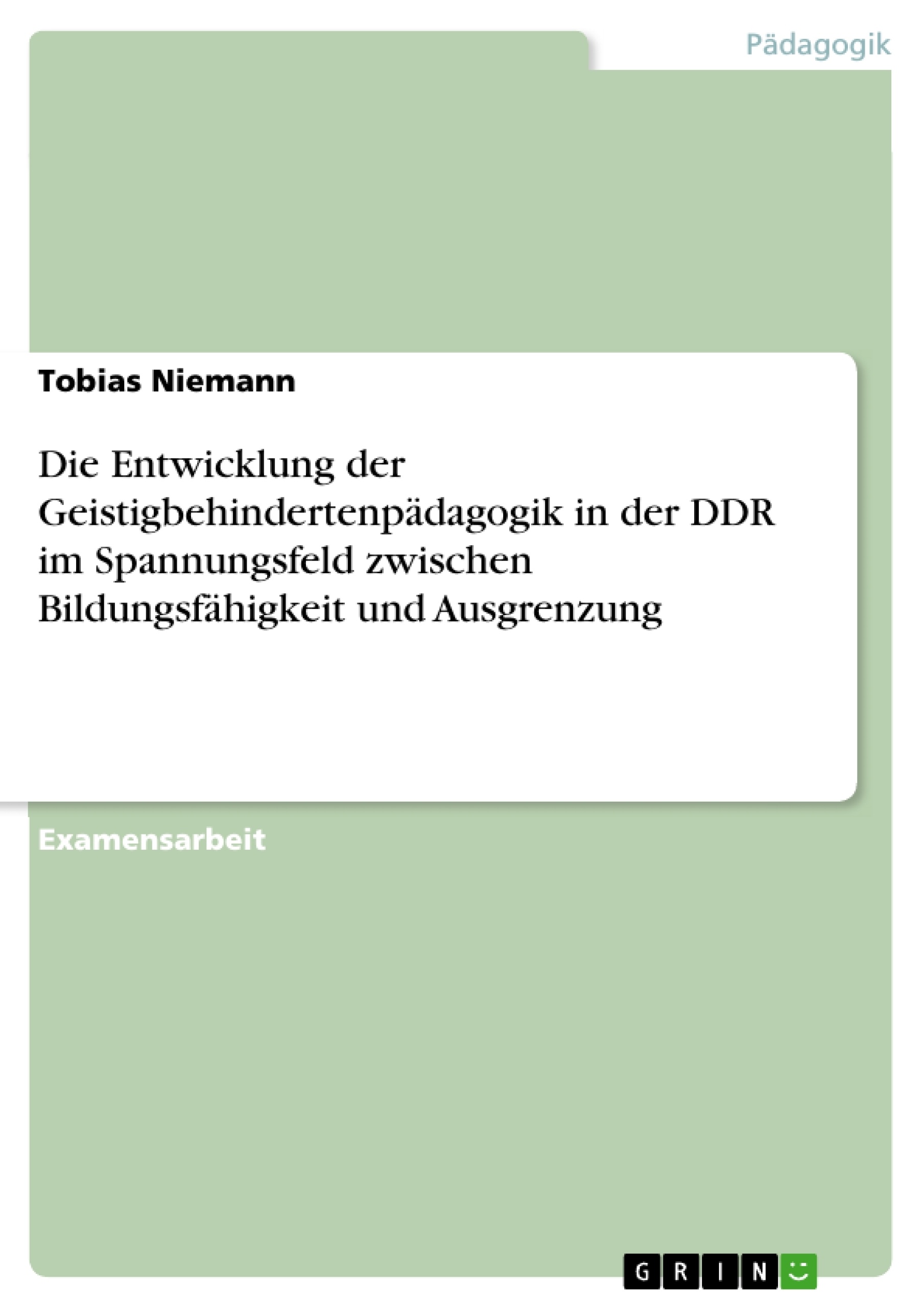Das Thema dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Darstellung der Entwicklung einer Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung in der ehemaligen DDR, wobei die Aspekte der Bildungsfähigkeit und der Ausgrenzung vor dem Hintergrund sozialistischer Pädagogik besondere Beachtung finden sollen. Nach 1989 war die Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung in der DDR einer harschen Kritik ausgesetzt, die sich auf die angebliche Ausgrenzung von geistig behinderten Menschen aus dem Erziehungs- und Bildungssystem der DDR bezog.
Diese Arbeit will anhand von verschiedenen Publikationen untersuchen, wie in der DDR sowohl in der Theorie als auch in der Praxis mit geistig behinderten Menschen umgegangen wurde, welches Menschenbild der Geistigbehindertenpädagogik zu Grunde lag und welche Zielsetzungen Bildung und Erziehung in der DDR zu erfüllen hatten. Galten Menschen mit einer geistigen Behinderung in der DDR als uneingeschränkt bildungs- und schulfähig, so dass ihnen Möglichkeiten zur schulischen und außerschulischen Bildung und Erziehung gegeben wurden, war anerkannt, dass Bildung und Erziehung Konstitutiva des Menschseins sind und somit jeder Mensch bildungsfähig ist oder gab es tatsächlich Tendenzen der Ausgrenzung und praktizierte Exklusion?
Um diese Fragen zu klären, befasst sich diese Arbeit in Kapitel 2 zunächst einmal mit den marxistischen Leitlinien der sozialistischen Pädagogik, die die Grundlagen für alle Konzeptionen der Bildung und Erziehung von Menschen in der DDR bildeten.
Es folgt in Kapitel 3 ein zusammenfassender Überblick über die Entwicklung des Regel- und Sonderschulsystems der DDR, der aufzeigen soll, ob es Unterschiede in der Bildung und Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung gab.
In Kapitel 4 folgen ausführliche Darlegungen zur Rehabilitationspädagogik, die die Konzeption der Bildung und Erziehung für Menschen mit Behinderung in der DDR war.
In den Kapiteln 5-7 geht es speziell um die Lebenssituation von geistig behinderten Menschen, ihrer Schul- bzw. Schulbildungsunfähigkeit und der Frage, welche pädagogischen Fördermöglichkeiten für diese Menschen in der DDR existierten.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit Kapitel 8 und der sich schon aus dem Titel ergebenen Fragestellung, ob es in der DDR ein Unerziehbarkeitsdogma gab, welches Menschen mit geistiger Behinderung den Zugang zu Erziehung und Bildung verwehrte.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Methodischen Vorgehensweise in dieser Arbeit¸
- 2. Einige Leitideen marxistischer und sozialistischer Pädagogik¸
- 2.1 Geschichtsphilosophische Grundlagen
- 2.2 Allseitige Entwicklung der Individuen
- 2.3 Verbindung des Unterrichts mit der produktiven Arbeit
- 2.4 Polytechnische Bildung und Erziehung
- 2.5 Ausblick
- 3. Entwicklung des Regel- und Sonderschulwesens der DDR_
- 3.1 Die Schulreform von 1946
- 3.2 Die Sonderschulentwicklung 1946-1948.
- 3.3 Die ideologische Okkupation der Schule und Pädagogik nach 1948
- 3.4 Die Sonderschulentwicklung 1948-1958
- 3.5 Die Polytechnisierung der Schule seit 1958.
- 3.6 Die Sonderschulentwicklung 1959-1965
- 3.7 Das einheitliche sozialistische Bildungssystem
- 3.8 Die Sonderschulentwicklung 1965-1989.
- 3.9 Zusammenfassung
- 4. Die Entwicklung der Rehabilitationspädagogik als erziehungswissenschaftliche Disziplin
- 4.1 Genese der Bezeichnung Rehabilitationspädagogik
- 4.2 Wissenschaftstheoretisches Selbstverständnis der Rehabilitationspädagogik
- 4.3 Inhaltliche Bestimmung des Rehabilitationsbegriffes
- 4.4 Menschenbild der Rehabilitationspädagogik
- 4.5 Rehabilitationspädagogik - eine Zusammenfassung
- 5. Zur Lebenssituation von geistig behinderten Menschen in der DDR
- 6. Die Rehabilitationspädagogik schulbildungsfähiger intellektuell Geschädigter in der DDR
- 6.1 Gegenstandsbestimmung der Rehabilitationspädagogik schulbildungsfähiger intellektuelle Geschädigter
- 6.2 Wesensbestimmung und Ätiologie schulbildungsfähiger intellektuell Geschädigter
- 6.3 Historische Entwicklung einer speziellen Bildung und Erziehung schulbildungsfähiger intellektuell Geschädigter in der DDR
- 6.4 Zielaspekte der Rehabilitationspädagogik schulbildungsfähiger intellektuelle Geschädigter
- 6.5 Funktion der Rehabilitationspädagogik schulbildungsfähiger intellektuelle Geschädigter
- 6.5.1 Theoretische Funktion
- 6.5.2 Praktische Funktion
- 6.5.3 Prognostische Funktion
- 6.6 Zur Gestaltung des rehabilitationspädagogischen Prozesses mit schulbildungsfähigen intellektuell Geschädigten
- 6.6.1 Einheit von Erziehung, Bildung und Rehabilitation im pädagogischen Prozess
- 6.6.2 Inhalte der Erziehung und Bildung schulbildungsfähiger intellektuell Geschädigter
- 6.7 Zusammenfassung der Rehabilitationspädagogik für schulbildungsfähige intellektuell Geschädigte
- 7. Rehabilitationspädagogik für schulbildungsunfähige förderungsfähige Intelligenzgeschädigte
- 7.1 Gegenstand der Rehabilitationspädagogik der schulbildungsunfähigen förderungsfähigen Intelligenz-geschädigten
- 7.2 Zur Bezeichnung und Kennzeichnung schulbildungsunfähiger förderungsfähiger Intelligenz-geschädigter
- 7.3 Die Entwicklung der Förderungspädagogik in der DDR
- 7.3.1 Lösungsversuche im Rahmen der Hilfsschule
- 7.3.2 Lösungsversuche in Institutionen des Gesundheitswesens
- 7.3.3 Bemühungen zur Lösung des Problems am Institut für Sonderschulwesen der Humboldt-Universität zu Berlin
- 7.4 Aufgaben und Gestaltung der Rehabilitationspädagogik für schwerintelligenzgeschädigte Kinder und Jugendliche
- 7.5 Zusammenfassung der Rehabilitationspädagogik für schulbildungsunfähige förderungsfähige Intelligenzgeschädigte
- 8. Gab es in der Deutschen Demokratischen Republik ein Unerziehbarkeitsdogma?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR. Der Fokus liegt dabei auf dem Spannungsfeld zwischen Bildungsfähigkeit und Ausgrenzung vor dem Hintergrund sozialistischer Pädagogik. Die Arbeit analysiert, wie die DDR in Theorie und Praxis mit Menschen mit geistiger Behinderung umging, welches Menschenbild der Geistigbehindertenpädagogik zugrunde lag und welche Zielsetzungen Bildung und Erziehung in der DDR hatten. Die zentrale Fragestellung untersucht, ob Menschen mit geistiger Behinderung in der DDR als uneingeschränkt bildungs- und schulfähig galten und ihnen somit Möglichkeiten zur schulischen und außerschulischen Bildung und Erziehung gegeben wurden, oder ob es tendenzielle Ausgrenzung und Exklusion gab.
- Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR
- Bildungsfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext sozialistischer Pädagogik
- Ausgrenzung und Exklusion von Menschen mit geistiger Behinderung in der DDR
- Menschenbild und Zielsetzungen der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR
- Analyse von Theorie und Praxis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Relevanz der Untersuchung. Sie beleuchtet den Hintergrund der Kritik an der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR nach 1989 und definiert den Fokus der Arbeit auf die Analyse von Bildungsfähigkeit und Ausgrenzung im Kontext sozialistischer Pädagogik.
Kapitel 2 analysiert die Leitideen marxistischer und sozialistischer Pädagogik im Hinblick auf Bildungsfähigkeit und die Bedeutung von Bildung und Erziehung für die Entwicklung des Individuums. Die Arbeit beleuchtet die geschichtsphilosophischen Grundlagen, die allseitige Entwicklung des Individuums, die Verbindung von Unterricht und produktiver Arbeit sowie die polytechnische Bildung und Erziehung.
Kapitel 3 untersucht die Entwicklung des Regel- und Sonderschulwesens in der DDR. Die Arbeit betrachtet die Schulreform von 1946, die Sonderschulentwicklung in den ersten Nachkriegsjahren, die ideologische Okkupation der Schule und Pädagogik nach 1948, sowie die weitere Entwicklung des Sonderschulwesens bis 1989.
Kapitel 4 beleuchtet die Entwicklung der Rehabilitationspädagogik als erziehungswissenschaftliche Disziplin. Es werden die Genese der Bezeichnung, das wissenschaftstheoretische Selbstverständnis, die inhaltliche Bestimmung des Rehabilitationsbegriffes, das Menschenbild der Rehabilitationspädagogik sowie eine Zusammenfassung der Disziplin diskutiert.
Kapitel 5 widmet sich der Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung in der DDR.
Kapitel 6 fokussiert auf die Rehabilitationspädagogik schulbildungsfähiger intellektuell Geschädigter in der DDR. Die Arbeit untersucht die Gegenstandsbestimmung, die Wesensbestimmung und Ätiologie, die historische Entwicklung einer speziellen Bildung und Erziehung, die Zielaspekte und Funktionen der Rehabilitationspädagogik sowie die Gestaltung des rehabilitationspädagogischen Prozesses.
Kapitel 7 behandelt die Rehabilitationspädagogik für schulbildungsunfähige förderungsfähige Intelligenzgeschädigte in der DDR. Die Arbeit untersucht den Gegenstand der Rehabilitationspädagogik, die Bezeichnung und Kennzeichnung dieser Gruppe, die Entwicklung der Förderungspädagogik in der DDR, die Aufgaben und Gestaltung der Rehabilitationspädagogik sowie eine Zusammenfassung der Disziplin.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR, insbesondere im Hinblick auf Bildungsfähigkeit und Ausgrenzung. Die Schlüsselbegriffe umfassen die Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR, Bildungsfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung, sozialistische Pädagogik, Ausgrenzung und Exklusion von Menschen mit geistiger Behinderung, Menschenbild und Zielsetzungen der Geistigbehindertenpädagogik, sowie die Analyse von Theorie und Praxis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung in der DDR.
- Quote paper
- Tobias Niemann (Author), 2004, Die Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik in der DDR im Spannungsfeld zwischen Bildungsfähigkeit und Ausgrenzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23918