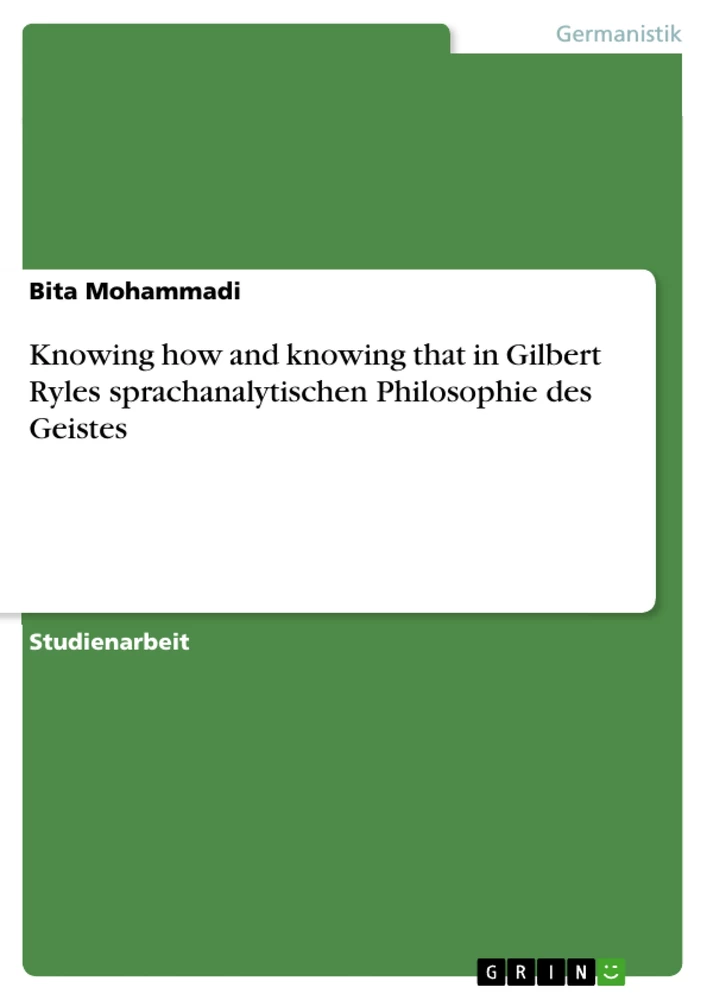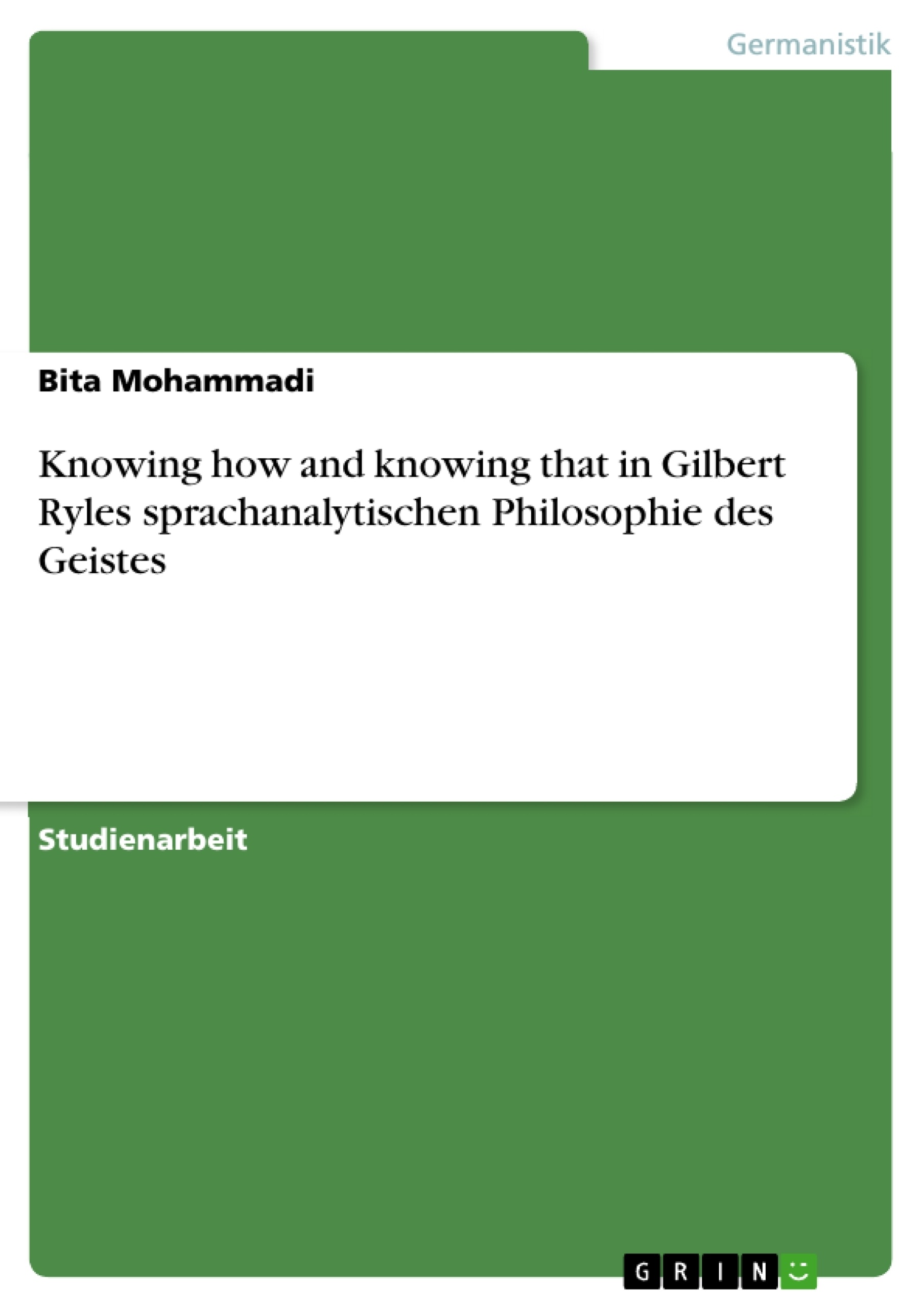Einleitung
Die folgende Arbeit behandelt das Thema „ Knowing how“ und „Knowing That“ in Gilbert Ryles sprachanalytischer Philosophie des Geistes. (Ryle 1949, S.30-77)
Wesentliche Ziele dabei sollen sein, die Begriffe „knowing how“ und „knowing that“ im Zusammenhang mit Ryles Verständnis zu intelligentem Handeln zu erläutern und ferner seinen Argumentationsgang im Sinne der sprachanalytischen Methode
dazulegen. Dazu wird zunächst in einem einleitenden Teil das Thema in einen übergeordneten Zusammenhang eingebettet, der da wäre die Auseinandersetzung und Widerlegung der „traditionellen Theorie“, womit Ryle bestimmte einflussreiche Vorstellungen
über den menschlichen Geist meint, welche er auch ferner als „offizielle Doktrin“, „offizielle Lehre“ oder auch „Descartes` Mythos“ bezeichnet.
Dieser gilt es in seinem Werk eine Alternative darzubieten, weswegen ihre vorherige Erläuterung zum allgemeinen Verständnis notwendig ist und dazu dient, die weitere Argumentation Ryles zum Thema „knowing how“ und „knowing that“ nachzuvollziehen.
Um dem Begriff der Intelligenz näher zu kommen, legt Ryle die Kriterien zur Unterscheidung von intelligenter und unintelligenter Praxis im Sinne der traditionellen Lehre dar. Diese sollen in einem nächsten Teil zunächst erläutert werden, sowie die dabei aufkommenden Widersprüche die Ryle aufweist, um die Theorie anzufechten und seine darauffolgende Widerlegung zu legitimieren.
In einem weiteren Unterpunkt wird dann Ryles Alternativlösung zur Klärung des Begriffes Intelligenz dargestellt. Dieser steht dabei in einem engen Zusammenhang zum „knowing how“ einer bestimmten Tätigkeit. Um dieses „knowing how“ in Ryles Sinne genau zu erfassen, ist es notwendig, seinen Gedankengang nochmals genauer zu untergliedern, denn Ryles Argumentation vollzieht sich auf folgendem Wege.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Einleitung: Ryles Mythos vom Gespenst in der Maschine
- 2.2 Die intellektualistische Legende
- 2.3 Ryles Alternative zur Intellektualistischen Legende
- 2.3.1 Der Begriff „knowing how“
- 2.3.2 Intelligenz und Gewohnheit
- 2.3.3 Der Begriff der Disposition
- 2.3.4 Verstehen und Missverstehen
- 3 Zusammenfassung / Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gilbert Ryles sprachanalytische Philosophie des Geistes, insbesondere seine Konzepte von „knowing how“ und „knowing that“ im Kontext intelligenten Handelns. Ziel ist die Erläuterung dieser Begriffe im Rahmen von Ryles Verständnis und die Darstellung seines Argumentationsgangs mittels der sprachanalytischen Methode. Die Arbeit widerlegt die „traditionelle Theorie“ des Geistes und präsentiert Ryles alternative Lösung.
- Ryles Kritik an der „traditionellen Theorie“ des Geistes (die „offizielle Doktrin“).
- Die Unterscheidung zwischen „knowing how“ und „knowing that“.
- Ryles Konzept der Disposition als zentrales Element des „knowing how“.
- Die Rolle von Gewohnheit und Intelligenz im Verständnis von Handlungsfähigkeit.
- Analyse von Ryles Argumentation mittels der sprachanalytischen Methode.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „knowing how“ und „knowing that“ in Ryles Philosophie ein und beschreibt die Ziele der Arbeit: Erläuterung der Begriffe im Kontext intelligenten Handelns und Darstellung von Ryles Argumentation. Sie skizziert die Auseinandersetzung mit der „traditionellen Theorie“ des Geistes, die als „offizielle Doktrin“ bezeichnet wird, und deren Widerlegung als Grundlage für Ryles alternative Lösung. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und kündigt die Analyse von Ryles Argumentationsschritten an.
2 Hauptteil: 2.1 Einleitung: Ryles Mythos vom Gespenst in der Maschine: Dieser Abschnitt beginnt mit Ryles Zielsetzung, die „logische Geographie“ der Begriffe zur Beschreibung des Geistes zu berichtigen. Ryle kritisiert den falschen Gebrauch von Begriffen für geistige und körperliche Vorgänge, der auf einer „Kategorienverwechslung“ beruht. Er erläutert den Begriff des Kategorienfehlers anhand eines Beispiels mit einem Fußballspiel und wendet dieses Konzept auf die „offizielle Lehre“ an, die mentale Ausdrücke auf geistige Ereignisse bezieht, die wiederum das Verhalten verursachen. Ryles Kritik richtet sich gegen die Substanzdualisten Platon und Descartes, die Geist und Materie trennen, aber dennoch Begriffe aus denselben Kategorien verwenden. Der Abschnitt gipfelt in Ryles Metapher vom „Gespenst in der Maschine“, die die falsche Vorstellung der traditionellen Lehre von einem Geist, der im Körper wohnt, verdeutlicht. Er kritisiert Descartes' Argumentation, die aufgrund der Fähigkeit des Menschen zu sprechen und intelligent zu handeln, auf eine nicht-physische Seele schließt, als weitere Kategorienverwechslung.
Schlüsselwörter
Knowing how, Knowing that, Gilbert Ryle, Sprachanalyse, Philosophie des Geistes, Intellektualistische Legende, Kategorienfehler, Disposition, Gewohnheit, Intelligenz, Substanzdualismus, Offizielle Doktrin, Traditionelle Theorie.
Häufig gestellte Fragen zu: Ryles Sprachanalytische Philosophie des Geistes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gilbert Ryles sprachanalytische Philosophie des Geistes, insbesondere seine Konzepte von „knowing how“ und „knowing that“ im Kontext intelligenten Handelns. Sie untersucht Ryles Kritik an der „traditionellen Theorie“ des Geistes und präsentiert seine alternative Lösung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit erläutert die Begriffe „knowing how“ und „knowing that“ im Rahmen von Ryles Verständnis und stellt seinen Argumentationsgang mittels der sprachanalytischen Methode dar. Sie widerlegt die „traditionelle Theorie“ des Geistes und präsentiert Ryles alternative Lösung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Ryles Kritik an der „traditionellen Theorie“ des Geistes (die „offizielle Doktrin“); die Unterscheidung zwischen „knowing how“ und „knowing that“; Ryles Konzept der Disposition als zentrales Element des „knowing how“; die Rolle von Gewohnheit und Intelligenz im Verständnis von Handlungsfähigkeit; und die Analyse von Ryles Argumentation mittels der sprachanalytischen Methode.
Was ist Ryles Kritik an der „traditionellen Theorie“ des Geistes?
Ryle kritisiert die „traditionelle Theorie“ des Geistes (die „offizielle Doktrin“) als Kategorienfehler. Er argumentiert, dass diese Theorie mentale Ausdrücke auf geistige Ereignisse bezieht, die wiederum das Verhalten verursachen, was einer falschen logischen Geographie der Begriffe entspricht. Seine Metapher vom „Gespenst in der Maschine“ verdeutlicht die fehlerhafte Vorstellung eines Geistes, der im Körper wohnt.
Was sind „knowing how“ und „knowing that“ nach Ryle?
Die Arbeit erläutert diese zentralen Konzepte Ryles im Detail, wobei „knowing how“ mit dem Konzept der Disposition und der Rolle von Gewohnheit und Intelligenz im Kontext von Handlungsfähigkeit verbunden ist. Der Unterschied zu „knowing that“ wird im Kontext der sprachanalytischen Methode untersucht.
Welche Rolle spielt die sprachanalytische Methode in Ryles Argumentation?
Die sprachanalytische Methode ist zentral für Ryles Argumentation. Die Arbeit analysiert Ryles Argumentationsschritte und zeigt, wie er durch die genaue Analyse der Sprache zu seinen Schlussfolgerungen gelangt und die „traditionelle Theorie“ widerlegt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil (mit Unterkapiteln zu Ryles Kritik, seinen zentralen Begriffen und seiner Argumentation) und einer Zusammenfassung/einem Ausblick. Der Hauptteil beginnt mit Ryles Kritik an der "offiziellen Doktrin" und führt dann detailliert in seine alternative Lösung ein.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Knowing how, Knowing that, Gilbert Ryle, Sprachanalyse, Philosophie des Geistes, Intellektualistische Legende, Kategorienfehler, Disposition, Gewohnheit, Intelligenz, Substanzdualismus, Offizielle Doktrin, Traditionelle Theorie.
- Citar trabajo
- Bita Mohammadi (Autor), 2001, Knowing how and knowing that in Gilbert Ryles sprachanalytischen Philosophie des Geistes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2383