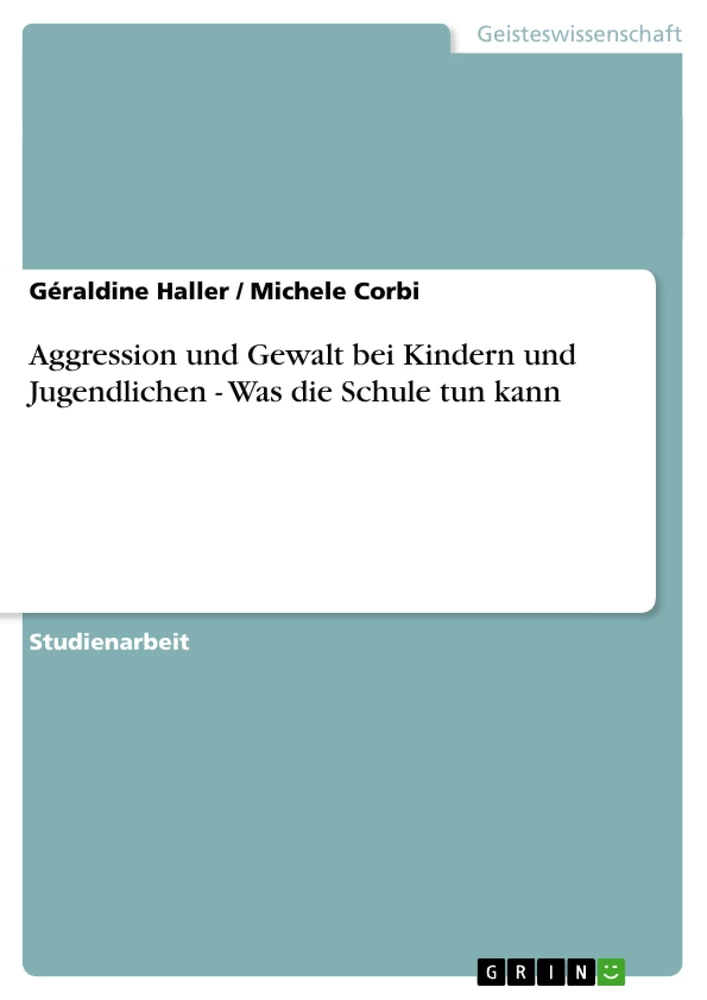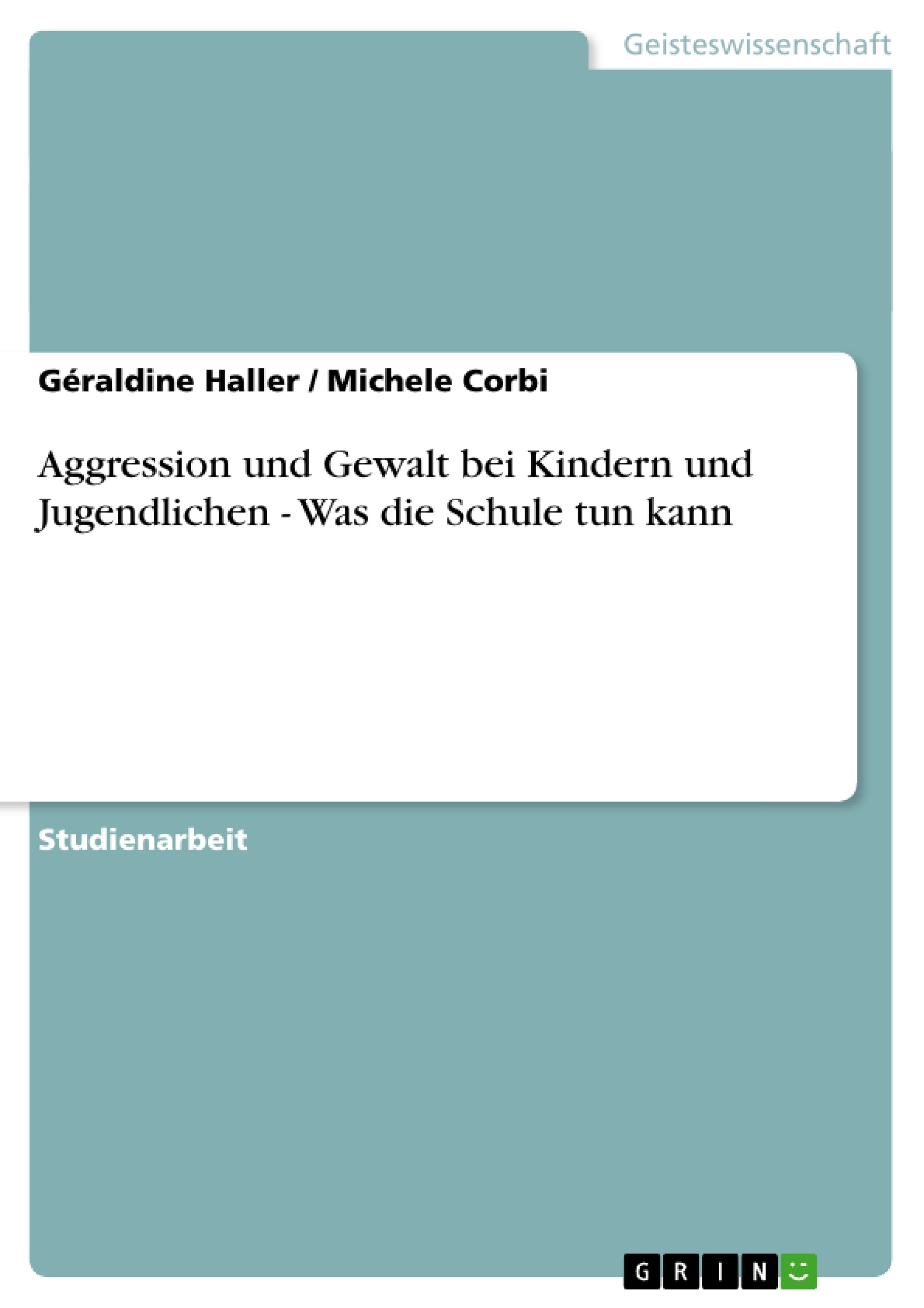„Zwei Jahre lang war Johnny, ein stiller 13jähriger, für einige seiner Klassenkameraden ein menschliches Spielzeug. Die Teenager setzten Johnny zu, um an sein Geld zu kommen, sie zwangen ihn, Unkraut zu schlucken und Milch, die mit Waschmittel vermengt war, zu trinken. Sie verprügelten ihn in den Toiletten und legten ihm einen Strick um den Hals, mit dem sie ihn wie ein «Tier an der Leine» herumführten.“ (Olweus, 1996, S.21)
Mit derartigen, oft aber auch subtileren Manifestationen aggressiven Verhaltens werden Lehrer im Schulalltag immer wieder konfrontiert. In unserer dreijährigen Lehrerausbildung in Luxemburg wurde die Problematik „Gewalt an Schulen“ nicht ausreichend thematisiert. Da dieses Thema aber in letzter Zeit immer mehr ins öffentliche Interesse gerückt ist und weil wir den Eindruck haben, dass wir in diesem Bereich eine regelrechte Wissenslücke haben, ist es unser Anliegen, uns durch diese Hausarbeit einen Gesamtüberblick über die Thematik zu verschaffen, selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Die vorliegende Arbeit zeigt die theoretischen Erklärungsansätze für Aggression bzw. die verschiedenen Formen von Gewalt auf, fasst den Forschungsstand psychologischer Aggressions- und Gewaltforschung zusammen und beinhaltet wirksame, im schulischen Kontext einfach realisierbare Ansatzpunkte und Handlungsmöglichkeiten zur Prävention, Intervention und Kontrolle schulischer Gewalt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zur begrifflichen Bestimmung des Gegenstandes
- 2.1 Der Aggressionsbegriff
- 2.2 Der Gewaltbegriff
- 3 Diagnostik und Entwicklungsverlauf
- 3.1 Diagnostische Klassifizierung aggressiven Verhaltens
- 3.2 Entwicklung aggressiven Verhaltens
- 4 Ausdrucksformen von Aggression und Gewalt
- 4.1 Aggressionsarten
- 4.2 Formen menschlicher Aggression
- 4.3 Äußerlich-formale Einteilung
- 4.4 Inhaltlich-motivationale Einteilung
- 5 Klassische psychologische Erklärungsansätze für Aggression und Gewalt
- 5.1 Die Triebtheorien
- 5.1.1 Die dualistische Triebtheorie nach Sigmund Freud
- 5.1.2 Jüngere Triebkonzepte
- 5.1.3 Die ethologische Triebtheorie
- 5.2 Die Frustrations-Aggressions-Hypothese nach Dollard et al.
- 5.3 Das lerntheoretische Modell: Aggression als gelerntes Verhalten
- 5.3.1 Lernen am Modell
- 5.3.2 Lernen am Erfolg bzw. Misserfolg
- 5.3.3 Kognitives Lernen
- 5.1 Die Triebtheorien
- 6 Bedingungen von Gewalt und Aggression
- 6.1 Außerschulische Einflussfaktoren auf das Gewaltniveau
- 6.2 Innerschulische Einflussfaktoren auf das Gewaltniveau
- 7 Gewalt an Schulen
- 8 Präventions- und Interventionsmöglichkeiten der Schule
- 8.1 Verminderung aggressiven Verhaltens nach Nolting
- 8.1.1 'Aggressionen abreagieren'-geht das?
- 8.1.2 Die Anreger verändern
- 8.1.3 Die Anreger anders bewerten
- 8.1.4 Aggressionshemmungen fördern
- 8.1.5 Alternatives Verhalten lernen
- 8.2 Der Präventionsrat
- 8.3 Das Interventionsprogramm „Was wir gegen Gewalt tun können“ nach Olweus
- 8.3.1 Maßnahmen auf der Schulebene
- 8.3.2 Maßnahmen auf der Klassenebene
- 8.3.3 Maßnahmen auf der persönlichen Ebene
- 8.4 Mediation oder Streitschlichtung
- 8.4.1 Was ist Mediation und wie funktioniert sie?
- 8.4.2 Bedingungen des Mediationsverfahrens
- 8.4.3 Schritte des Mediationsverfahrens
- 8.4.3.1 Vorphase
- 8.4.3.2 Das Mediationsgespräch
- 8.4.3.3 Umsetzungsphase
- 8.4.4 Die Rolle des Mediators
- 8.4.5 Grundlegende Methoden der Mediation
- 8.5 Weitere Präventions- und Interventionsmodelle/-konzepte
- 8.6 Zusammenfassung der Vorschläge zur Gewaltprävention und —intervention
- 8.1 Verminderung aggressiven Verhaltens nach Nolting
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit hat zum Ziel, einen umfassenden Überblick über Aggression und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext zu geben. Sie beleuchtet verschiedene theoretische Erklärungsansätze, fasst den aktuellen Forschungsstand zusammen und präsentiert praktikable Präventions- und Interventionsmöglichkeiten für Schulen.
- Begriffliche Abgrenzung von Aggression und Gewalt
- Psychologische Erklärungsansätze für aggressives Verhalten
- Einflussfaktoren auf das Gewaltniveau (außerschulisch und innerschulisch)
- Präventions- und Interventionsstrategien im schulischen Kontext
- Bewertung verschiedener Interventionsmodelle (z.B. Olweus-Programm, Mediation)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit, motiviert durch die unzureichende Behandlung des Themas Gewaltprävention in der Lehrerausbildung der Autorinnen. Sie skizziert den Umfang der Arbeit, der sich auf theoretische Erklärungsansätze, den Forschungsstand und praktikable Maßnahmen zur Prävention und Intervention konzentriert. Der Fall von Johnny, der von Mitschülern gemobbt wurde, verdeutlicht die Dramatik des Themas und die Notwendigkeit umfassender Maßnahmen.
2 Zur begrifflichen Bestimmung des Gegenstandes: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung der Begriffe Aggression und Gewalt. Es werden unterschiedliche, teils engere und teils weitere Definitionen aus der Fachliteratur vorgestellt und diskutiert. Der Fokus liegt auf der Klärung der terminologischen Unterschiede, um eine präzise Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Die Diskussion der verschiedenen Definitionen verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer klaren begrifflichen Grundlage für die Analyse von aggressivem Verhalten.
3 Diagnostik und Entwicklungsverlauf: Dieses Kapitel befasst sich mit der diagnostischen Klassifizierung aggressiven Verhaltens und dessen Entwicklungsverlauf. Es werden verschiedene Methoden der Diagnose und die typischen Entwicklungsmuster aggressiven Verhaltens dargestellt. Die Zusammenhänge zwischen den diagnostischen Kategorien und den Entwicklungsphasen werden erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Entwicklung von Aggression und den damit verbundenen Herausforderungen für die Prävention und Intervention.
4 Ausdrucksformen von Aggression und Gewalt: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ausdrucksformen von Aggression und Gewalt, klassifiziert nach Art, Form und Motivation. Es werden sowohl physische als auch psychische Formen von Aggression und deren unterschiedliche Manifestationen beschrieben. Der Fokus liegt auf der Vielfältigkeit aggressiven Verhaltens und der Notwendigkeit, diese verschiedenen Ausprägungen in Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu berücksichtigen.
5 Klassische psychologische Erklärungsansätze für Aggression und Gewalt: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene klassische psychologische Theorien, die versuchen, Aggression und Gewalt zu erklären. Es werden Triebtheorien (Freud, ethologische Ansätze), die Frustrations-Aggressions-Hypothese und lerntheoretische Modelle (Lernen am Modell, am Erfolg/Misserfolg, kognitives Lernen) detailliert beschrieben und analysiert. Der Vergleich der verschiedenen Ansätze zeigt die Komplexität der Ursachen von Aggression und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Verständnisses.
6 Bedingungen von Gewalt und Aggression: Das Kapitel untersucht die Bedingungen, unter denen Gewalt und Aggression auftreten. Es differenziert zwischen außerschulischen (z.B. familiäre Situation, soziale Umgebung) und innerschulischen Faktoren (z.B. Schulklima, Lehrerverhalten). Die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren werden analysiert, um ein umfassendes Bild der Entstehungsbedingungen aggressiven Verhaltens zu zeichnen.
7 Gewalt an Schulen: Dieses Kapitel beschreibt das Phänomen von Gewalt an Schulen. Es werden die verschiedenen Formen von Gewalt, deren Ausmaß und die Folgen für die Betroffenen dargestellt. Der Fokus liegt auf der besonderen Bedeutung des schulischen Kontexts für die Entstehung und Bekämpfung von Gewalt.
8 Präventions- und Interventionsmöglichkeiten der Schule: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, die Schulen einsetzen können, um aggressives Verhalten zu reduzieren. Es werden detailliert verschiedene Ansätze beschrieben, darunter die Verminderung aggressiven Verhaltens nach Nolting, der Präventionsrat, das Olweus-Programm und Mediation. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze werden kritisch bewertet. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung der Maßnahmen im schulischen Alltag.
Schlüsselwörter
Aggression, Gewalt, Kinder, Jugendliche, Schule, Prävention, Intervention, Aggressionsforschung, Lerntheorie, Triebtheorien, Frustrations-Aggressions-Hypothese, Mediation, Schulklima, Mobbing, Gewaltpräventionsprogramme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aggression und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über Aggression und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext. Sie behandelt verschiedene theoretische Erklärungsansätze, fasst den aktuellen Forschungsstand zusammen und präsentiert praktikable Präventions- und Interventionsmöglichkeiten für Schulen. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Auseinandersetzung mit begrifflichen Grundlagen, diagnostischen Verfahren, Ausdrucksformen von Aggression und Gewalt, klassischen psychologischen Erklärungsansätzen, Einflussfaktoren auf das Gewaltniveau (außerschulisch und innerschulisch), sowie eine eingehende Betrachtung verschiedener Präventions- und Interventionsstrategien (z.B. Olweus-Programm, Mediation).
Welche Begriffe werden in der Arbeit abgegrenzt?
Die Arbeit beginnt mit einer klaren Abgrenzung der Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“, wobei verschiedene Definitionen aus der Fachliteratur vorgestellt und diskutiert werden. Ziel ist es, eine präzise terminologische Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen.
Welche psychologischen Erklärungsansätze werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene klassische psychologische Erklärungsansätze für Aggression und Gewalt, darunter Triebtheorien (Freud, ethologische Ansätze), die Frustrations-Aggressions-Hypothese und lerntheoretische Modelle (Lernen am Modell, am Erfolg/Misserfolg, kognitives Lernen). Die verschiedenen Ansätze werden detailliert beschrieben und verglichen.
Welche Einflussfaktoren auf Gewalt und Aggression werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert sowohl außerschulische (z.B. familiäre Situation, soziale Umgebung) als auch innerschulische Einflussfaktoren (z.B. Schulklima, Lehrerverhalten) auf das Gewaltniveau und deren Wechselwirkungen.
Welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Präventions- und Interventionsmöglichkeiten für Schulen, darunter die Verminderung aggressiven Verhaltens nach Nolting, den Präventionsrat, das Olweus-Programm und Mediation. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze werden kritisch bewertet und deren praktische Umsetzung im schulischen Alltag beleuchtet. Die Arbeit beschreibt auch die einzelnen Schritte von Mediationsprozessen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Einleitung, der begrifflichen Bestimmung von Aggression und Gewalt, der Diagnostik und dem Entwicklungsverlauf, den Ausdrucksformen von Aggression und Gewalt, klassischen psychologischen Erklärungsansätzen, den Bedingungen von Gewalt und Aggression, Gewalt an Schulen und schließlich den Präventions- und Interventionsmöglichkeiten befassen. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aggression, Gewalt, Kinder, Jugendliche, Schule, Prävention, Intervention, Aggressionsforschung, Lerntheorie, Triebtheorien, Frustrations-Aggressions-Hypothese, Mediation, Schulklima, Mobbing, Gewaltpräventionsprogramme.
- Quote paper
- Géraldine Haller (Author), Michele Corbi (Author), 2003, Aggression und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen - Was die Schule tun kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23665