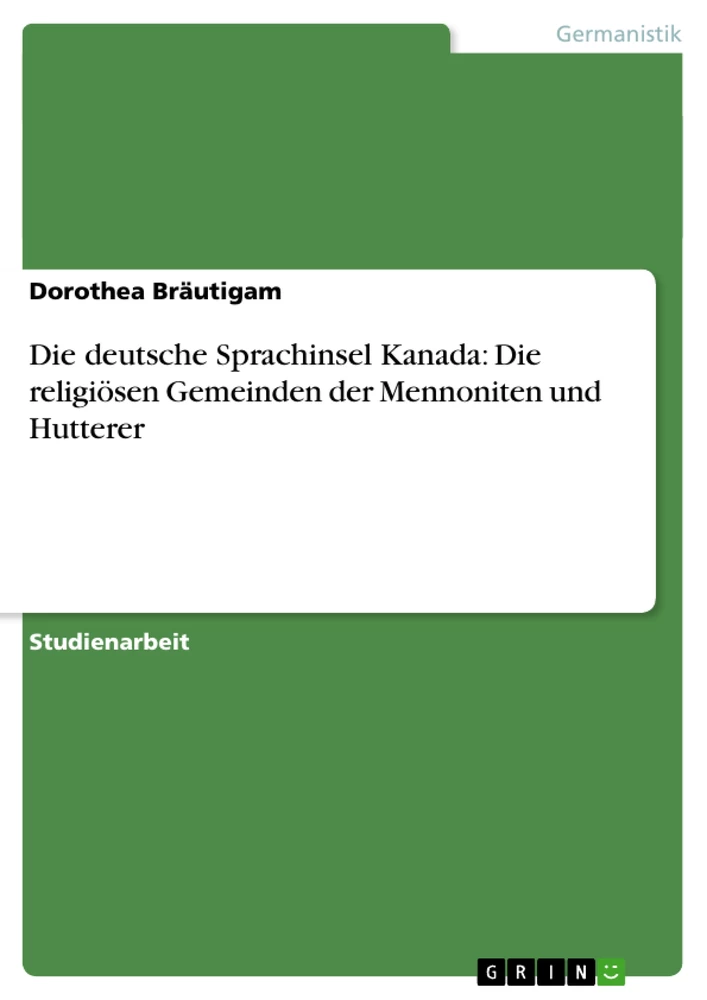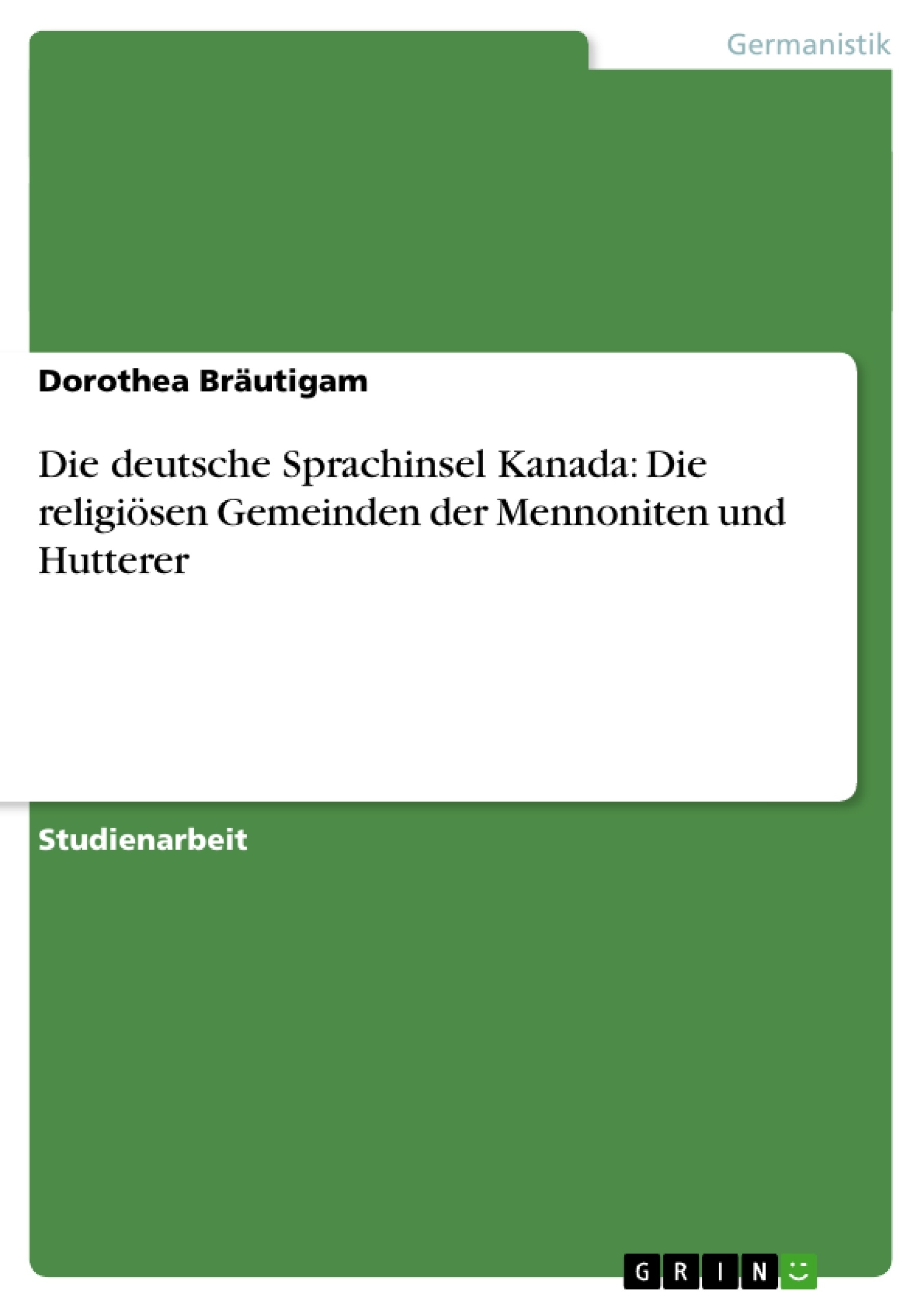Die vorliegende Untersuchung über die deutsche Sprachinsel Kanada mit Hauptaugenmerk auf den religiösen Gemeinden der Mennoniten und Hutterer ist als zweiteilige Arbeit angelegt. Im Teil A wird ein kurzer allgemeiner Überblick über Kanada als Sprachinsel vermittelt und diskutiert; Teil B beschäftigt sich speziell mit den in Kanada lebenden Mennoniten und Hutterern. Diese Zweiteilung der Arbeit schien notwendig, um den gesellschaftlichen und politischen Rahmen für Teil B abzustecken, aber auch um unter den allgemeinen Tendenzen im Land die Sonderstellung der Wiedertäufergruppen hervorzuheben. Im Hauptteil – Teil B- geht den Beschreibungen und Analysen der Sprache ( Kap. 4. / 5.) eine sozio-kulturelle Untersuchung voraus (Kap. 1./ 3.); z. T. fällt diese recht detailliert und umfassend aus (z.B. extensiver Demographiebegriff), was sich jedoch unter den Umständen relativiert, daß insbesondere bei geringer Vertrautheit mit anabaptistischen Gruppen diverse syn- und diachrone Sprachphänomene in einem weiter abgesteckten kulturellen Kontext leichter verstanden werden können. In den letztgenannten beiden Kapiteln wurde um der Vermittlung eines zusammenhängenden Bildes des komplexen mennonitischen bzw. hutterischen Kulturkreises Willen einer seriellen Darstellung gegenüber einer parallelen Abhandlung einzelner Aspekte und Bereiche der religiösen Gemeinschaften unbedingt Vorrang gegeben. Kapitel 4. und 5. befassen sich schließlich mit sprachwissenschaftlichen Untersuchungen sensu stricto. Für die Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation der Sprachinsel (Kap. 5.) erwies sich neben einer parallelen, z.T. kontrastiven Abhandlung der Mennoniten und Hutterer das Domänenkonzept als besonders hilfreich: Denn dies erlaubte eine übersichtliche Erschließung der Thematik auch bei der Lückenhaftigkeit des Informationsmaterials. Durch die von jeweils einer Domäne ausgehenden Beschreibung und Aufschlüsselung der sprachlichen Situation (in diesem Sinne deduktiv) kann die Darstellung des jeweiligen Bereiches leicht nachgeprüft werden; die Untersuchungen erlangen somit potentiell einen zusätzlichen Grad an Exaktheit und Wissenschaftlichkeit. Ein weiterer Vorzug liegt darin, daß es sich um ein offenes / ausbaufähiges (Puzzle-)Konzept handelt; je mehr Domänen betrachtet werden, desto besser kann sich ein Verständnis über die Thematik aufbauen (in diesem Sinne induktiv). Allerdings wird durch die Anwendung dieses künstlichen und vereinfachenden Domänenkonzeptes kaum oder nicht deutlich, daß die Domänen keine starren Bereiche sind, sondern daß eine Vielzahl an Verbindungen / Überlappungen zwischen ihnen existiert. Die Quellen sind entsprechend der im Text verwendeten Nummern fortlaufend im Quellenverzeichnis aufgelistet. Diese Verfahrensweise mag ungewöhnlich erscheinen, erwies sich jedoch aufgrund des hohen Anteils an Material aus dem Internet als günstigere Variante als die Verwendung von Fußnoten und alphabetischer Quellenangabe im Literaturkorpus. Anmerkungen, die sich nicht unmittelbar auf eine Quelle beziehen, werden dagegen mit Sternchen gekennzeichnet und als Fußnote erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Teil A: Kanada allgemein
- 1. Demographie
- 2. Aktuelle Situation der Sprachinsel
- 2.1. Die geringe Homogenität der Deutschen
- 2.2. Die starke Dominanz der englischen Sprache
- 2.3. Die Geschichte und Geschichtsbefindlichkeit der Deutschen
- 2.4. Das Ausbleiben größerer Einwanderungswellen
- 2.5. Das Multikulturalismus-Konzept
- 2.6. Die zunehmende Säkularisierung
- 3. Diskussion
- Teil B: Mennoniten und Hutterer
- 1. Geographische und demographische Beschreibung
- 1.1. Mennoniten
- 1.1.1. Bevölkerungszahl und Verteilung
- 1.1.2. Glaube und Glaubensgrundsätze
- 1.1.3. Organisation
- 1.1.4. Einkommen, Verstädterung, Wertewandel
- 1.2. Hutterer
- 1.2.1. Bevölkerungszahl und Verteilung
- 1.2.2. Glaube, Tradition, Weltbild
- 1.2.3. Organisation: der Bruderhof
- 1.2.4. Hutterer und die Moderne
- 1.1. Mennoniten
- 2. Quellen und Wertung der Forschungslage
- 2.1. Forschungsliteratur
- 2.2. Internet
- 2.3. Weitere Bemerkungen
- 3. Geschichte der Sprachinsel
- 3.1. Allgemeines
- 3.2. Migration der Mennoniten
- 3.3. Migration der Hutterer
- 4. Sprachzustand in Vergangenheit und Gegenwart
- 4.1. Der Wert der Deutschen Sprache
- 4.2. Einflußfaktoren auf Sprachzustand und Sprache
- 4.2.1. ideologische Ausrichtung
- 4.2.2. Geographische Dimension: Ursprungsgebiet, Migration
- 4.2.3. Zeitliche Dimension: Aus- und Ansiedlung
- 4.2.4. Politik des Einwanderungslandes
- 4.2.5. Anzahl der Einwanderer
- 4.2.6. Soziale und ökonomische Situation
- 4.3. Sprache und Sprachzustand: Mennoniten
- 4.3.1. Allgemeines
- 4.3.2. Mundarten
- 4.3.2.1. Pennsylvanisch
- 4.3.2.2. Mennonitenplattdeutsch
- 4.3.3. Hochdeutsch
- 4.3.4. Beispiele für einige Provinzen
- 4.3.4.1. Ontario
- 4.3.4.2. British Columbia
- 4.3.4.3. Manitoba
- 4.4. Sprache und Sprachzustand: Hutterer
- 4.4.1. Allgemeines
- 4.4.2. Hutterisch
- 4.4.3. Hochdeutsch
- 5. Aktuelle Situation der Sprachinsel, Domänenkonzept
- 5.1. Ausbildung: Schule und weiterführende Bildung
- 5.1.1. Mennoniten
- 5.1.2. Hutterer
- 5.2. Religion und Kirche
- 5.2.1. Mennoniten
- 5.2.2. Hutterer
- 5.3. Mediale Kommunikation
- 5.3.1. Mennoniten
- 5.3.2. Hutterer
- 5.4. Sprachpflege und Standardisierungsversuche
- 5.4.1. Mennoniten
- 5.4.1.1. Pennsylvaniadeutsch
- 5.4.1.2. Plautdietsch
- 5.4.2. Hutterer
- 5.4.1. Mennoniten
- 5.5. Moderne Literatur
- 5.5.1. Mennoniten
- 5.5.2. Hutterer
- 5.1. Ausbildung: Schule und weiterführende Bildung
- Fazit
- 1. Geographische und demographische Beschreibung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Sprachinsel in Kanada, mit besonderem Fokus auf die Mennoniten und Hutterer. Ziel ist es, die soziokulturellen und sprachlichen Gegebenheiten dieser Gruppen zu beschreiben und zu analysieren, ihre Geschichte der Migration nach Kanada zu beleuchten und den Einfluss verschiedener Faktoren auf den Erhalt und Wandel der deutschen Sprache zu untersuchen.
- Soziokulturelle Strukturen der Mennoniten und Hutterer in Kanada
- Migrationsgeschichte und -motive der beiden Gruppen
- Sprachliche Situation: Erhalt und Wandel des Deutschen
- Einflussfaktoren auf den Sprachgebrauch (Religion, Medien, Politik)
- Vergleichende Analyse von Mennoniten und Hutterern
Zusammenfassung der Kapitel
Teil A: Kanada allgemein: Dieser Teil bietet einen kurzen Überblick über die allgemeine Situation deutschstämmiger Menschen in Kanada. Er beleuchtet die demografischen Daten, den geringen Anteil an Deutschsprechern im täglichen Leben und die Gründe für die schnelle Integration der meisten deutschstämmigen Einwanderer in die kanadische Gesellschaft. Die geringe Homogenität der deutschstämmigen Bevölkerung und die geographische Streuung werden als Schlüsselfaktoren für die Assimilation hervorgehoben. Der Teil bereitet den Boden für die detailliertere Betrachtung der Mennoniten und Hutterer in Teil B, indem er den allgemeinen Kontext der Sprachinsel Kanada darstellt und den Kontrast zu den stärker abgeschlossenen Gemeinschaften der Wiedertäufergruppen aufzeigt.
Teil B: Mennoniten und Hutterer: Dieser Teil konzentriert sich auf die spezifischen soziokulturellen und sprachlichen Aspekte der Mennoniten und Hutterer in Kanada. Er beginnt mit einer geographischen und demografischen Beschreibung beider Gruppen, inklusive ihrer Glaubensgrundsätze und Organisationsstrukturen. Die Forschungsliteratur und verfügbaren Quellen werden bewertet, gefolgt von einer detaillierten Darstellung der Migrationsgeschichte beider Gruppen nach Kanada. Der Schwerpunkt liegt auf einer umfassenden Analyse des Sprachzustandes in Vergangenheit und Gegenwart, einschließlich der verschiedenen Dialekte (z.B. Pennsylvanisch-Deutsch, Plautdietsch, Hutterisch) und dem Gebrauch von Hochdeutsch. Die Kapitel untersuchen den Einfluss verschiedener Faktoren auf den Sprachgebrauch und bieten einen Vergleich zwischen den beiden Gruppen.
Schlüsselwörter
Deutsche Sprachinsel, Kanada, Mennoniten, Hutterer, Migration, Sprachwandel, Sprachinseleffekte, Religiöse Gemeinschaften, Anabaptisten, Dialekte (Pennsylvanisch-Deutsch, Plautdietsch, Hutterisch), Assimilation, Integration, Multikulturalismus, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur deutschen Sprachinsel in Kanada: Mennoniten und Hutterer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die deutsche Sprachinsel in Kanada, mit besonderem Fokus auf die Mennoniten und Hutterer. Sie analysiert die soziokulturellen und sprachlichen Gegebenheiten dieser Gruppen, beleuchtet ihre Migrationsgeschichte nach Kanada und untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf den Erhalt und Wandel der deutschen Sprache.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt soziokulturelle Strukturen der Mennoniten und Hutterer, ihre Migrationsgeschichte und -motive, die sprachliche Situation (Erhalt und Wandel des Deutschen), Einflussfaktoren auf den Sprachgebrauch (Religion, Medien, Politik) und bietet eine vergleichende Analyse beider Gruppen. Es werden verschiedene Dialekte (Pennsylvanisch-Deutsch, Plautdietsch, Hutterisch) und der Gebrauch von Hochdeutsch untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Teil A gibt einen Überblick über die allgemeine Situation deutschstämmiger Menschen in Kanada, Teil B konzentriert sich auf die Mennoniten und Hutterer. Innerhalb von Teil B werden geographische und demografische Beschreibungen, die Forschungslage, die Migrationsgeschichte, der Sprachzustand in Vergangenheit und Gegenwart und die aktuelle Situation der Sprachinsel (inkl. Bildung, Religion, Medien, Sprachpflege und Literatur) behandelt.
Welche Gruppen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Mennoniten und Hutterer, zwei Gruppen deutschsprachiger Einwanderer in Kanada, die sich durch ihre religiösen und kulturellen Besonderheiten auszeichnen und eine vergleichsweise starke sprachliche Kontinuität bewahrt haben.
Welche Faktoren beeinflussen den Sprachgebrauch der Mennoniten und Hutterer?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf den Sprachgebrauch, darunter religiöse Überzeugungen, die Rolle der Medien, politische Einflüsse, die geographische Verteilung und die sozioökonomische Situation der Gruppen. Die ideologische Ausrichtung, die Migrationsgeschichte und die Politik des Einwanderungslandes spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Welche Sprachen und Dialekte werden angesprochen?
Die Arbeit behandelt neben Hochdeutsch verschiedene Dialekte wie Pennsylvanisch-Deutsch, Plautdietsch und Hutterisch. Es wird untersucht, wie diese Dialekte gepflegt werden und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Forschungsliteratur, Internetquellen und weitere relevante Materialien, die im Kapitel "Quellen und Wertung der Forschungslage" detailliert beschrieben werden.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der deutschen Sprache innerhalb der Mennoniten- und Hutterer-Gemeinschaften in Kanada. Es werden die Herausforderungen und Chancen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der deutschen Sprache in diesem Kontext beleuchtet.
- Citar trabajo
- Dorothea Bräutigam (Autor), 2003, Die deutsche Sprachinsel Kanada: Die religiösen Gemeinden der Mennoniten und Hutterer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23496