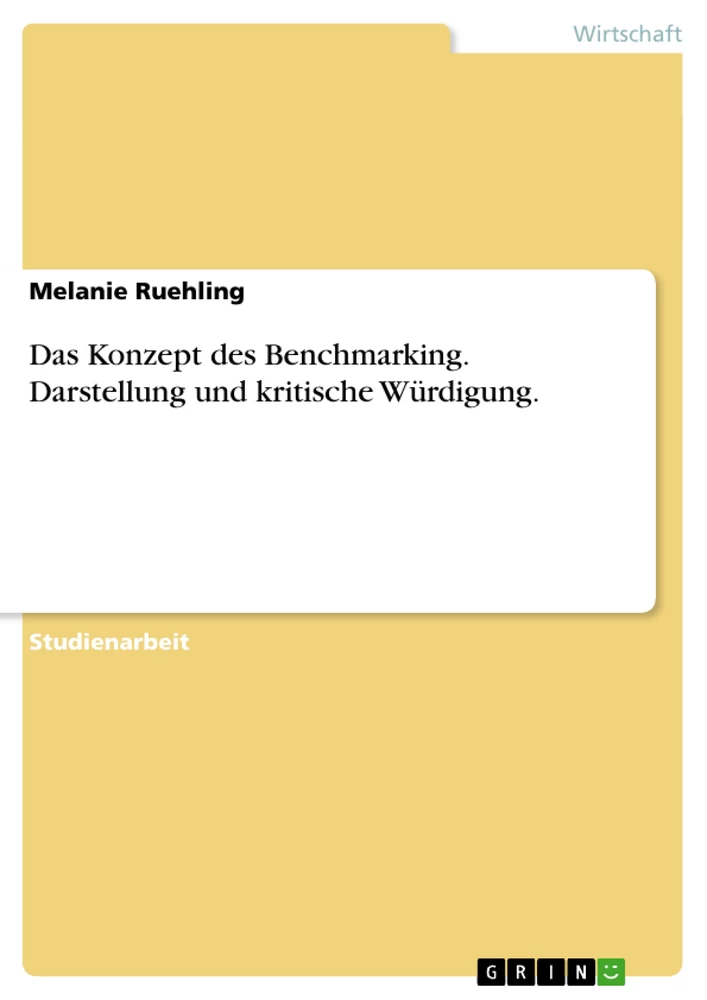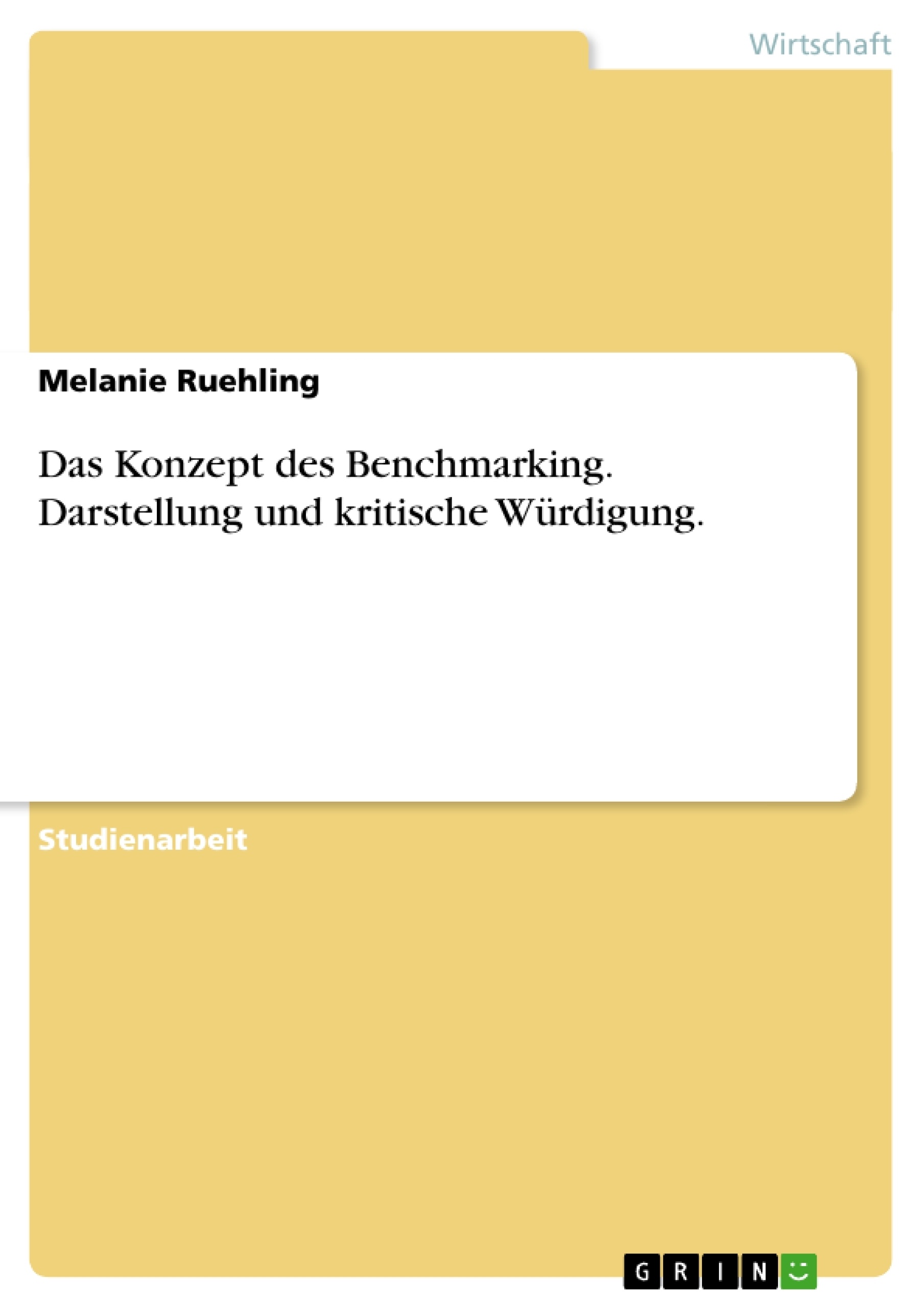1. Einleitung und Gang der Untersuchung
„Nur ein Idiot glaubt, aus den Erfahrungen zu lernen. Ich ziehe es vor, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um von vornherein eigene Fehler zu vermeiden.“ Otto von Bismarck In Zeiten eines immer härter werdenden Wettbewerbumfeldes ist dieses Zitat von Bismarck aktuell wie nie zuvor, denn muss man sich kontinuierlich mit den weltweit Besten, den „Besten der Besten“, vergleichen und von diesen lernen, um den langfristigen Erfolg und die Überlebensfähigkeit zu sichern. Unternehmen sehen sich einem immer größer werdenden Konkurrenzdruck ausgesetzt. Ausgelöst durch Globalisierung und Fusionen unterstützt von neuen Medien, wie dem Internet, müssen Unternehmen schneller und ziel-gerichteter Kundenwünsche am Markt befriedigen. Immer höhere Qualität zu gleich bleibenden Preisen wird verlangt. Länder wie Japan sind seit langen bekannt dafür, dass sie sich Produktinformationen von ihren Mitbewerbern beschaffen und benutzen, um die Schwächen ihrer Konkurrenten in Europa und Amerika herauszufinden und folglich Fehler bei eigenen Produkten zu vermeiden. Dies ist auch ein Grund, warum japanische Firmen so erfolgreich in der Automobilindustrie und in der Unterhaltungselektronik sind. Das Japanische Wort dantotsu bedeutet „Das Bemühen der Beste der Besten zu sein“ und beschreibt sehr gut den Prozess, mit dem in Japan Wettbewerbsvorteile erarbeitet werden.1 Einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen und zu behalten ist der Schlüssel des Erfolges auf allen Wegen des Lebens sei es im Sport als auch im Geschäftsleben. Das Instrument Benchmarking soll die Unternehmen bei der Erfüllung dieser Anforderungen entscheidend unterstützen. Dabei ist es kein konkurrierendes Instrument, sondern vereint vorhandene Instrumente, und zeigt neue Sichtweisen auf. In führenden Unternehmen erweist sich Benchmarking als Hilfsmittel zur Informationssammlung. Diese werden benötigt, um ständig besser zu werden und der Konkurrenz ein Schritt voraus zu sein.2 In dieser Arbeit soll das Konzept des Benchmarking kritisch dargestellt werden. Dabei wird im ersten Teil auf die Grundlagen des Benchmarking näher eingegangen. Nachfolgend werden die Elemente des Benchmarking erläutert und anschließend wird der Bench-marking-Prozess nach Camp dargestellt und am praktischen Beispiel veranschaulicht. Abschließend werden Vor- und Nachteile des Benchmarking gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Gang der Untersuchung
- 2. Grundlagen des Benchmarking
- 2.1. Entstehung und Verbreitung des Benchmarking-Konzeptes
- 2.2. Benchmarking-Definitionen und Einordnung des Konzeptes
- 2.3. Ziele und Voraussetzungen
- 3. Basiselemente des Benchmarking
- 3.1. Benchmarkingobjekte
- 3.2. Bewertungs- und Vergleichskriterien
- 3.3. Typen des Benchmarking
- 3.3.1. Internes Benchmarking
- 3.3.2. Externes Benchmarking
- 3.3.2.1. Wettbewerbsorientiertes Benchmarking
- 3.3.2.2. Funktionales Benchmarking
- 4. Der Benchmarking – Prozess nach Robert C. Camp
- 4.1. Die Planungsphase
- 4.2. Die Analysephase
- 4.3. Die Integrationsphase
- 4.4. Die Aktionsphase
- 4.5. Die Reifephase
- 5. Kritische Würdigung
- 5.1. Gründe für Benchmarking und Vorteile für Unternehmen
- 5.2. Widerstände und Probleme
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Benchmarking und dessen kritischer Würdigung. Ziel ist es, das Konzept des Benchmarking umfassend darzustellen, seine Grundlagen, Elemente und den Prozess nach Robert C. Camp zu erläutern. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile des Benchmarking analysiert und die Relevanz des Konzepts im Kontext des zunehmenden Wettbewerbsdrucks beleuchtet.
- Entstehung und Verbreitung des Benchmarking-Konzeptes
- Definitionen und Einordnung des Benchmarking-Konzeptes
- Elemente des Benchmarking und deren Anwendung
- Der Benchmarking-Prozess nach Robert C. Camp
- Vorteile und Herausforderungen des Benchmarking für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung und erläutert den Gang der Untersuchung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Grundlagen des Benchmarking, beleuchtet die Entstehung und Verbreitung des Konzepts, definiert es und ordnet es in den Kontext ein. Kapitel 3 beleuchtet die Basiselemente des Benchmarking, darunter Benchmarkingobjekte, Bewertungs- und Vergleichskriterien sowie verschiedene Typen des Benchmarking. Kapitel 4 präsentiert den Benchmarking-Prozess nach Robert C. Camp, mit seinen Phasen der Planung, Analyse, Integration, Aktion und Reife. Kapitel 5 bietet eine kritische Würdigung des Benchmarking, einschließlich der Gründe für dessen Anwendung und der Vorteile für Unternehmen sowie der möglichen Widerstände und Probleme.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Benchmarking, einem wichtigen Instrument im Bereich der Unternehmensführung. Sie beleuchtet die Entstehung und Verbreitung des Konzepts, die Definitionen und Einordnung des Benchmarking-Konzeptes, die Basiselemente, den Benchmarking-Prozess und die kritische Würdigung des Konzepts. Zu den Schlüsselbegriffen zählen unter anderem: Wettbewerbsvorteil, Best-Practice-Verfahren, kontinuierliche Verbesserung, Leistungslücken, Prozessoptimierung, Unternehmenserfolg und Wettbewerbsfähigkeit.
- Quote paper
- Dipl. Betriebswirtin (FH) Melanie Ruehling (Author), 2004, Das Konzept des Benchmarking. Darstellung und kritische Würdigung., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23474