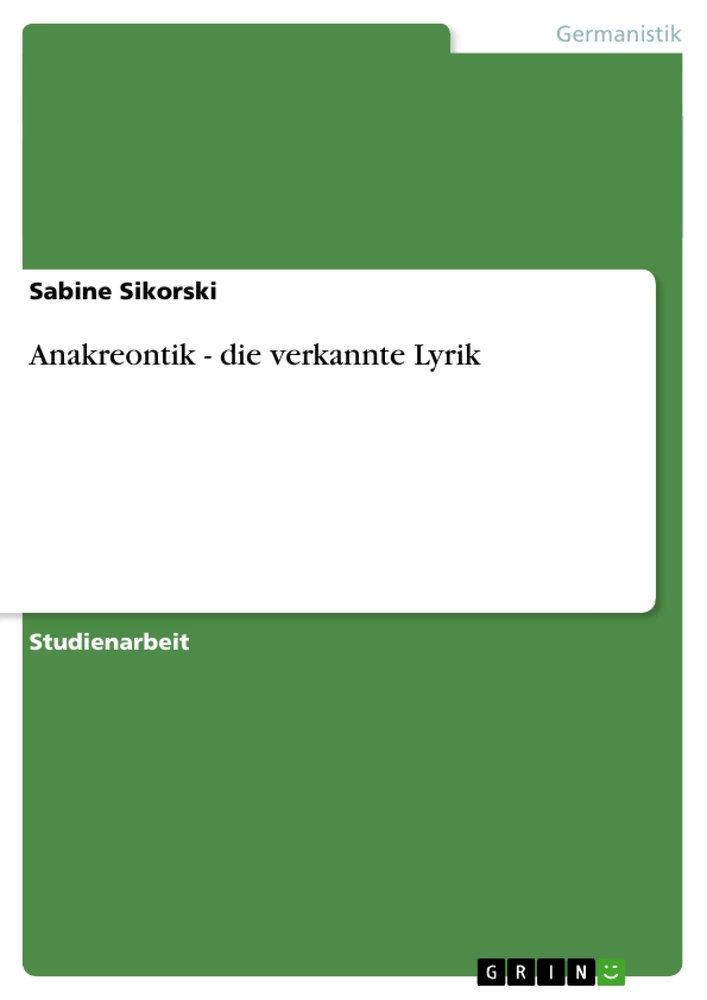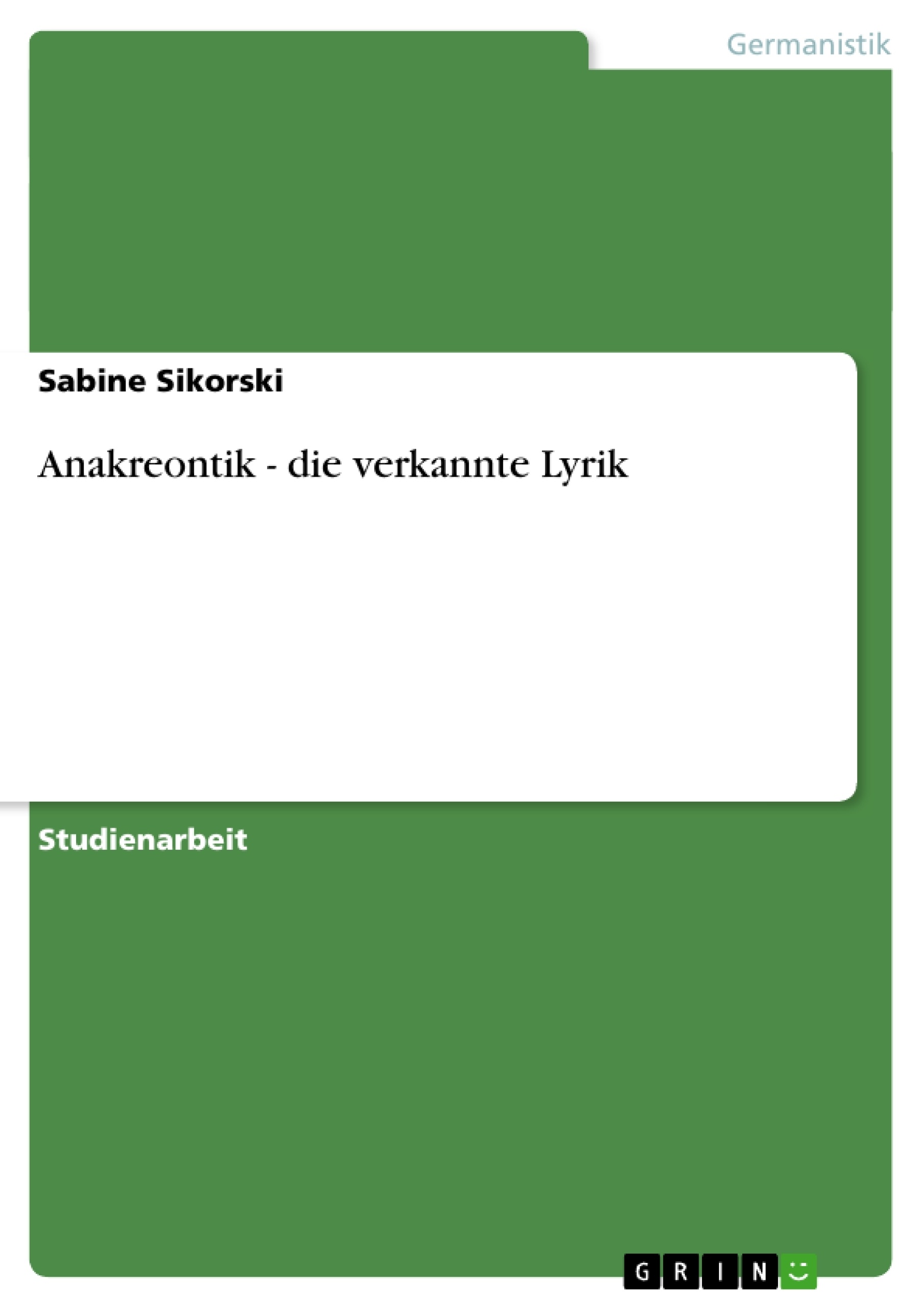Was henker soll ich machen
Daß ich ein Dichter werde?
Gedankenlose Prose,
In ungereimten Zeilen,
(...)
Von Trinken und von Küssen,
Von Küssen und von Trinken,
Und wieder Wein und Mägdchen,
Und wieder Kuß und Trinken,
(...)
Und nichts als Wein und Mägdchen,
Und nichts als Kuß und Trinken,
Und immer so gekindert,
Will ich halbschlafend schreiben,
Das heißen unsre Zeiten
Anakreontisch dichten
Dieser Ausschnitt aus einem Gedicht von Gotthelf Kästner stammt aus dem
Jahr 1755 und stellt die Parodie einer lyrischen Bewegung dar, die im 18.
Jahrhundert großen Anklang fand: Die Anakreontik.
In der folgenden Arbeit soll untersucht werden, was an der anakreontischen
Lyrik dran ist.
Wie kam es, daß bereits Zeitgenossen Parodien über sie schrieben?
Wieso wurde anakreontische Lyrik von der Literaturgeschichtsschreibung bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein als ‚seicht und läppisch’ beschrieben?
Ist die anakreontische Lyrik eine Dichtung, die sich ‚halbschlafend schreiben’
läßt?
Oder handelt es sich um gesellschaftskritische Lyrik?
Oder womöglich um eine Gegenbewegung zum Pietismus?
Ist die Anakreontik eine verkannte Lyrik?
Um diesen Fragen nachzugehen, wird in der folgenden Arbeit zuerst die
Frage geklärt, was Anakreontik ist. Der zweite Schritt wird sein, die
Anakreontik in ihrer literaturhistorischen Einordnung zu sehen, mit einem
Schwerpunkt auf der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Im
dritten Schritt wird untersucht, inwieweit die Anakreontik politisch, sprich
gesellschaftskritisch war, beziehungsweise inwieweit sie eine
Gegenbewegung zum Pietismus darstellt. Im letzten Kapitel werden einige
Gedichte in Hinblick auf die in den ersten Kapiteln vorgestellten Thesen hin
kurz untersucht und interpretiert.
In der Forschungsliteratur werden die Begriffe anakreontische Lyrik und
Rokokolyrik synonym verwendet, was auch in der folgenden Arbeit der Fall
ist.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. DEFINITION ANAKREONTIK
- 2. LITERATURHISTORISCHE EINORDNUNG:
- 2.1 Die Bewertung des deutschen Rokoko in der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts
- 2.1 Die beginnende Anerkennung der Rokokolyrik und ihre Renaissance_
- 3. ANAKREONTIK – EINE POLITISCHE BEWEGUNG?
- 3.1 Anakreontische Lyrik als Gegenbewegung zum Pietismus
- 3.2 Anakreontische Lyrik als Gesellschaftskritik
- 4. GEDICHTINTERPRETATION
- 4.1 Johann Ludwig Gleim: Anakreon
- 4.2 Johann Peter Uz: An Chloen
- 4.3 Christian Felix Weisse: An die Muse
- 5. SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die anakreontische Lyrik des 18. Jahrhunderts und untersucht ihre Bedeutung in der literarischen und gesellschaftlichen Landschaft dieser Zeit.
- Definition und Merkmale der Anakreontik
- Literarische Einordnung der Anakreontik im Kontext des Rokoko
- Politische Dimensionen der Anakreontik, insbesondere im Hinblick auf den Pietismus
- Gesellschaftliche Kritik in der anakreontischen Lyrik
- Interpretation ausgewählter Gedichte von Gleim, Uz und Weisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Anakreontik als eine literarische Bewegung des 18. Jahrhunderts vor, die in ihrer Zeit großen Anklang fand, aber in der Literaturgeschichtsschreibung oft herabgewürdigt wurde. Die Arbeit untersucht die Gründe für diese Diskrepanz und analysiert die vielfältigen Aspekte der anakreontischen Lyrik.
- Definition Anakreontik: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Anakreontik“ und stellt die griechische Lyrik des Anakreon als Vorbild und Inspiration für die Dichter des 18. Jahrhunderts vor.
- Literaturhistorische Einordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rezeption der anakreontischen Lyrik in der Literaturgeschichte. Insbesondere wird die Bewertung der Rokokodichtung im 19. Jahrhundert beleuchtet.
- Anakreontik – Eine politische Bewegung?: Dieses Kapitel untersucht die politische Dimension der Anakreontik. Es werden die Aspekte der Gegenbewegung zum Pietismus und die Rolle der anakreontischen Lyrik als Gesellschaftskritik beleuchtet.
- Gedichtinterpretation: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Gedichte von Johann Ludwig Gleim, Johann Peter Uz und Christian Felix Weisse und untersucht sie im Lichte der zuvor dargestellten Thesen.
Schlüsselwörter
Anakreontik, Rokokolyrik, Pietismus, Gesellschaftskritik, Wein, Liebe, Gesang, Geselligkeit, Gleim, Uz, Weisse.
- Quote paper
- Sabine Sikorski (Author), 2003, Anakreontik - die verkannte Lyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23373