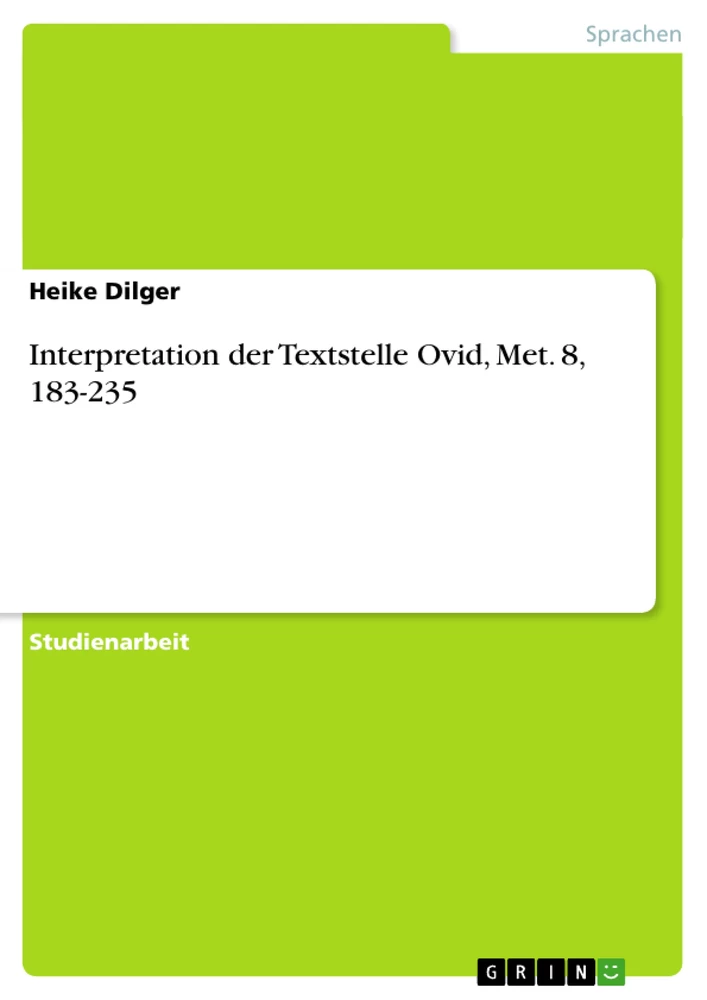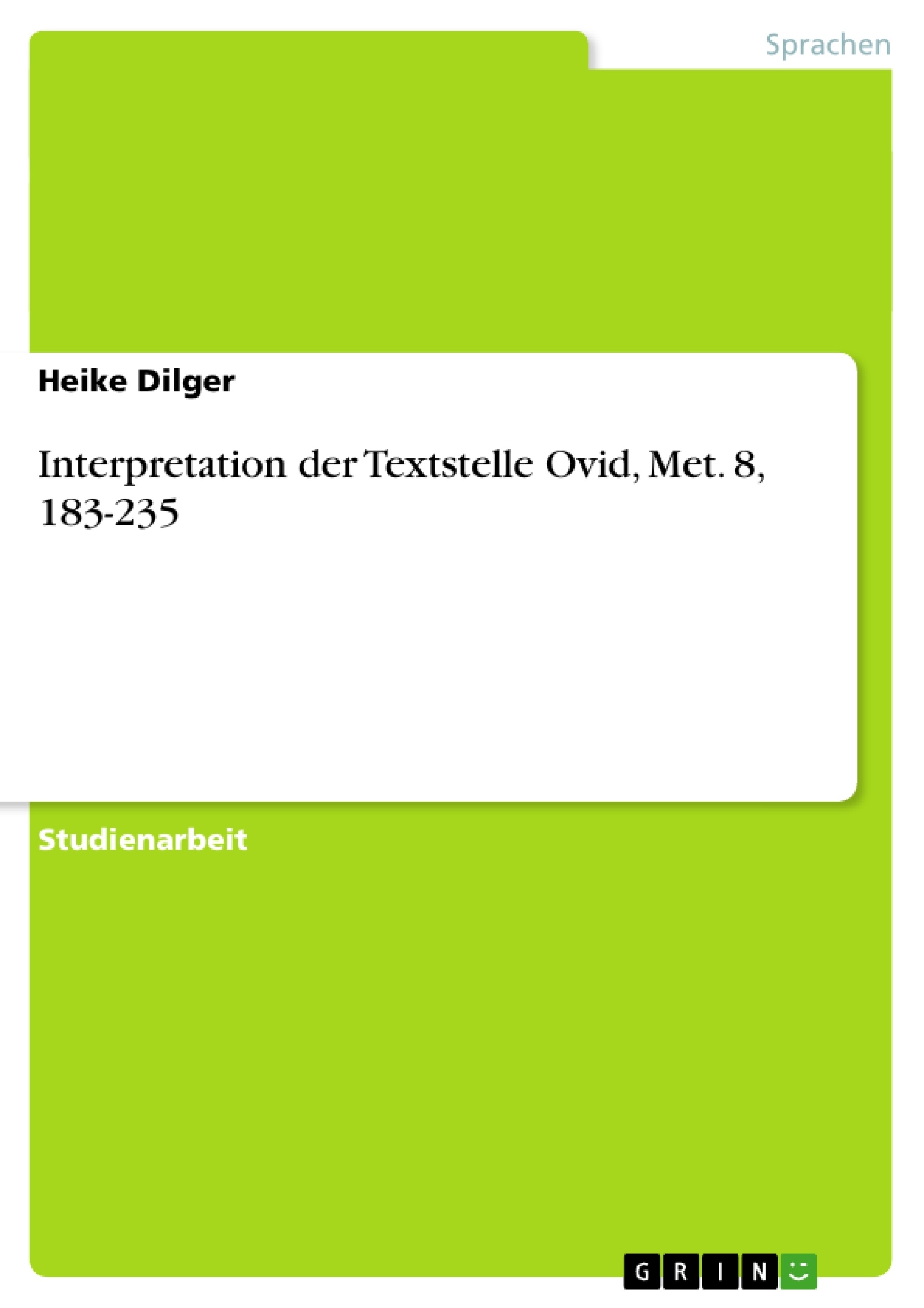Interpretation der Textstelle Ovid, Met. 8, 183-235 (Dädalus und Ikarus)
Beim Übersetzen wendet man meistens eine Mischung der behandelten vier Satz- bzw. Texterschließungsmethoden an, denn ich finde, es gibt keine Sätze, die nur auf eine einzige Methode zugeschnitten sind. Ich persönlich kann mich allerdings mit der Drei- Schritt-Methode von Dieter Lohmann nicht so richtig anfreunden, und beim Übersetzen würde ich am ehesten auf sie verzichten. Denn ich fasse nämlich anders als er das Prädikat nicht als ambivalent auf.
Deshalb rät Lohmann, jedes Satzglied der Reihe nach zu übersetzen, weil so der Verstehensprozess entlang des Satzfadens sichergestellt würde. Die Information, die das Prädikat beinhaltet, erübrigt sich deshalb für Lohmann nahezu, weil der Inhalt des Satzes schon so gut wie klar sei.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1: Beschreiben Sie an einem repräsentativen Textabschnitt (Ovid: ca. 10 Verse) die Vorgehensweisen der behandelten Satz- bzw. Texterschließungsmethoden
- Aufgabe 2: Übersetzen Sie einen repräsentativen Textabschnitt (s.o., Ovid eher ca. 15 Verse; es muss aber nicht derselbe sein), reflektieren Sie dabei die behandelten Gesichtspunkte und kommentieren Sie Ihre Übersetzungsentscheidungen schriftlich.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden der lateinischen Satz- und Texterschließung anhand einer Textstelle aus Ovids Metamorphosen (Dädalus und Ikarus). Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden (Konstruieren und Analysieren, Lineares Decodieren, Dreischritt-Methode, ganzheitliches Erschließen) zu beleuchten und ihre Anwendung in der Übersetzungspraxis zu diskutieren. Die Arbeit vergleicht dabei insbesondere die Dreischritt-Methode von Lohmann mit einer alternativen Vorgehensweise.
- Vergleich verschiedener Methoden der lateinischen Satzanalyse
- Anwendung der Methoden in der Übersetzungspraxis
- Kritik an der Dreischritt-Methode von Lohmann
- Analyse der Syntax und Semantik des Ovid-Textes
- Stilistische Analyse des Ovid-Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabe 1: Beschreiben Sie an einem repräsentativen Textabschnitt (Ovid: ca. 10 Verse) die Vorgehensweisen der behandelten Satz- bzw. Texterschließungsmethoden: Diese Aufgabe analysiert verschiedene Methoden der lateinischen Satzanalyse – Konstruieren und Analysieren, Lineares Decodieren, die Dreischritt-Methode und ganzheitliches Erschließen – und wendet sie auf einen Textabschnitt aus Ovids Metamorphosen an. Die Autorin vergleicht die Methoden kritisch, wobei sie besonders die Dreischritt-Methode von Lohmann als wenig praktikabel für komplexere Satzstrukturen kritisiert. Sie bevorzugt eine Analyse beginnend mit dem Prädikat, da dieses den Dreh- und Angelpunkt des Satzes bildet. Der gewählte Textabschnitt aus Ovid wird hinsichtlich Satzbau und Wortwahl analysiert, um die Anwendbarkeit und Grenzen der verschiedenen Methoden zu demonstrieren. Die Autorin verdeutlicht, dass oft eine Kombination verschiedener Methoden notwendig ist, um einen lateinischen Satz umfassend zu verstehen und zu übersetzen.
Aufgabe 2: Übersetzen Sie einen repräsentativen Textabschnitt (s.o., Ovid eher ca. 15 Verse; es muss aber nicht derselbe sein), reflektieren Sie dabei die behandelten Gesichtspunkte und kommentieren Sie Ihre Übersetzungsentscheidungen schriftlich: In diesem Kapitel präsentiert die Autorin eine Übersetzung eines weiteren Textabschnitts aus Ovids Metamorphosen (Verse 208-216 und 223-230), begleitet von einer detaillierten Kommentierung ihrer Übersetzungsentscheidungen. Sie analysiert die syntaktischen Strukturen, insbesondere den Gebrauch von Partizipien und die Anordnung der Satzglieder, und erläutert, wie diese Strukturen ihre Übersetzungswahl beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Darstellung, wie die gewählten Übersetzungsstrategien die verschiedenen oben beschriebenen Methoden der Satzerschließung reflektieren und wie die Autorin die Herausforderungen der Übersetzung durch Berücksichtigung des Kontextes und der stilistischen Besonderheiten des Originals bewältigt. Die Analyse der Tempora und ihrer Funktion innerhalb des Textabschnitts wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Latein, Ovid, Metamorphosen, Dädalus, Ikarus, Satzanalyse, Texterschließung, Übersetzung, Dreischritt-Methode, Lineares Decodieren, Syntax, Semantik, Textgrammatik, Prädikat, Übersetzungskritik, Stilanalyse, Tempora.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse lateinischer Texte anhand von Ovids Metamorphosen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert verschiedene Methoden der lateinischen Satz- und Texterschließung anhand eines Textabschnitts aus Ovids Metamorphosen (Dädalus und Ikarus). Im Fokus stehen der Vergleich verschiedener Methoden (Konstruieren und Analysieren, Lineares Decodieren, Dreischritt-Methode, ganzheitliches Erschließen), die Anwendung in der Übersetzungspraxis und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dreischritt-Methode von Lohmann.
Welche Methoden der Texterschließung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht und vergleicht die Methoden "Konstruieren und Analysieren", "Lineares Decodieren", die "Dreischritt-Methode" von Lohmann und das "ganzheitliche Erschließen". Der Vergleich beinhaltet eine kritische Bewertung der Effektivität und Anwendbarkeit der einzelnen Methoden, insbesondere im Hinblick auf komplexere Satzstrukturen.
Welche Rolle spielt die Übersetzungspraxis?
Die Übersetzungspraxis spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit demonstriert die Anwendung der verschiedenen Methoden bei der Übersetzung eines Textabschnitts aus Ovids Metamorphosen und diskutiert, wie die gewählten Übersetzungsstrategien die Methoden der Satzerschließung reflektieren. Die Autorin kommentiert ihre Übersetzungsentscheidungen detailliert und analysiert die syntaktischen Strukturen des Originals (z.B. den Gebrauch von Partizipien und die Anordnung der Satzglieder).
Wie wird die Dreischritt-Methode von Lohmann bewertet?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit der Dreischritt-Methode von Lohmann. Die Autorin argumentiert, dass diese Methode für komplexere Satzstrukturen weniger praktikabel ist und bevorzugt eine Analyse beginnend mit dem Prädikat.
Welche Aspekte des Ovid-Textes werden analysiert?
Der Ovid-Text wird hinsichtlich seines Satzbaus, seiner Wortwahl, seiner Syntax, seiner Semantik, seiner Stilistik und der Funktion der Tempora analysiert. Die Analyse dient dazu, die Anwendbarkeit und Grenzen der verschiedenen Methoden der Texterschließung zu demonstrieren.
Welche Aufgaben werden in der Arbeit bearbeitet?
Die Arbeit besteht aus zwei Hauptaufgaben: (1) Die Beschreibung der Vorgehensweisen verschiedener Satz- und Texterschließungsmethoden an einem Textabschnitt aus Ovid (ca. 10 Verse); und (2) Die Übersetzung eines weiteren Textabschnitts aus Ovid (ca. 15 Verse) mit schriftlicher Reflexion und Kommentierung der Übersetzungsentscheidungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Latein, Ovid, Metamorphosen, Dädalus, Ikarus, Satzanalyse, Texterschließung, Übersetzung, Dreischritt-Methode, Lineares Decodieren, Syntax, Semantik, Textgrammatik, Prädikat, Übersetzungskritik, Stilanalyse, Tempora.
- Quote paper
- Heike Dilger (Author), 2004, Interpretation der Textstelle Ovid, Met. 8, 183-235, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233520