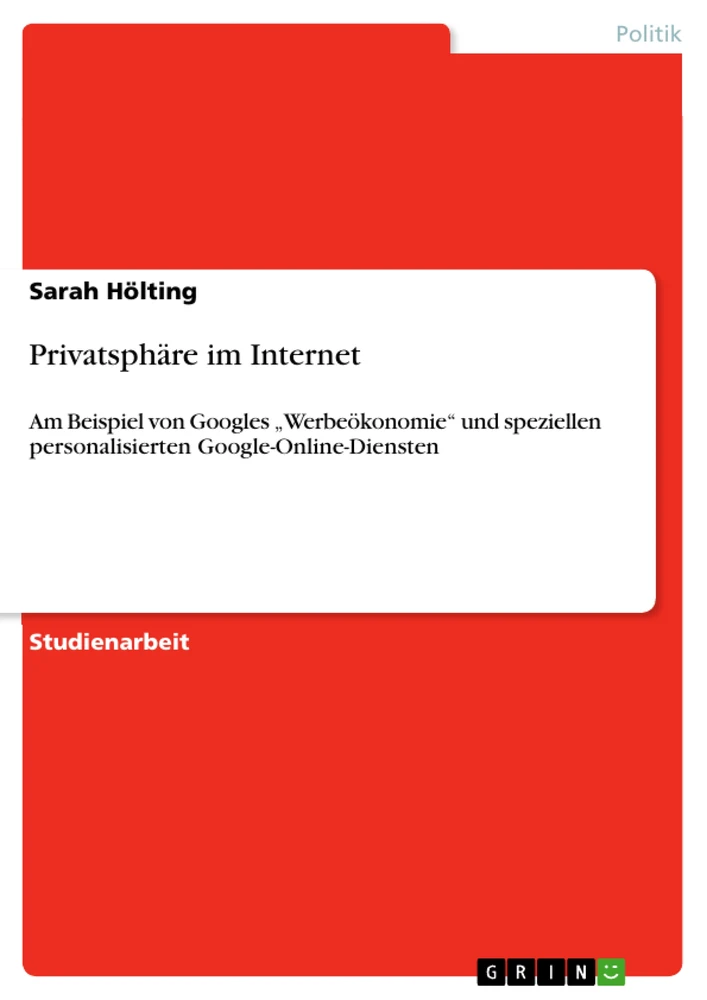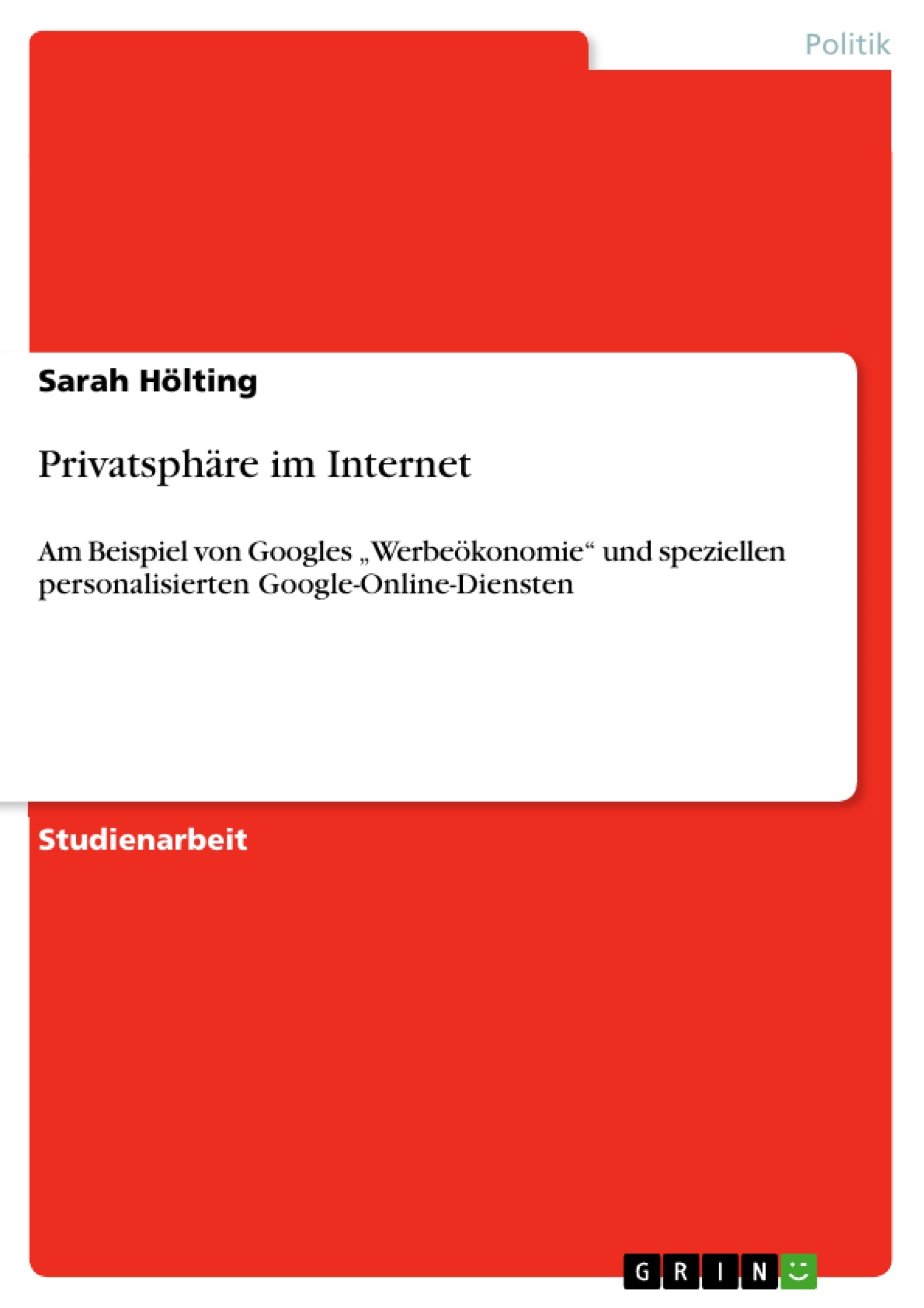Oh, neue Schuhe von Zalando, in rot – genau die wollte ich immer! Wie praktisch, dass die Anzeige gleich ganz oben auf Googles Suchliste erschienen ist. Aber woher wusste Google das eigentlich? Höchstwahrscheinlich hat sich das jeder schon mal gefragt und hat eine vage Vermutung: Dass das irgendwas mit Datensammeln zu tun haben muss. Viele, die diese diffuse Ahnung haben, empfinden es vielfach als „guten Tausch, für komfortable Netzangebote mit Informationen über sich selbst zu bezahlen“ (Reepesgaard, 2010: 263) Hier greift das Zitat von hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther: "Die Währung im Internet ist nicht Geld, sondern Daten", (http://www.sr-online.de/sr3/61/1406854.html) Doch weshalb diese Datensammelwut? Ganz einfach: Google finanziert seine kostenlosen Dienste über Werbung und Werbeunternehmen, sind wiederum angewiesen auf möglichst präzise Daten ihrer potentiellen Kunden. Genau über diese Daten verfügt Google – ein lohnendes Geschäft. In meiner Hausarbeit möchte ich untersuchen, inwieweit Google die Privatsphäre des einzelnen Nutzers mit seiner Datensammelei zur Finanzierung seiner Gratis-Dienste berührt oder gar einschränkt. Dazu werde ich Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre zur Grundlage meiner Untersuchung machen. Die in Rösslers Theorie enthaltene normative Begründung des Wertes von Privatheit, d.h. warum Privatheit wichtig ist, ist maßgebend, um „Verfalls- und Veränderungsprozesse zu interpretieren“ (Rössler, 2002: 18). Im ersten Teil werde ich Rösslers Theorie erläutern, wobei ich insbesondere auf die Dimension der informationellen Privatheit eingehen werde. Anschließend werde ich zunächst neutral die „Werbeökonomie“ von Google erläutern. Da ich bei vorheriger Recherche feststellen musste, dass die Anzeigenschaltung stark mit speziellen Diensten wie Google Mail zusammenhängt, werde ich auch diese erläutern. Darauffolgend werde ich kritisch auf den durch das Anzeigensystem und die personalisierten Dienste angesammelten Datenschatz von Google eingehen. Abschließend möchte ich im letzten Teil die Verbindung zu Rösslers Theorie herstellen. Hier steht vor allem die Frage im Vordergrund, ob sich Rösslers Definition von Privatheit im Angesicht der Datenkrake Google überhaupt noch anwenden bzw. halten lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition von Privatheit und der individuelle Wert von Privatheit
- 2.1 Informationelle Privatheit/ Privatheit der Informationskontrolle
- 2.2 Beziehungsformen, die auf den Schutz von Privatheit angewiesen sind
- 2.2.1 Private Beziehungen: Freunde, Familie, intime Beziehungen
- 2.2.2 Professionelle Beziehungen: Privatheit zwischen Personen mit beruflichen Rollen
- 3 Das Unternehmen: Google
- 3.1 Gründung
- 3.2 Fakten
- 3.3 Wie findet Google passende Seiten zum Suchbegriff?
- 3.3.1 Erweiterung von PageRank
- 3.3.2 Spracherkennung als Voraussetzung für maschinelles Lernen
- 3.4 Die Google-Ökonomie
- 3.5 Google erobert das Geschäft der Bannerwerbung
- 3.6 Googles Personalisierungstechnologien – Gefahr für die Privatsphäre?
- 3.6.1 GoogleMail
- 3.6.2 iGoogle
- 3.6.3 Google+
- 3.6.4 Persönliche Suche
- 3.6.5 Froogle & Google CheckOut
- 3.6.6 Galaxy Nexus
- 3.6.7 GoogleAnalytics: Google beobachtet das ganze Web
- 3.7 Zwischenfazit: Google - eine Bedrohung für die Privatsphäre?
- 4 Anwendung von Rösslers Konzept der Privatsphäre auf Googles „Werbeökonomie“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Googles Datensammlung auf die Privatsphäre der Nutzer im Kontext der Finanzierung von kostenlosen Online-Diensten. Die Arbeit basiert auf Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre und analysiert, inwieweit Googles Vorgehen die in dieser Theorie beschriebenen Aspekte der individuellen Autonomie und des Schutzes privater Bereiche tangiert.
- Beate Rösslers normative Definition von Privatheit und ihre Relevanz für die digitale Welt.
- Googles Geschäftsmodell und die Rolle der Datensammlung für die Finanzierung der angebotenen Dienste.
- Analyse der Personalisierungstechnologien von Google und deren Auswirkungen auf die informationelle Privatsphäre der Nutzer.
- Bewertung des Konflikts zwischen dem Anspruch auf Privatheit und den ökonomischen Interessen von Google.
- Anwendung von Rösslers Theorie auf die Praxis von Googles "Werbeökonomie".
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss von Googles Datensammlung auf die Privatsphäre der Nutzer. Sie verortet die Arbeit im Kontext des zunehmenden Datenaustauschs im Internet und führt in die theoretische Grundlage der Arbeit, die Theorie von Beate Rössler, ein. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die einzelnen Kapitel und deren thematische Schwerpunkte. Die Allgegenwärtigkeit von personalisierter Werbung im Internet und das damit verbundene Problem der Datensammlung werden als Ausgangspunkt der Untersuchung genannt.
2 Definition von Privatheit und der individuelle Wert von Privatheit: Dieses Kapitel erläutert Beate Rösslers Theorie der Privatheit. Es betont den normativen Wert von Privatheit für die individuelle Autonomie und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Rössler definiert drei Bedingungen für autonome Lebensführung: Authentizität und Identifikation, Genese und Habitus sowie Ziele und Projekte. Der Schutz der Privatheit wird als unabdingbare Voraussetzung für ein autonomes Leben dargestellt, wobei drei Grundtypen von Privatheit – lokale, dezisionale und informationelle Privatheit – unterschieden werden. Der Fokus liegt hier auf der informationellen Privatheit, da diese im Kontext von Google am stärksten betroffen ist.
3 Das Unternehmen: Google: Dieses Kapitel beschreibt das Unternehmen Google, seine Gründung, seine Fakten, und vor allem seine „Werbeökonomie“. Es analysiert, wie Google passende Seiten zu Suchbegriffen findet (PageRank), und wie Spracherkennung maschinelles Lernen ermöglicht. Das Kapitel geht detailliert auf Googles Personalisierungstechnologien ein, einschließlich Google Mail, iGoogle, Google+, der persönlichen Suche, Froogle, Google Checkout, Galaxy Nexus und Google Analytics. Es wird untersucht, wie diese Technologien Daten sammeln und die Privatsphäre der Nutzer beeinflussen könnten. Das Zwischenfazit des Kapitels stellt die Frage nach Googles Bedrohungspotenzial für die Privatsphäre.
Schlüsselwörter
Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung, Google, Werbeökonomie, Personalisierung, Datensammlung, individuelle Autonomie, Beate Rössler, Online-Dienste, Datenschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Googles Einfluss auf die Privatsphäre
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der Datensammlung durch Google auf die Privatsphäre der Nutzer, insbesondere im Kontext der Finanzierung kostenloser Online-Dienste. Sie analysiert, wie Googles Geschäftsmodell die individuelle Autonomie und den Schutz privater Bereiche beeinflusst, basierend auf der Theorie der Privatsphäre von Beate Rössler.
Welche Theorie wird in der Hausarbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Beate Rösslers normative Definition von Privatheit. Rössler definiert Privatheit als unabdingbare Voraussetzung für ein autonomes Leben und unterscheidet drei Grundtypen: lokale, dezisionale und informationelle Privatheit. Der Fokus liegt auf der informationellen Privatheit, da diese durch Googles Aktivitäten besonders betroffen ist.
Welche Aspekte von Googles Aktivitäten werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert Googles Geschäftsmodell und die Rolle der Datensammlung für die Finanzierung der angebotenen Dienste. Im Detail werden Googles Personalisierungstechnologien untersucht, darunter Google Mail, iGoogle, Google+, die persönliche Suche, Froogle, Google Checkout, Galaxy Nexus und Google Analytics. Die Arbeit beleuchtet, wie diese Technologien Daten sammeln und die Privatsphäre der Nutzer potenziell beeinträchtigen.
Wie definiert die Hausarbeit Privatheit?
Die Hausarbeit verwendet Rösslers Definition von Privatheit, die den normativen Wert von Privatheit für die individuelle Autonomie betont. Rössler beschreibt drei Bedingungen für autonome Lebensführung: Authentizität und Identifikation, Genese und Habitus sowie Ziele und Projekte. Der Schutz der Privatheit wird als essentiell für ein selbstbestimmtes Leben angesehen.
Welche Kernfragen werden in der Hausarbeit behandelt?
Zentrale Fragen sind: Wie beeinflusst Googles Datensammlung die informationelle Selbstbestimmung der Nutzer? Besteht ein Konflikt zwischen dem Anspruch auf Privatheit und den ökonomischen Interessen von Google? Wie lässt sich Rösslers Theorie auf Googles „Werbeökonomie“ anwenden? Welche Auswirkungen haben Googles Personalisierungstechnologien auf die Privatsphäre?
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition von Privatheit und deren individuellem Wert (inkl. Unterkapitel zu informationeller Privatheit und relevanten Beziehungsformen), Das Unternehmen Google (inkl. detaillierter Beschreibung der Personalisierungstechnologien und der Werbeökonomie), Anwendung von Rösslers Konzept auf Googles Werbeökonomie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung, Google, Werbeökonomie, Personalisierung, Datensammlung, individuelle Autonomie, Beate Rössler, Online-Dienste, Datenschutz.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit?
Die genaue Schlussfolgerung ist dem Text nicht vollständig zu entnehmen, aber die Arbeit bewertet den Konflikt zwischen dem Anspruch auf Privatheit und den ökonomischen Interessen von Google und wendet Rösslers Theorie auf die Praxis von Googles Werbeökonomie an. Das Zwischenfazit im Kapitel über Google stellt die Frage nach Googles Bedrohungspotenzial für die Privatsphäre.
- Quote paper
- Sarah Hölting (Author), 2012, Privatsphäre im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233287