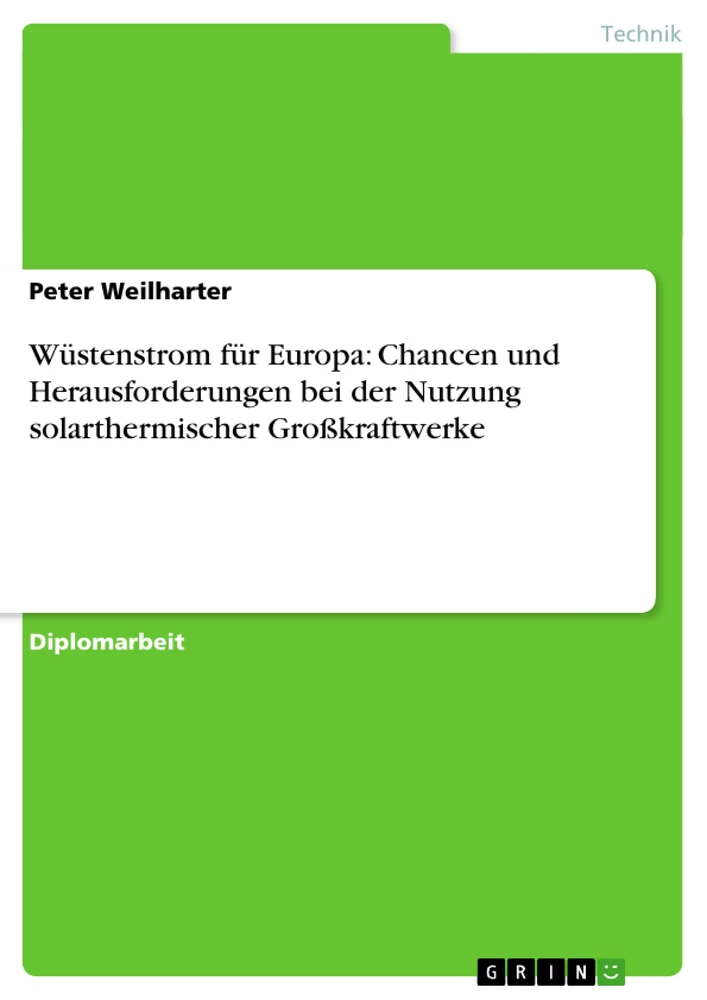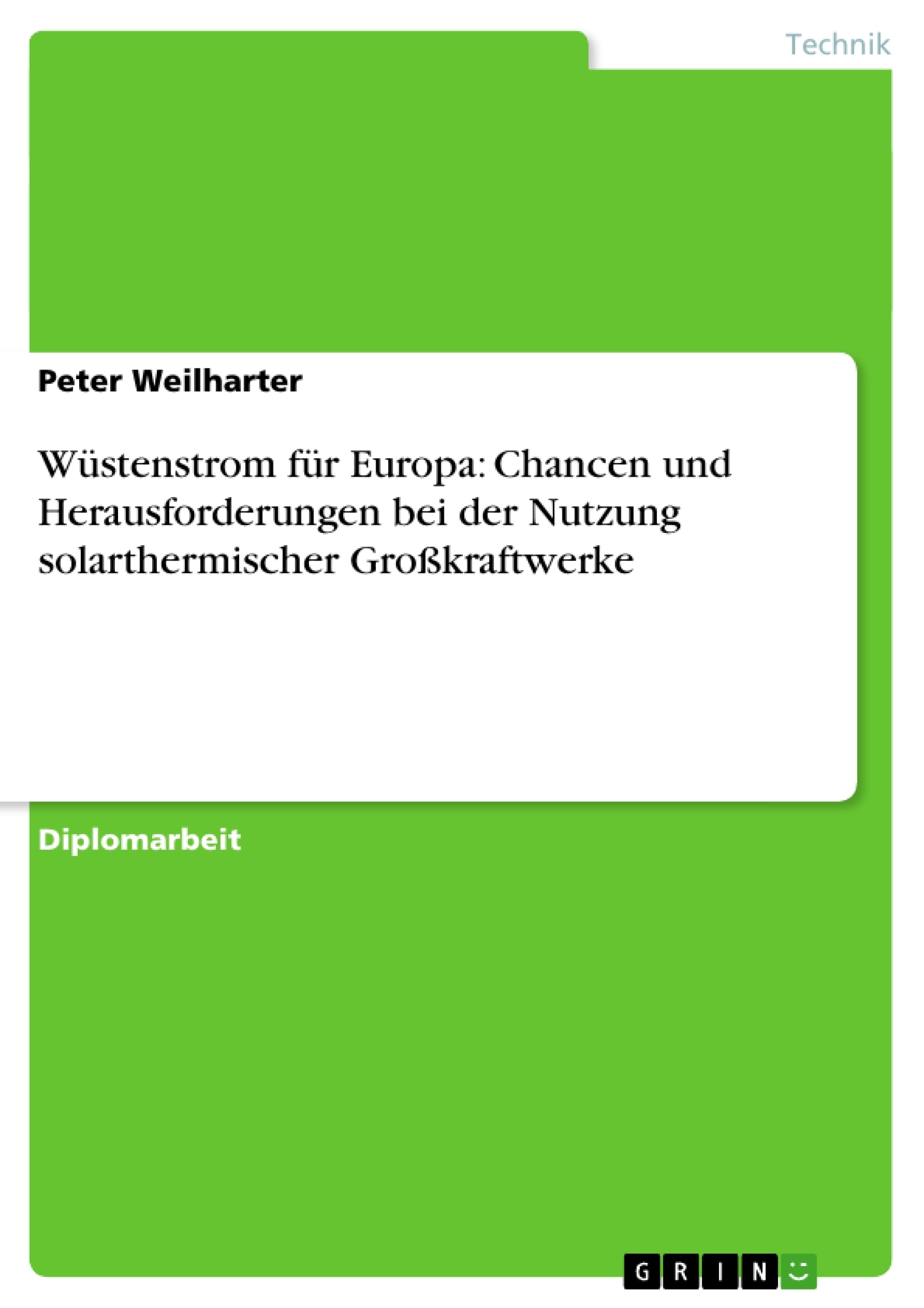Als einer der größten Hersteller für solarthermische Kraftwerke hat die Solar Millennium AG am 21. Dezember 2011 den Insolvenzantrag gestellt und am 28. Februar 2012 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Die erheblichen Preissenkungen bei Photovoltaik in den letzten Monaten favorisieren diese Technologie im wirtschaftlichen Sinne und machen es konkurrenzlos gegenüber solarthermischen Kraftwerken.
Sind es nur wirtschaftliche Gründe die die Art der Technologie bei der Erstellung eines Solarkraftwerks eine Rolle spielen oder sind es auch technische Gründe, die der PV-Technologie den Vorzug geben?
In Solarkraftwerken lässt sich die Energie in Form von Wärme speichern, bevor sie in der Turbine zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Dadurch können sie ununterbrochen und nahe an der Volllastgrenze betrieben werden. Solarthermische Kraftwerke können dadurch als Grundlastkraftwerke betrieben werden und bieten langfristig gesehen eine Alternative zu den bestehenden thermischen Kraftwerken.
Der größte Nachteil liegt in der geografischen Verfügbarkeit dieser Anlagen. Solarthermische Anlagen benötigen die direkte Sonneneinstrahlung, die nur in den Wüstenregionen der Erde ganzjährig zur Verfügung steht. Ausreichend Sonnenenergie und genügend Raum sind hier vorhanden. Fehlendes Wasser erfordert neue Technologien für die notwendige Kühlung, zur Steigerung des Wirkungsgrades. Ebenso stellt die Wüste eine technische Herausforderung für die Materialien und die dadurch erforderliche Wartung der Anlagen dar.
Im Moment scheint vieles gegen die Solarthermischen Kraftwerke zu sprechen, neue Technologien und steigende Preise bei fossilen Brennstoffen könnten aber dafür sorgen, dass diese Kraftwerke zur Sicherung und Stabilisierung Stromnetzes beitragen können.
Die Arbeit stellt die Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung solarthermischer Großkraftwerke dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Bedeutung von solarthermischen Kraftwerken
- 1.3 Methodik
- 2 Grundlagen
- 2.1 Standortvoraussetzungen
- 2.2 Arten von solarthermischen Großkraftwerken - CSP
- 2.2.1 Parabolrinnen-Kollektoren – PRK
- 2.2.2 Fresnel-Spiegel-Kollektoren – FSK
- 2.2.3 Zentralreceiver- bzw. Solarturm
- 2.2.4 Dish-Stirling-Anlagen
- 2.2.5 Hybride Solarkraftwerke
- 2.3 Energieumwandlung
- 2.3.1 Clausius-Rankine-Vergleichsprozess
- 2.3.2 Überhitzung des Frischdampfes
- 2.3.3 Zwischenüberhitzung
- 2.3.4 GuD
- 2.3.5 Kühlsysteme
- 2.4 Leistungsfähigkeit von Solarkraftwerken
- 3 Technischer Entwicklungsbedarf und Trends
- 3.1 Vollzeitbetrieb
- 3.1.1 Thermische Speicherung
- 3.1.2 Sensible Wärmespeicher
- 3.1.3 Latente Wärmespeicher
- 3.1.4 Chemische Wärmespeicherung
- 3.1.5 Sorption-Wärmespeicherung
- 3.1.6 Investitionskosten verschiedener Speichersysteme
- 3.2 Solarthermochemische Herstellung von Wasserstoff
- 3.2.1 Aktuelle Projekte
- 3.3 Trends
- 3.1 Vollzeitbetrieb
- 4 Ökonomische Auswirkungen
- 4.1 Investitionskosten
- 4.2 Stromgestehungskosten von solarthermischen Großkraftwerken
- 4.3 Vergleich mit konkurrierenden Techniken
- 4.3.1 Jahresstromproduktion in einem Solarkraftwerk
- 4.3.2 Vollkosten der Stromerzeugung
- 4.3.3 Unterschiede zwischen PV und CSP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der Nutzung solarthermischer Großkraftwerke. Im Fokus steht die Analyse der wirtschaftlichen und technischen Aspekte im Vergleich zu konkurrierenden Technologien, insbesondere Photovoltaik (PV). Die Arbeit beleuchtet die Möglichkeiten eines Vollzeitbetriebs durch Wärmespeicher und betrachtet innovative Ansätze wie die solarthermochemische Wasserstoffproduktion.
- Wirtschaftliche Vergleichbarkeit solarthermischer Kraftwerke mit PV-Anlagen
- Technische Herausforderungen und Entwicklungspotenziale solarthermischer Technologien
- Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz und des Wirkungsgrades
- Bedeutung von Wärmespeichern für den Vollzeitbetrieb
- Potenzial der solarthermochemischen Wasserstoffproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik solarthermischer Kraftwerke ein und beschreibt den Anlass der Arbeit vor dem Hintergrund des Insolvenzverfahrens der Solar Millennium AG. Es werden die Zielsetzung der Arbeit sowie die Bedeutung solarthermischer Kraftwerke im Kontext der erneuerbaren Energien und die angewandte Methodik erläutert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Chancen und Herausforderungen im Vergleich zu anderen Solartechnologien.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Aspekte solarthermischer Kraftwerke. Es beschreibt die Standortvoraussetzungen, die verschiedenen Arten von CSP-Kraftwerken (Parabolrinnen, Fresnel-Spiegel, Solarturm, Dish-Stirling, Hybridsysteme), die Energieumwandlungsprozesse (Clausius-Rankine-Prozess, Überhitzung, Zwischenüberhitzung, GuD-Kraftwerke), Kühlsysteme und die Leistungsfähigkeit der Anlagen. Es liefert eine umfassende technische Basis für die anschließende Analyse.
3 Technischer Entwicklungsbedarf und Trends: Dieses Kapitel befasst sich mit dem technischen Entwicklungsbedarf und den aktuellen Trends im Bereich solarthermischer Kraftwerke. Es analysiert die Notwendigkeit eines Vollzeitbetriebs und die verschiedenen Wärmespeichertechnologien (sensible, latente, chemische, Sorptionsspeicher). Ein Schwerpunkt liegt auf der solarthermochemischen Wasserstoffproduktion und aktuellen Forschungsprojekten. Der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Markttrends rundet das Kapitel ab.
4 Ökonomische Auswirkungen: Dieses Kapitel analysiert die ökonomischen Aspekte solarthermischer Kraftwerke. Es untersucht die Investitionskosten, die Stromgestehungskosten im Vergleich zu PV und Windenergie, sowie die Vollkosten der Stromerzeugung. Der Vergleich mit konkurrierenden Technologien und die Identifizierung von Kostensenkungspotenzialen sind zentrale Aspekte dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Solarthermische Kraftwerke, CSP, Photovoltaik (PV), Energieumwandlung, Wärmespeicherung, Wirkungsgrad, Stromgestehungskosten, Wasserstoffproduktion, Vollzeitbetrieb, GuD-Kraftwerke, ökonomische Aspekte, technische Herausforderungen, Standortbedingungen, Trends, Investitionskosten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Solarthermische Großkraftwerke
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen solarthermischer Großkraftwerke (CSP) im Vergleich zu anderen Technologien, insbesondere Photovoltaik (PV). Der Fokus liegt auf den wirtschaftlichen und technischen Aspekten, einschließlich der Möglichkeiten eines Vollzeitbetriebs durch Wärmespeicher und der solarthermochemischen Wasserstoffproduktion.
Welche Arten von solarthermischen Kraftwerken werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Arten von CSP-Kraftwerken: Parabolrinnen-Kollektoren (PRK), Fresnel-Spiegel-Kollektoren (FSK), Zentralreceiver (Solartürme), Dish-Stirling-Anlagen und hybride Solarkraftwerke. Die zugehörigen Energieumwandlungsprozesse (Clausius-Rankine-Prozess, Überhitzung, Zwischenüberhitzung, GuD-Kraftwerke) und Kühlsysteme werden ebenfalls erläutert.
Welche Rolle spielen Wärmespeicher?
Wärmespeicher sind entscheidend für den Vollzeitbetrieb solarthermischer Kraftwerke. Die Arbeit untersucht verschiedene Speichertechnologien: sensible, latente, chemische und Sorptionsspeicher. Die Investitionskosten der verschiedenen Systeme werden verglichen.
Wie werden die wirtschaftlichen Aspekte behandelt?
Die ökonomischen Auswirkungen werden umfassend analysiert. Dies beinhaltet Investitionskosten, Stromgestehungskosten im Vergleich zu PV und Windenergie, die Vollkosten der Stromerzeugung und die Identifizierung von Kostensenkungspotenzialen. Ein detaillierter Vergleich mit konkurrierenden Technologien ist enthalten.
Welche technischen Herausforderungen und Entwicklungstrends werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet den technischen Entwicklungsbedarf und aktuelle Trends. Ein Schwerpunkt liegt auf der solarthermochemischen Wasserstoffproduktion und aktuellen Forschungsprojekten. Zukünftige Entwicklungen und Markttrends werden ebenfalls betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Solarthermische Kraftwerke, CSP, Photovoltaik (PV), Energieumwandlung, Wärmespeicherung, Wirkungsgrad, Stromgestehungskosten, Wasserstoffproduktion, Vollzeitbetrieb, GuD-Kraftwerke, ökonomische Aspekte, technische Herausforderungen, Standortbedingungen, Trends, Investitionskosten.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Methodik in der Einleitung. Diese wird detailliert im Originaltext erklärt.
Gibt es einen Vergleich mit Photovoltaik (PV)?
Ja, ein ausführlicher Vergleich mit Photovoltaik-Anlagen (PV) hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit.
Wie wird die Wasserstoffproduktion behandelt?
Die Arbeit untersucht das Potenzial der solarthermochemischen Wasserstoffproduktion und beschreibt aktuelle Forschungsprojekte auf diesem Gebiet.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Grundlagen solarthermischer Kraftwerke, Technischen Entwicklungsbedarf und Trends sowie Ökonomische Auswirkungen. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
- Quote paper
- Peter Weilharter (Author), 2013, Wüstenstrom für Europa: Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung solarthermischer Großkraftwerke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232893