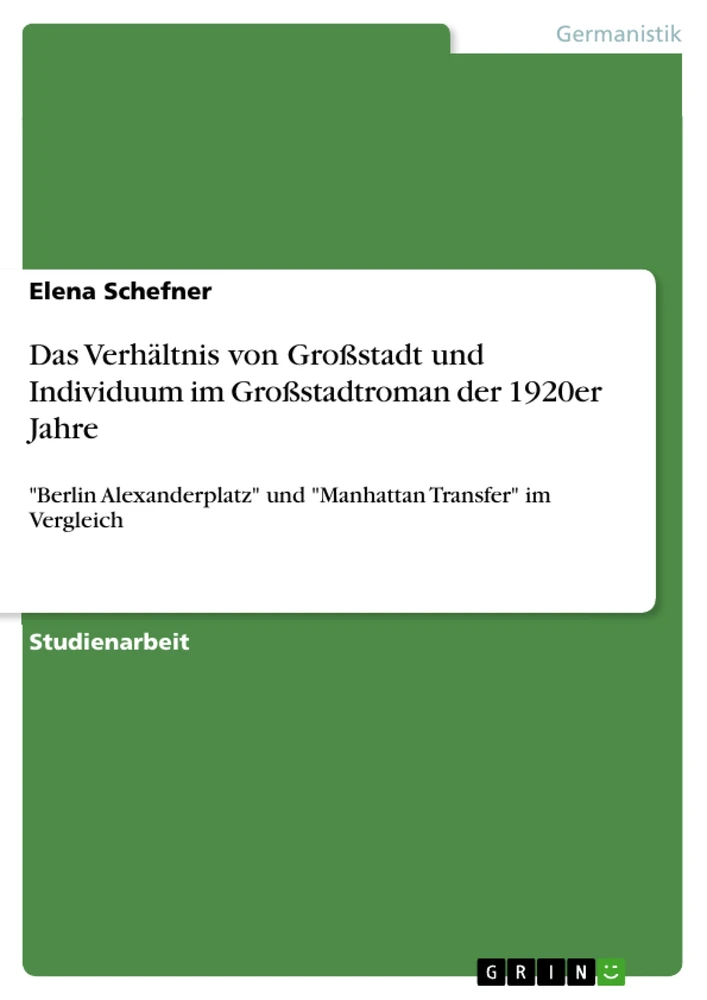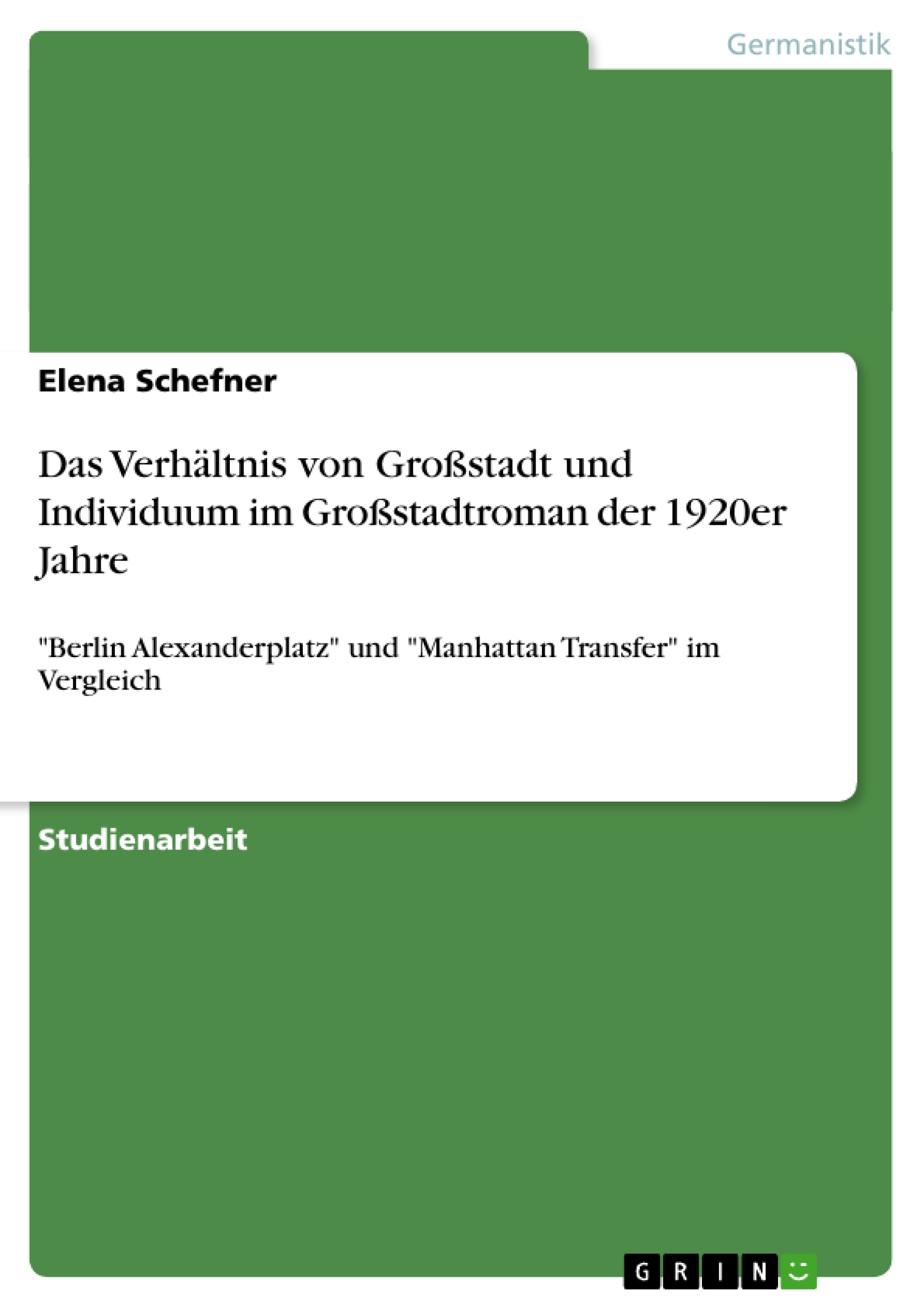John Dos Passos’ "Manhattan Transfer" (1925) und Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" (1929) zählen neben Joyce’ "Ulysses" zu den bedeutendsten Großstadtromanen des 20. Jahrhunderts. Ein wesentlicher Grund dafür liegt darin, dass es beiden Romanen gelingt, sowohl die Dynamik und Komplexität als auch das Chaos und die Widersprüchlichkeiten der modernen Großstadt, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts explosionsartig entwickelte, literarisch einzufangen. Diese Großstadt, die die Wahrnehmung des Menschen entscheidend veränderte, ließ sich nicht mehr objektiv in der Form des traditionellen Romans darstellen. Vielmehr musste sich der Roman dem Rhythmus der Großstadt anpassen, um sie in ihrer Flüchtigkeit und Fragmenthaftigkeit zum Ausdruck bringen zu können. Indem die Autoren durch die Montagetechnik die Stadt selbst zu Wort kommen lassen, revolutionieren sie nicht nur die traditionelle Romanform, sondern rücken gleichzeitig das Verhältnis des Einzelnen zur modernen Großstadt in den Vordergrund. Schließlich sind die neuen ästhetischen Ausdrucksformen eng geknüpft an die radikale Veränderung der menschlichen Sinneswahrnehmung, die in der Forschungsliteratur als „Krise der Wahrnehmung“ bezeichnet wird.
Durch die schlagartige Verstädterung zu Beginn des 20. Jahrhunderts seien die Menschen zunehmend mit den permanent auf sie einströmenden Eindrücken überfordert gewesen. Folglich mussten sie neue Erfahrungs- und Wahrnehmungsstrukturen entwickeln, um mit der Reizüberflutung der Moderne umzugehen. Diese bewusstseinsverändernde Wirkung der Großstadt, die erstmals Georg Simmel in seinem Aufsatz "Die Großstädte und das Geistesleben" (1903) thematisiert, ist seit jeher mit einer negativen Konnotation behaftet. Von Überforderung des Individuums, unbarmherziger Sachlichkeit und gar „Vergewaltigungen der Großstadt“ ist bei bei Simmel Rede. Doch auch heute noch wird in der germanistischen Sekundärliteratur die moderne Großstadt mit Orientierungslosigkeit, Oberflächlichkeit und Überforderung gleichgesetzt.
Doch ist es tatsächlich dieses Verhältnis zwischen Großstadt und Individuum, das die Großstadtromane der 1920er Jahre vermitteln? Anhand von "Berlin Alexanderplatz" und "Manhattan Transfer" unterzieht die Arbeit das vermeintlich feindliche Bild der Stadt im Großstadtroman der 1920er einer neuerlichen Prüfung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stadtmontagen - Die Großstadt erzählt sich selbst
- Die Stadt als Gegenspieler in Berlin Alexanderplatz
- Die Stadt als Naturgewalt in Manhattan Transfer
- Die Großstädte und das Geistesleben
- Franz Biberkopf - ein blasierter Großstädter?
- Lebensläufe im Labyrinth Manhattans
- Fazit: Großstadt vs. Individuum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Großstadt und Individuum im Großstadtroman der 1920er Jahre am Beispiel von Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz (1929) und John Dos Passos' Manhattan Transfer (1925). Die Arbeit untersucht die Darstellung der Großstadt als Gegenspieler und als Naturgewalt, analysiert die Reaktion der Protagonisten auf die Stadt und deren Einfluss auf das Geistesleben der Individuen. Ziel ist es, das vermeintlich feindliche Bild der Stadt im Großstadtroman der 1920er Jahre einer neuen Prüfung zu unterziehen.
- Darstellung der Großstadt als Gegenspieler
- Darstellung der Großstadt als Naturgewalt
- Einfluss der Großstadt auf das Geistesleben
- Reaktion der Protagonisten auf die Stadt
- Konzepte des Zusammenlebens mit der Großstadt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt Berlin Alexanderplatz und Manhattan Transfer als zwei bedeutende Großstadtromane des 20. Jahrhunderts vor, die die Dynamik und Komplexität der modernen Großstadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts einfangen. Die Autoren Döblin und Dos Passos bedienen sich der Montagetechnik, um die Stadt selbst zum Sprechen zu bringen und das Verhältnis des Einzelnen zur modernen Großstadt in den Vordergrund zu rücken. Die Arbeit beleuchtet die „Krise der Wahrnehmung“ im Kontext der rasanten Verstädterung und Technisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und stellt Simmels Thesen zur Überforderung des Individuums in der Großstadt vor.
Stadtmontagen - Die Großstadt erzählt sich selbst
Das Kapitel untersucht die Stadtmontagen in Berlin Alexanderplatz und Manhattan Transfer als Mittel der Darstellung der Stadt als Bewusstseinsstruktur. Die Autoren verzichten auf eine mimetische Darstellung und orientieren sich an neuen visuellen Medien, um die Großstadt durch das Zusammenfügen von sich überschneidenden sprachlichen Bildern und Texten zum Vorschein zu bringen.
Die Stadt als Gegenspieler in Berlin Alexanderplatz
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung Berlins in Berlin Alexanderplatz als Gegenspieler, der das Individuum in seinen Bann zieht. Die Arbeit befasst sich mit den zahlreichen Eindrücken und Reizen, denen Franz Biberkopf in der Großstadt ausgesetzt ist, und beleuchtet die bedrohliche und chaotische Seite der Stadt.
- Quote paper
- Elena Schefner (Author), 2012, Das Verhältnis von Großstadt und Individuum im Großstadtroman der 1920er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232867