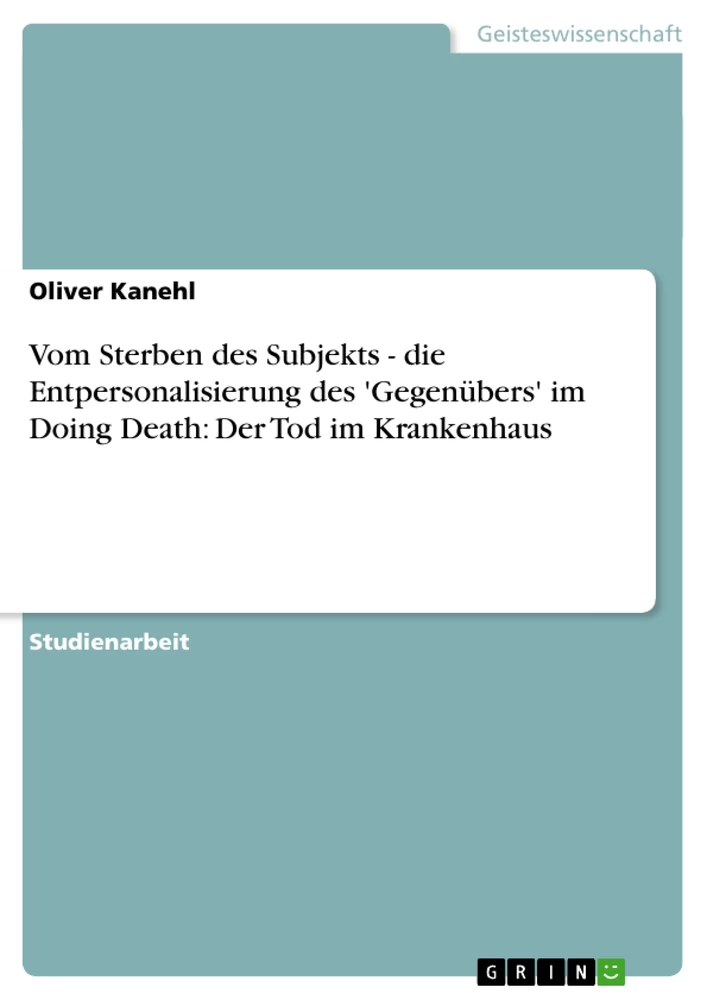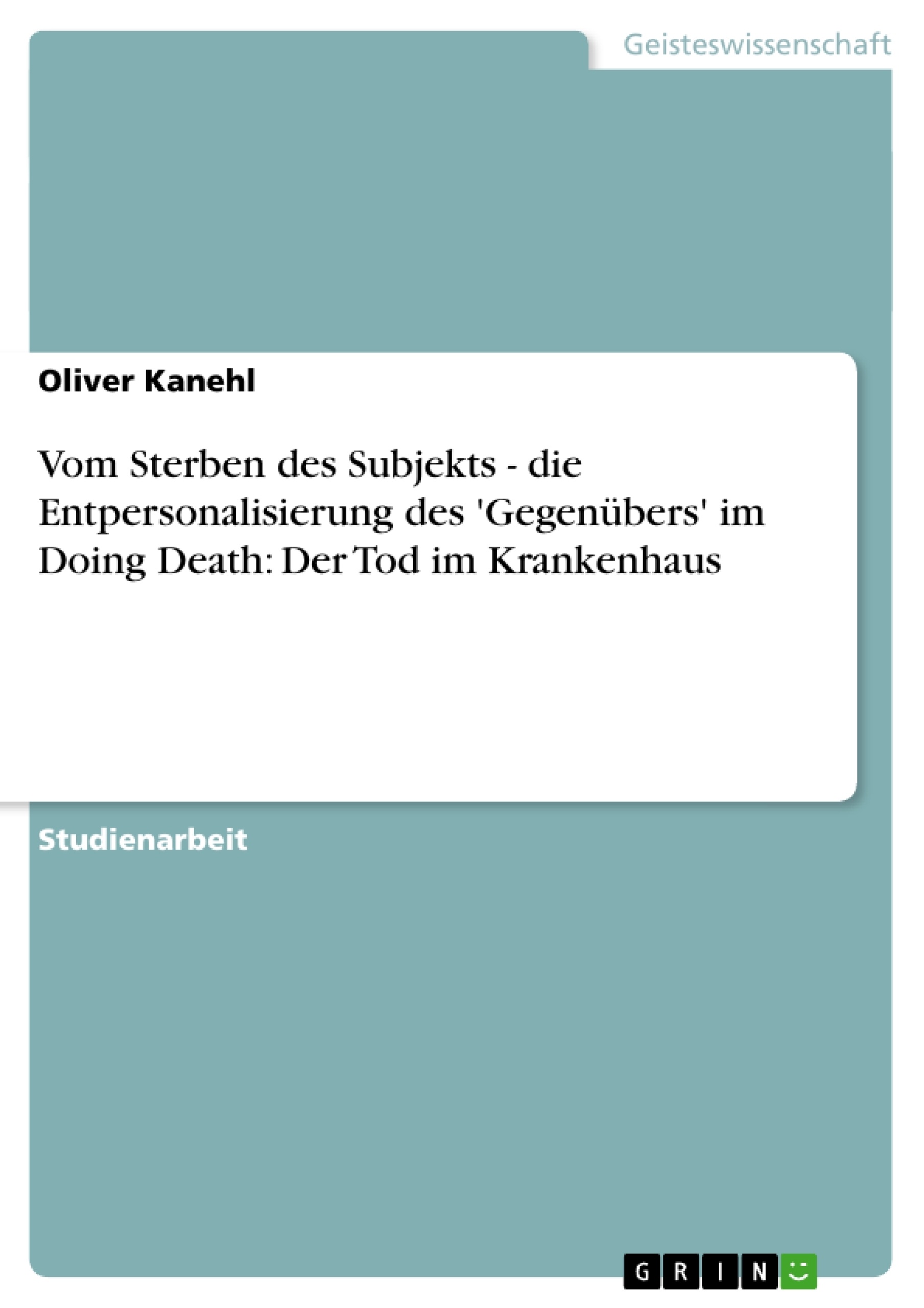In der postmodernen Gesellschaft hat es eine Wandlung im Umgang mit dem Tod allgemein und mit den Toten an sich gegeben. Im Privatbereich zeigt sich der Tod eines Menschen "gemeinhin als singuläres Ereignis und als Grenzsituation per excellence. Gleichzeitig wird der Tod zu etwas Alltäglichem im Berufsbereich bestimmter Akteure. Zu diesem "Doing Death zählen der Bereich der Lebenserhaltung im Krankenhaus, der der angewandten Wissenschaft - in der Form der Autoptik in der Pathologie - und der des Verlusts, vertreten durch Bestatter und Friedhofsangestellte. Die Akteure sind ständig mit "Grenzsituation einer Statuspassage konfrontiert, und sind daher darauf angewiesen, Strategien und Techniken der Verarbeitung zu entwickel, um ihren beruflichen Alltag bewerkstelligen zu können.
In der vorliegenden Arbeit soll nun das Augenmerk vor allem auf die Frage gelegt werden, wann und warum der Körper des sterbenden bzw. toten Menschen als eine Person oder als deren Umkehrung bzw. schließlich als eine Leiche, ein Ding, konstruiert wird. Ist der sterbende Mensch noch ein Subjekt oder bereits ein Objekt? Wie gelingt es den Akteuren, ihr "Gegenüber erst als Person und später als entpersonalisiertes Gegenüber, als "reine Leiche", wahrzunehmen?
Wie gehen die professionellen Akteure mit ihrem Arbeitsgegenstand um? Welche Strategien verfolgen sie, um ihre Arbeit zu bewerkstelligen? Wie konstruieren sie ihr Gegenüber?
Um zu verstehen, wie der wechselvolle Status des Gegenübers durch die Akteure konstruiert wird, ist es zunächst wichtig, zu erfahren, wie der Tod des anderen den Menschen immer wieder an seinen eigenen erinnert. Daran anschließend soll dann der Frage nachgegangen werden, auf welche Arten das mit sterbenden Menschen arbeitende Krankenhauspersonal sein Gegenüber konstruiert. Deshalb werden die phänomenologischen Erscheinungsformen des sterbenden bzw. toten Körpers des Gegenübers beschrieben. Schließlich soll diskutiert werden, was die Leiche als Gegenüber im professionellen Handlungszusammenhang letztlich ausmacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Tod des Gegenübers und der eigene Tod
- 3. Der sterbende Körper
- 3.1. Das personale Gegenüber
- 3.2. Das entpersonalisierte Gegenüber
- 3.3. Der soziale Tod
- 4. Der tote Körper
- 4.1. Das Herrichten des Körpers - das Gegenüber zwischen toter Person und reiner Leiche
- 4.2. Das Wegbringen des Körpers - das Gegenüber als reine Leiche
- 5. Fazit - was ist das tote Gegenüber?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion des sterbenden und toten Körpers im Krankenhauskontext. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das Krankenhauspersonal sein "Gegenüber" – den Patienten, den Sterbenden, den Verstorbenen und die Leiche – wahrnimmt und konstruiert, von der Person bis hin zur "reinen Leiche". Die Arbeit analysiert den Prozess der Entpersonalisierung und die Strategien des Personals im Umgang mit dem Tod.
- Konstruktion des sterbenden und toten Körpers als Person oder Objekt
- Der Prozess der Entpersonalisierung im Umgang mit dem Tod
- Strategien des Krankenhauspersonals im Umgang mit dem Tod
- Der Einfluss des Todes des "Gegenübers" auf die Konfrontation mit dem eigenen Tod
- Die Bedeutung der "reinen Leiche" im professionellen Handlungszusammenhang
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel im Umgang mit dem Tod in der postmodernen Gesellschaft, insbesondere im professionellen Kontext von Krankenhäusern, Pathologie und Bestattungswesen. Sie thematisiert das "Doing Death" und die Notwendigkeit von Strategien zur Verarbeitung dieser Grenzsituationen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie der Körper des Sterbenden/Toten als Person oder Leiche konstruiert wird und wie Akteure ihr "Gegenüber" wahrnehmen. Die empirische Grundlage bildet die Forschungsarbeit "Der ganz gewöhnliche Tod" von Ursula Streckeisen, wobei der Fokus auf das Krankenhauspersonal gelegt wird.
2. Der Tod des Gegenübers und der eigene Tod: Dieses Kapitel beleuchtet den Tod nicht als rein individuellen Akt, sondern als sozialen Prozess. Es betont, dass der Tod des "Nächsten" als weitaus bedrohlicher wahrgenommen wird als der eines unbekannten "Anderen". Der Tod eines Nahestehenden zwingt den Menschen, sich intensiver mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen und ihn durch den Tod des anderen mit zu erleben. Der Verlust der "Person" eines geliebten Menschen erlaubt einen Einblick in die Notwendigkeit des Sterbens. Der Tod bleibt dabei ein "mal-heur", ein Unglück, trotz seiner Ritualisierung und der Versuche, ihn zu zähmen. Trotz des physischen Verschwindens hinterlässt der Verstorbene gemeinsame, sozial konstruierte Wirklichkeiten.
Schlüsselwörter
Tod, Entpersonalisierung, Krankenhaus, "Doing Death", Gegenüber, Leiche, Sterben, Körper, Professionalisierung, Soziale Konstruktion, Sterbende, Pflegepersonal, Grenzsituation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konstruktion des sterbenden und toten Körpers im Krankenhauskontext
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion des sterbenden und toten Körpers im Krankenhauskontext. Im Mittelpunkt steht die Wahrnehmung und Konstruktion des „Gegenübers“ (Patient, Sterbender, Verstorbener, Leiche) durch das Krankenhauspersonal, vom Individuum bis zur „reinen Leiche“. Analysiert werden die Entpersonalisierung und die Strategien im Umgang mit dem Tod.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion des sterbenden und toten Körpers als Person oder Objekt, den Prozess der Entpersonalisierung, Strategien des Krankenhauspersonals im Umgang mit dem Tod, den Einfluss des Todes des „Gegenübers“ auf die Konfrontation mit dem eigenen Tod und die Bedeutung der „reinen Leiche“ im professionellen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit umfasst fünf Kapitel: Einleitung (Wandel im Umgang mit dem Tod, „Doing Death“), Der Tod des Gegenübers und der eigene Tod (Tod als sozialer Prozess, Konfrontation mit dem eigenen Tod), Der sterbende Körper (personales vs. entpersonalisiertes Gegenüber, sozialer Tod), Der tote Körper (Herrichten und Wegbringen des Körpers), und Fazit (Was ist das tote Gegenüber?).
Welche empirische Grundlage liegt der Arbeit zugrunde?
Die empirische Grundlage bildet die Forschungsarbeit „Der ganz gewöhnliche Tod“ von Ursula Streckeisen, wobei der Fokus auf das Krankenhauspersonal gelegt wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Tod, Entpersonalisierung, Krankenhaus, „Doing Death“, Gegenüber, Leiche, Sterben, Körper, Professionalisierung, Soziale Konstruktion, Sterbende, Pflegepersonal, Grenzsituation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Konstruktion des sterbenden und toten Körpers im Krankenhauskontext zu analysieren und die Strategien des Personals im Umgang mit dem Tod zu untersuchen.
Wie wird der Tod in dieser Arbeit betrachtet?
Der Tod wird nicht als rein individueller Akt, sondern als sozialer Prozess betrachtet. Der Tod eines Nahestehenden wird als bedrohlicher wahrgenommen als der eines Unbekannten und zwingt zur intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod.
Welche Rolle spielt die „reine Leiche“ in dieser Arbeit?
Die „reine Leiche“ spielt eine wichtige Rolle im professionellen Handlungszusammenhang und wird als ein Endpunkt des Prozesses der Entpersonalisierung betrachtet.
- Quote paper
- Oliver Kanehl (Author), 1998, Vom Sterben des Subjekts - die Entpersonalisierung des 'Gegenübers' im Doing Death: Der Tod im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23273