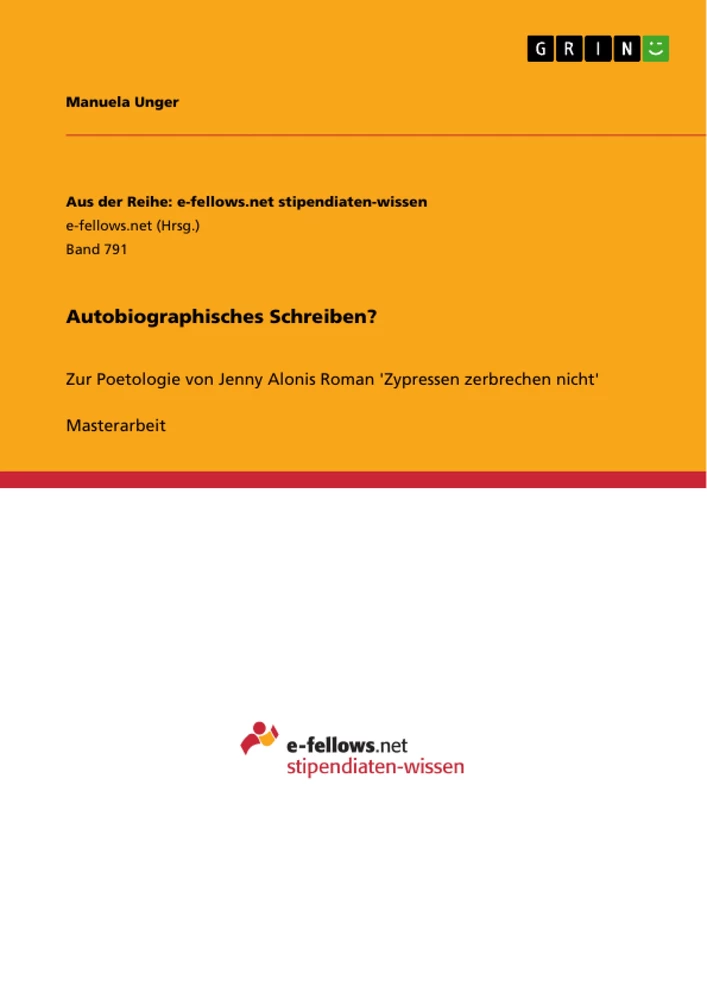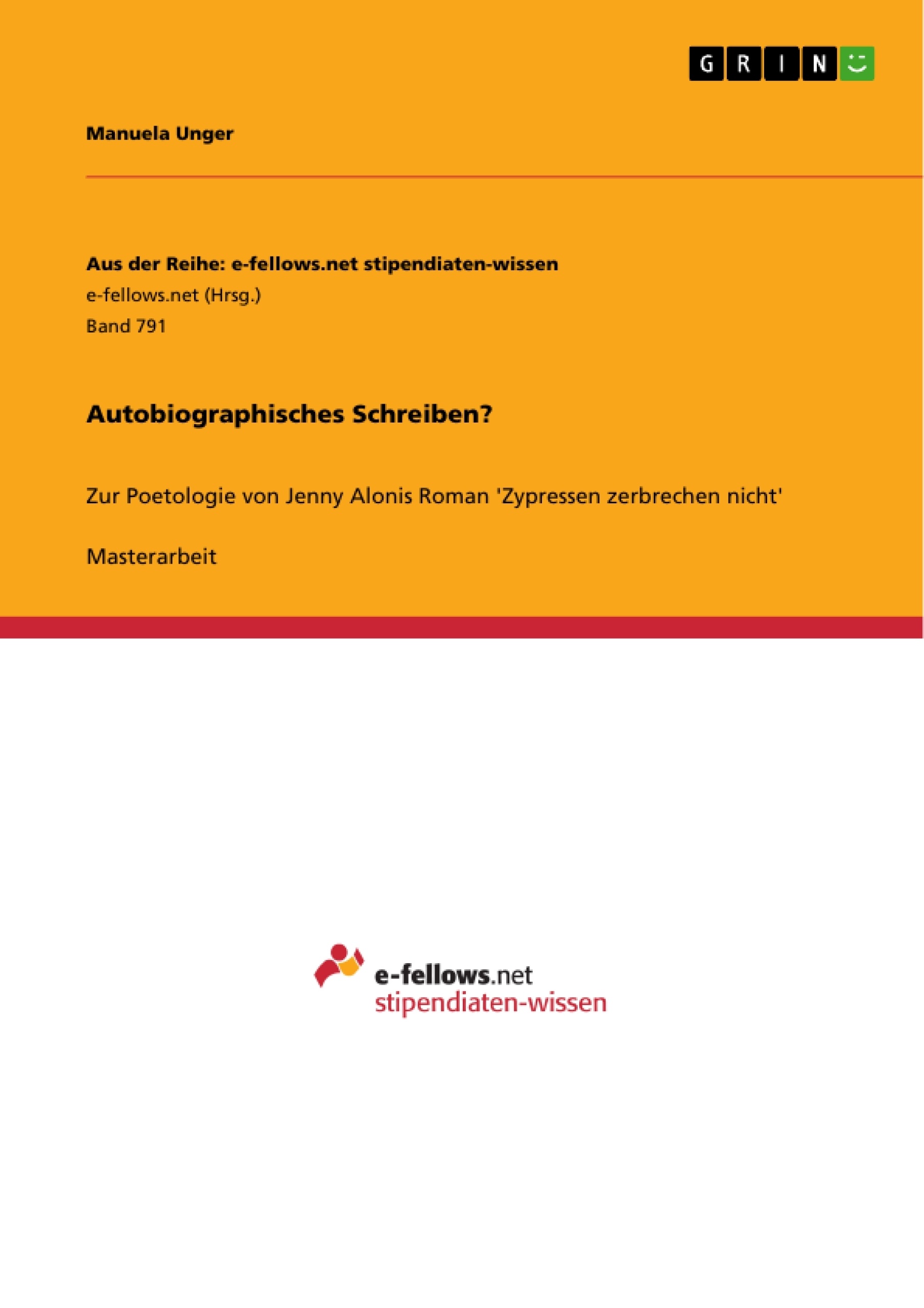Jenny Alonis Roman 'Zypressen zerbrechen nicht' wurde bisher in der Forschungsliteratur als extrem autobiographische Erzählung bezeichnet. Diese Arbeit fokussiert sowohl Faktualitätsmarker als auch fiktionale Bestandteile. Das Ergebnis ist ein klares überwiegen der Fiktionalität und entspricht damit einer völlig neuen Sichtweise auf das Werk der Autorin.
Bei der Herausarbeitung der Überschneidungen zwischen Leben und Schaffen der Autorin wurden ihre Tagebucheinträge aus der Zeit von 1939-1943 untersucht und mit bisher unveröffentlichtem Material gearbeitet.
Die Arbeit beginnt damit, Autobiographiekonzepte aus der Zeit des alten Ägyptens bis in die 1970er Jahre auf die Konstitution von Identität hin zu untersuchen. Die Identiätskonzepte werden dann mit der Charakterisierung der Hauptfigur im autobiographischen Roman verglichen. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit besonderen Elementen der jüdischen Autobiographiegeschichte. Natürlich darf ein Überblick über bahnbrechende Konzepte der Autobiographieforschung nicht fehlen. Anschließend widmet sich die Autorin ausführlich der Interpretation des Romans. In intensiver Archivarbeit wurde ein Originalmanuskript von 'Zypressen zerbrechen nicht' mit dem Text der Werkausgabe verglichen. Unterschiede wurden nahezu vollständig herausgearbeitet. Ebenso gründlich wurden die Übereinstimmungen von Ereignissen, die im Tagebuch geschildert werden, mit Szenen aus dem Roman aufgedeckt. Abschließende konnte bewiesen werden, dass es sich bei dem Roman um ein stark fiktionales Konstrukt handelt, dessen künstlerischer Wert weit über eine bloße Zusammenstellung von Tagebucheinträgen hinausgeht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Autobiographiegeschichte: Identitätskonzeptionen von 3000 v. Chr. bis in die 1970er Jahre
- 2.1 Das Alte Ägypten
- 2.2 Die Antike
- 2.3 Die Zeit zwischen Antike und dem 18. Jahrhundert
- 2.4 Die Frühe Neuzeit
- 2.5 Die Zeit zwischen Ende des 18. und Mitte des 19. Jahrhunderts
- 2.6 Die Moderne
- 2.7 Die 1970er Jahre
- 3 Jenny Aloni: 'Zypressen zerbrechen nicht': Gültigkeit autobiographiegeschichtlicher Identitätskonzepte
- 3.1 Zeugenschaftsliteratur als ein Teil der Shoah-Literatur
- 3.2 Erinnerungskritik im Shoah-Diskurs
- 3.3 Rechtfertigung versus Erklärung
- 3.4 Reflexion versus Selbstkritik
- 3.5 Individualismus bei einer Romanfigur?
- 3.6 Die Rolle der Körperlichkeit
- 3.7 Geschichtlichkeit der Figur oder geschichtliche Rahmenhandlung?
- 3.8 Historische versus stilistische Moderne
- 3.9 Judentum ohne Religion?
- 4 Jüdische Autobiographie: Besondere Merkmale
- 4.1 Begriffsgeschichte: Von der 'Assimilation' zu 'transkulturellen Bereichen'
- 4.2 Auswirkungen verschiedener Traditionen
- 4.3 Auswirkungen von Diaspora und Exil
- 4.4 Erinnerung im jüdischen Kontext
- 4.5 Sonderstatus der jüdischen Autobiographie
- 5 Autobiographietheorie: G. Misch, G. Gusdorf, P. Lejeune und H. Heissenbüttel
- 5.1 Einteilung nach M. Holdenried
- 5.2 Frühe Autobiographietheorie: G. Misch
- 5.3 Mittlere Phase: G. Gusdorf
- 5.4 Aktuelle Phase: P. Lejeune und H. Heissenbüttel
- 6 Die Protagonistin: Veränderung der Figur im Laufe des Romans
- 6.1 Die Überfahrt (Abschnitt 1, S. 5-20)
- 6.2 Zum ersten Mal in der Stadt (Abschnitt 2, S. 20-28)
- 6.3 Wohnen bei Neomi Rose (Abschnitt 3, S. 28-33)
- 6.4 Die Universität (Abschnitt 4, S. 33-42)
- 6.5 [Beim Mittagstisch I (Abschnitt 5, S. 42-48)]
- 6.6 Arbeit in der Druckerei / Arbeit bei einer Abendgesellschaft (Abschnitt 6, S. 48-56)
- 6.7 Beim Mittagstisch II / Gespräch mit Thomas Katz I (Abschnitt 7, S. 56-64)
- 6.8 Wohnen bei Lea (Abschnitt 8, S. 64-72)
- 6.9 [Einkauf mit Lea in der Altstadt (Abschnitt 9, S. 72-75)]
- 6.10 Die Studentenfeier (Abschnitt 10, S. 75-80)
- 6.11 Arbeit an der Universität (Abschnitt 11, S. 80-85)
- 6.12 Wohnen im eigenen Mietzimmer / Arbeit als Tellerwäscherin (Abschnitt 12, S. 85-95)
- 6.13 Der Ausflug (Abschnitt 13, S. 95-100)
- 6.14 Besuch bei Abschalom I (Abschnitt 14, S. 100-108)
- 6.15 Die ehemalige Freundschaft mit Elisabeth (Abschnitt 15, S. 108-112)
- 6.16 [Besuch bei Abschalom II (Abschnitt 16, S. 112-118)]
- 6.17 Elisabeths Suizid / Die versuchte Vergewaltigung durch Abschalom (Abschnitt 17, S. 118-128)
- 6.18 Der Zusammenbruch / Die Genesung (Abschnitt 18, S. 128-133)
- 6.19 Das Unterrichten der verwahrlosten Kinder (Abschnitt 19, S. 133-136)
- 6.20 Zusammensein mit Freunden (Abschnitt 20, S. 136-139)
- 6.21 Werben für den Unterricht / Ausflug mit den Kindern (Abschnitt 21, S. 139-143)
- 6.22 Das Kriegsgeschehen rückt näher / Planungen für die Zukunft (Abschnitt 22, S. 143-145)
- 6.23 Gespräch mit Thomas Katz II (Abschnitt 23, S. 145-149)
- 6.24 Die Protagonistin meldet sich zum Militärdienst (Abschnitt 24, S. 149-153)
- 6.25 Besuch bei Neomi Rose / Zusammensein mit Freunden (Abschnitt 25, S. 153-159)
- 6.26 Gespräch mit Assaf (Abschnitt 26, S. 159-162)
- 6.27 Aufbruch (Abschnitt 27, S. 162)
- 7 Originalmanuskript versus Werkausgabe: Veränderungen und Streichungen
- 7.1 Originalmanuskript S. 1-1d versus Werkausgabe S. 5
- 7.2 Originalmanuskript S. 2-9 versus Werkausgabe S. 5-11
- 7.3 Originalmanuskript S. 9-12 versus Werkausgabe S. 11
- 7.4 Originalmanuskript S. 12-24 versus Werkausgabe S. 16-17
- 7.5 Originalmanuskript S. 25-47 versus Werkausgabe S. 36
- 7.6 Originalmanuskript S. 47-176c versus Werkausgabe S. 76-111
- 8 Protagonistin des Romans und Autorin der Tagebücher: Inhaltliche Unterschiede bzw. Überschneidungen
- 8.1 Auswirkungen und Probleme der Editierung
- 8.2 Tagebucheinträge aus dem Jahr 1939
- 8.3 Tagebucheinträge aus dem Jahr 1940
- 8.4 Tagebucheinträge aus dem Jahr 1941
- 8.5 Tagebucheinträge aus dem Jahr 1942
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Jenny Alonis Roman "Zypressen zerbrechen nicht" im Hinblick auf seine autobiographischen Elemente und setzt ihn in Beziehung zu verschiedenen Konzeptionen autobiographischen Schreibens im historischen Kontext. Die Untersuchung zielt darauf ab, den Grad der Autobiographie im Roman zu bestimmen und die literarische Gestaltung des Werks zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Ich-Konzepts in der Autobiographiegeschichte
- Die Gültigkeit autobiographischer Identitätskonzepte in "Zypressen zerbrechen nicht"
- Der Umgang mit Erinnerung und Trauma im Roman
- Die Rolle der Fiktion und Faktizität in der literarischen Gestaltung
- Der Vergleich zwischen Roman und den Tagebüchern der Autorin
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der autobiographischen Schreibweise ein und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie stellt den Roman "Zypressen zerbrechen nicht" von Jenny Aloni vor und erläutert die methodischen Ansätze der Analyse, welche die Verbindung von textimmanenter Interpretation und biographischen Informationen einschließt. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des fiktionalen Charakters des Romans trotz autobiographischer Elemente.
2 Autobiographiegeschichte: Identitätskonzeptionen von 3000 v. Chr. bis in die 1970er Jahre: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung autobiographischen Schreibens von der Antike bis in die Moderne. Es analysiert verschiedene Identitätskonzepte in unterschiedlichen Epochen und stellt deren Bedeutung für die Interpretation von Alonis Werk heraus, wobei der Fokus auf Rechtfertigung, Reflexion und dem Verhältnis von Individualität und sozialer Einordnung liegt. Der Kapitelverlauf zeigt die allmähliche Verschiebung vom Rechtfertigungsgestus hin zu einer differenzierten Selbstreflexion.
3 Jenny Aloni: 'Zypressen zerbrechen nicht': Gültigkeit autobiographiegeschichtlicher Identitätskonzepte: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz der in Kapitel 2 dargestellten autobiographischen Identitätskonzepte für Alonis Roman. Es analysiert den Roman im Hinblick auf seine Einordnung in die Shoah-Literatur, die Problematik der Erinnerung, die Aspekte von Rechtfertigung und Erklärung, sowie die Darstellung von Reflexion und Selbstkritik in der Figur der Protagonistin. Es werden auch die Aspekte von Individualität, Körperlichkeit, Geschichtlichkeit und des Judentums ohne Religion diskutiert.
4 Jüdische Autobiographie: Besondere Merkmale: Dieses Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten jüdischer Autobiographie im Kontext von Assimilation, Akkulturation und Transkulturation. Es analysiert den Einfluss von Diaspora und Exil auf die Erinnerungskultur und die Gestaltung jüdischer Identitäten in literarischen Texten. Die Diskussion um den "Sonderstatus" jüdischer Autobiographie und deren Einordnung in die allgemeine Gattungsgeschichte bildet den Mittelpunkt des Kapitels.
5 Autobiographietheorie: G. Misch, G. Gusdorf, P. Lejeune und H. Heissenbüttel: In diesem Kapitel werden verschiedene autobiographietheoretische Ansätze von Misch, Gusdorf, Lejeune und Heissenbüttel vorgestellt und kritisch bewertet. Die Einteilung der Autobiographieforschung in drei Phasen (Holdenried) wird diskutiert und die jeweiligen theoretischen Positionen in Bezug auf ihre Relevanz für die Analyse von Alonis Roman betrachtet. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis von Autobiographie und Fiktion.
6 Die Protagonistin: Veränderung der Figur im Laufe des Romans: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Protagonistin Helga/Hagar im Laufe des Romans. Es beschreibt ihre anfängliche Fremdheit, ihre Auseinandersetzung mit traumatischen Erinnerungen und ihrem Schuldkomplex, und ihre allmähliche Entwicklung hin zu größerer Selbstakzeptanz und sozialem Engagement. Die Analyse fokussiert auf die Transformation der Figur und ihre verschiedenen Identitäten.
7 Originalmanuskript versus Werkausgabe: Veränderungen und Streichungen: Dieses Kapitel vergleicht das Originalmanuskript von "Zypressen zerbrechen nicht" mit der Werkausgabe und analysiert die vorgenommenen Änderungen und Streichungen. Es beleuchtet die Intentionen der Autorin bei der Gestaltung des endgültigen Textes und diskutiert die Bedeutung dieser Veränderungen für das Verständnis des Romans.
8 Protagonistin des Romans und Autorin der Tagebücher: Inhaltliche Unterschiede bzw. Überschneidungen: Dieses Kapitel vergleicht die Protagonistin des Romans mit der Autorin der Tagebücher. Es diskutiert die editorischen Probleme und Herausforderungen, die bei der Edition von Tagebüchern entstehen und untersucht den Grad der Übereinstimmung und der Abweichungen zwischen den Tagebucheinträgen und der Romanhandlung. Der Vergleich soll den Grad der Autobiographie im Roman beleuchten.
Schlüsselwörter
Autobiographie, Autobiofiktion, Jenny Aloni, Zypressen zerbrechen nicht, Shoah-Literatur, Erinnerung, Trauma, Identität, Identitätskonstruktion, Fiktion, Faktizität, Jüdische Autobiographie, Diaspora, Exil, Autobiographietheorie, Geschichtlichkeit, Moderne, Einwanderung, Integration, Schuld, Vergangenheitsbewältigung, Gender.
Häufig gestellte Fragen zu Jenny Alonis "Zypressen zerbrechen nicht"
Was ist der Gegenstand der Analyse in diesem HTML-Dokument?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine akademische Arbeit, die Jenny Alonis Roman "Zypressen zerbrechen nicht" analysiert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der autobiographischen Elemente des Romans und deren Einordnung in den historischen Kontext autobiographischen Schreibens. Die Arbeit untersucht den Grad der Autobiographie im Roman und beleuchtet die literarische Gestaltung des Werks.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter die Entwicklung des Ich-Konzepts in der Autobiographiegeschichte, die Gültigkeit autobiographischer Identitätskonzepte in Alonis Roman, den Umgang mit Erinnerung und Trauma, die Rolle von Fiktion und Faktizität, sowie den Vergleich zwischen Roman und den Tagebüchern der Autorin. Weitere Schwerpunkte sind die Besonderheiten jüdischer Autobiographie, verschiedene autobiographietheoretische Ansätze und die Entwicklung der Protagonistin im Laufe des Romans.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein; Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte autobiographischen Schreibens; Kapitel 3 untersucht die Anwendung autobiographischer Konzepte in Alonis Roman; Kapitel 4 behandelt Besonderheiten jüdischer Autobiographie; Kapitel 5 präsentiert verschiedene Autobiographietheorien; Kapitel 6 analysiert die Entwicklung der Protagonistin; Kapitel 7 vergleicht Originalmanuskript und Werkausgabe; und Kapitel 8 vergleicht Romanprotagonistin und Tagebuchautorin.
Welche Autobiographietheorien werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Ansätze verschiedener Autobiographietheoretiker, darunter Georg Misch, Georges Gusdorf, Philippe Lejeune und Helmut Heissenbüttel. Die Einteilung der Autobiographieforschung nach M. Holdenried in drei Phasen wird ebenfalls behandelt.
Wie wird der Roman "Zypressen zerbrechen nicht" in die Shoah-Literatur eingeordnet?
Die Analyse betrachtet den Roman im Kontext der Shoah-Literatur, wobei Aspekte der Zeugenschaftsliteratur, der Erinnerungskritik im Shoah-Diskurs, und der Auseinandersetzung mit Trauma und Erinnerung im Mittelpunkt stehen.
Welche Rolle spielt die Körperlichkeit in Alonis Roman?
Die Analyse untersucht die Rolle der Körperlichkeit der Protagonistin und deren Bedeutung für die Darstellung von Trauma und Identität.
Wie werden die Unterschiede zwischen dem Originalmanuskript und der Werkausgabe behandelt?
Ein Kapitel der Arbeit vergleicht das Originalmanuskript mit der veröffentlichten Werkausgabe und analysiert die vorgenommenen Änderungen und Streichungen, um die Intentionen der Autorin bei der Gestaltung des endgültigen Textes zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Autobiographie, Autobiofiktion, Jenny Aloni, Zypressen zerbrechen nicht, Shoah-Literatur, Erinnerung, Trauma, Identität, Identitätskonstruktion, Fiktion, Faktizität, Jüdische Autobiographie, Diaspora, Exil, Autobiographietheorie, Geschichtlichkeit, Moderne, Einwanderung, Integration, Schuld, Vergangenheitsbewältigung, Gender.
Wo finde ich mehr Informationen zu dieser Arbeit?
Das HTML-Dokument liefert eine Übersicht über die Arbeit. Für detaillierte Informationen muss die vollständige Arbeit konsultiert werden. (Hinweis: Die vollständige Arbeit wird hier nicht zur Verfügung gestellt.)
- Quote paper
- Manuela Unger (Author), 2013, Autobiographisches Schreiben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232619